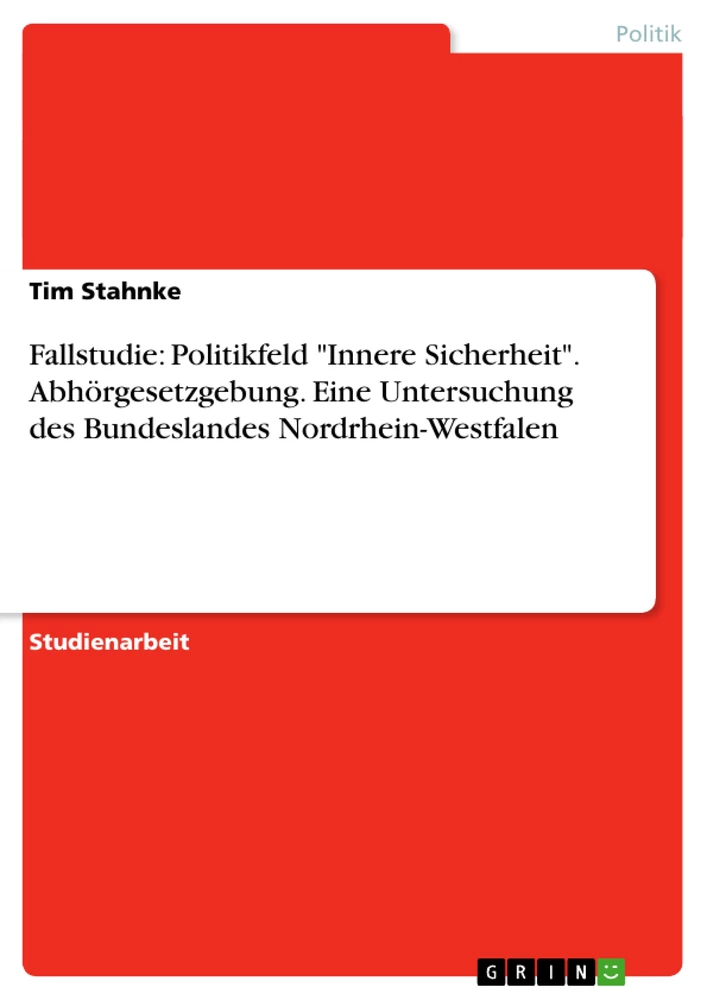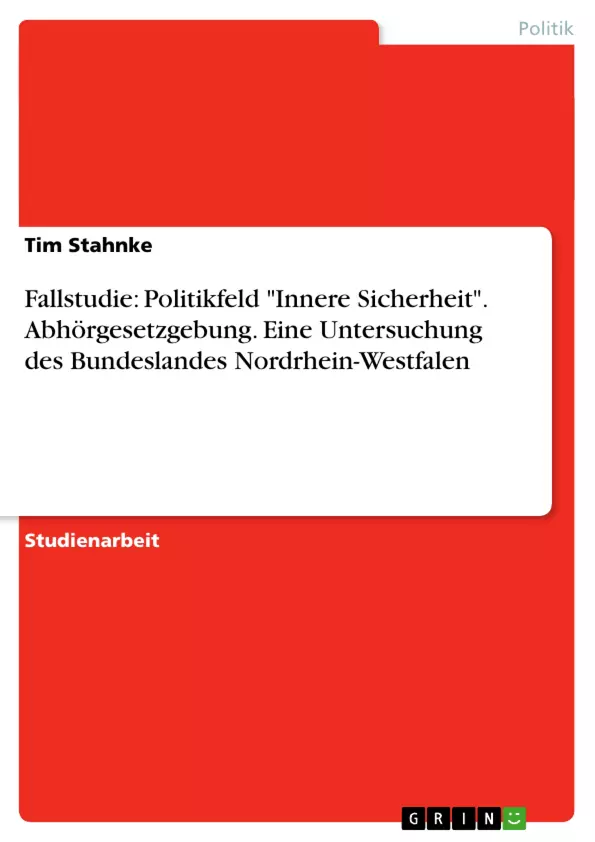Die staatlichen Abhör- und Überwachungsbefugnisse sind in den letzten Jahren erheblich erweitert worden. Der Staat kann nicht nur Telefone überwachen, er darf auch auf anderem Wege das nicht-öffentliche Gespräch abhören. Seit dem 27. März 1998 ist Artikel 13 GG dahingehend geändert, dass seither der Einsatz akustischer Wohnraumüberwachung im repressiven Bereich, also zur Strafaufklärung und Strafverfolgung möglich ist. Dadurch wurde das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt. Sinn und Zweck dieser Grundgesetzänderung war die Absicht, auf diesem Wege der zunehmenden organisierten Kriminalität besser beikommen zu können. Die Ausführungsbestimmungen für das repressive Abhören nach Artikel 13 Absatz 3 GG 1 obliegen der Gesetzgebung des Bundes und wurden im §100c StPO geregelt. So steht den Behörden der Ländern seit 1998 das Mittel der akustischen Wohnraumüberwachung zur Strafverfolgung im Rahmen dieser Strafprozessordnung zur Verfügung. Dieser Bereich des sogenannten „Großen Lauschangriffes“ spielt in der weiteren Betrachtung jedoch keine Rolle, da er für alle Länder einheitlich in der StPO geregelt ist und es deshalb keinen Handlungsbedarf der Länder zur Umsetzung dieser Normen in Länderrecht gibt.
Das Abhören zu präventiven Zwecken, also „zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder Lebensgefahr“ 2 , war der Staatsanwaltschaft und der Polizei bereits vor dieser Grundgesetzänderung gestattet und fand in der Novellierung des Artikel 13 GG im neugefassten Absatz 4 nur eine Konkretisierung. Die Ausführungsbestimmungen für das präventive „Lauschen“ liegen jedoch in der Zuständigkeit der Länder, die diese in ihren Landesverfassungsschutz- und Polizeigesetzen zum Teil sehr unterschiedlich geregelt haben. Die Grundgesetzänderung sollte also die in den Polizeigesetzen der Länder ohnehin schon vorgesehene Möglichkeit der Überwachung von Wohnräumen zur Abwehr akuter Gefahren verfassungsrechtlich fest schreiben und eine Ausdehnung des Einsatzes technischer Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen auch auf Zwecke der Strafverfolgung ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Institutionelle Rahmenbedingungen
- Politikfeldanalyse: Nordrhein Westfalen
- Problem
- Akteure
- Konstellationen, Interaktionsformen und politische Entscheidung
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Übertragung der Befugnisse zum sogenannten „Lauschen“ im Rahmen der präventiven Gefahrenabwehr nach Artikel 13 Absatz 4 GG in nordrhein-westfälisches Landesrecht. Die Arbeit analysiert die beteiligten Institutionen, Akteure und Konstellationen sowie die Interaktionsformen, die zu Entscheidungen oder Nichtentscheidungen geführt haben.
- Institutionelle Rahmenbedingungen in Nordrhein-Westfalen
- Politische Ausgangslage in Nordrhein-Westfalen
- Akteure und deren Einfluss auf die Entscheidungsfindung
- Konstellationen und Interaktionsformen im politischen Prozess
- Analyse der Entscheidungsfindung im Kontext der präventiven Gefahrenabwehr
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt das Thema der Abhörgesetzgebung im Kontext der präventiven Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen vor und führt in die Thematik ein.
- Hauptteil:
- Institutionelle Rahmenbedingungen: Dieser Abschnitt beleuchtet die institutionelle Ausgangslage in Nordrhein-Westfalen und stellt relevante Akteure und Institutionen vor.
- Politikfeldanalyse: Nordrhein Westfalen: Dieser Abschnitt analysiert die Thematik der Abhörgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen und beleuchtet die beteiligten Akteure, Konstellationen und Interaktionsformen sowie die Entscheidungsprozesse, die zu der aktuellen Gesetzeslage geführt haben.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Abhörgesetzgebung, präventive Gefahrenabwehr, Artikel 13 Absatz 4 GG, Nordrhein-Westfalen, Landesrecht, Politikfeldanalyse, Akteure, Konstellationen, Interaktionsformen, Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was erlaubt Artikel 13 Absatz 4 des Grundgesetzes?
Er erlaubt den Einsatz technischer Mittel zur Überwachung von Wohnungen (akustische Wohnraumüberwachung) zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit.
Was ist der Unterschied zwischen repressivem und präventivem Abhören?
Repressives Abhören dient der Strafverfolgung bereits begangener Taten (Bundeszuständigkeit), während präventives Abhören der Verhinderung künftiger Gefahren dient (Länderzuständigkeit).
Wie ist die Rechtslage in Nordrhein-Westfalen bezüglich des "Lauschangriffs"?
Die Arbeit analysiert, wie NRW die verfassungsrechtlichen Vorgaben in sein Landespolizeigesetz integriert hat und welche politischen Debatten dieser Entscheidung vorausgingen.
Wer entscheidet über eine akustische Wohnraumüberwachung?
In der Regel ist hierfür eine richterliche Anordnung erforderlich, außer bei Gefahr im Verzug, wo eine nachträgliche Bestätigung eingeholt werden muss.
Warum ist die Abhörgesetzgebung rechtlich so umstritten?
Weil sie massiv in das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung und den Kernbereich privater Lebensgestaltung eingreift.
- Quote paper
- Tim Stahnke (Author), 2004, Fallstudie: Politikfeld "Innere Sicherheit". Abhörgesetzgebung. Eine Untersuchung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29574