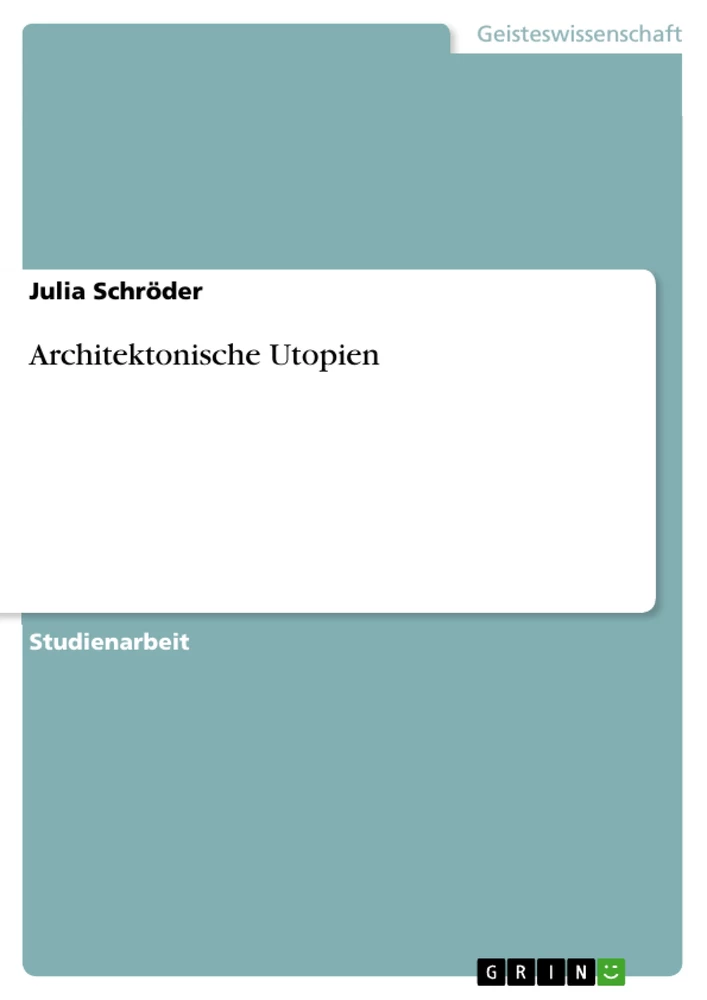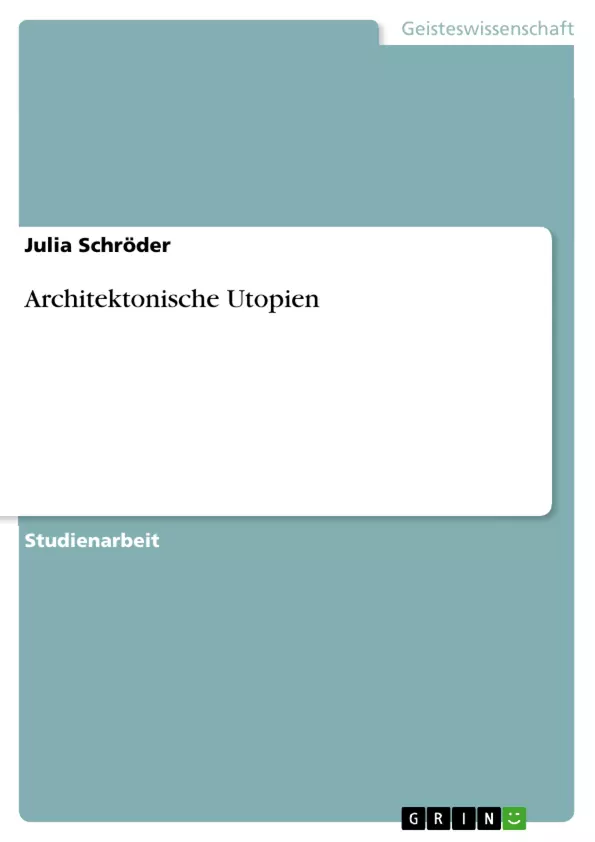Anhand des Referates über architektonische Utopien soll die Relevanz der Thematik für die Soziologie differenziert beleuchtet werden.
Schwerpunkt der Arbeit bildet dabei die Frage, ob es überhaupt jemals eine „Architektur des Glücks“ gab und inwieweit eine Einflussnahme der Architektur auf den Menschen und die Gesellschaft möglich war, ist und sein könnte.
Zunächst steht der Begriff der architektonischen Utopie im Mittelpunkt der Ausführungen. Dabei werden verschiedene gedankliche Entwicklungen im Bezug auf den Wirkungszusammenhang von Mensch und Umwelt angerissen. Es folgen einige Beispiele für architektonische Utopien oder Städtebau mit utopischem Gehalt und Überlegungen zu ihrer Effektivität. Anschließend wird die gegenwärtige Situation des Städtebaus, ihre Trends und ihre mögliche Weiterentwicklung untersucht. In dem Zusammenhang werden auch auf die daraus resultierenden Probleme und Veränderungen für die Gesellschaft und Umwelt thematisiert.
In der Schlussbemerkung werden Vorschläge für eine, nach eigenem Befinden, bessere Architektur formuliert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung:
- Was ist eine architektonische Utopie?
- Das Verhältnis des Menschen zur Architektur:
- Beispiele für utopische Architektur:
- Renaissance:..
- Die Gartenstadt:
- Architektur und Städtebau mit utopischem Gehalt nach dem 1. Weltkrieg:
- Bauhaus.......
- Utopische Architektur in den 60-er Jahren des 20. Jahrhunderts:
- „Archigram\":
- Hat die architektonische Utopie eine Zukunft?.
- Schlussbemerkung:..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Das Referat über architektonische Utopien beleuchtet die Relevanz des Themas für die Soziologie. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage, ob es jemals eine „Architektur des Glücks“ gab und inwieweit Architektur den Menschen und die Gesellschaft beeinflussen konnte, kann und könnte.
- Definition und Kategorisierung des Begriffs „architektonische Utopie“
- Analyse des Wirkungszusammenhangs zwischen Mensch und Umwelt
- Vorstellung und Bewertung von Beispielen für utopische Architektur und Städtebau
- Untersuchung der gegenwärtigen Situation des Städtebaus, seiner Trends und möglichen Weiterentwicklung
- Diskussion der daraus resultierenden Probleme und Veränderungen für Gesellschaft und Umwelt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der architektonischen Utopien ein und definiert den Begriff. Dabei werden die beiden Kategorien der technischen und der politisch-sozialen Stadtutopie vorgestellt. Außerdem wird der Wirkungszusammenhang zwischen Architektur und menschlichem Verhalten beleuchtet, wobei verschiedene Denkströmungen, wie Umweltdeterminismus, Possibilismus und probabilistische Sichtweise, diskutiert werden.
Das Kapitel „Das Verhältnis des Menschen zur Architektur“ behandelt die Notwendigkeit des Menschen, sich ein sicheres und befriedigendes Umfeld zu schaffen. Dabei wird der Einfluss kultureller Normen und Werte auf die Gestaltung der Umwelt und die Bedeutung der „Sprache des Raumes“ hervorgehoben.
Das Kapitel „Beispiele für utopische Architektur“ präsentiert ausgewählte Beispiele aus der Vergangenheit und untersucht deren Erfolgsaussichten. Dabei werden unter anderem die Renaissance, die Gartenstadt und die Architektur des Bauhauses betrachtet.
Schlüsselwörter
Architektonische Utopie, Stadtutopie, Umweltdeterminismus, Possibilismus, probabilistische Sichtweise, Architektur und menschliches Verhalten, „Sprache des Raumes“, kulturelle Normen und Werte, Renaissance, Gartenstadt, Bauhaus.
- Quote paper
- Magistra Artium Julia Schröder (Author), 1999, Architektonische Utopien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2968