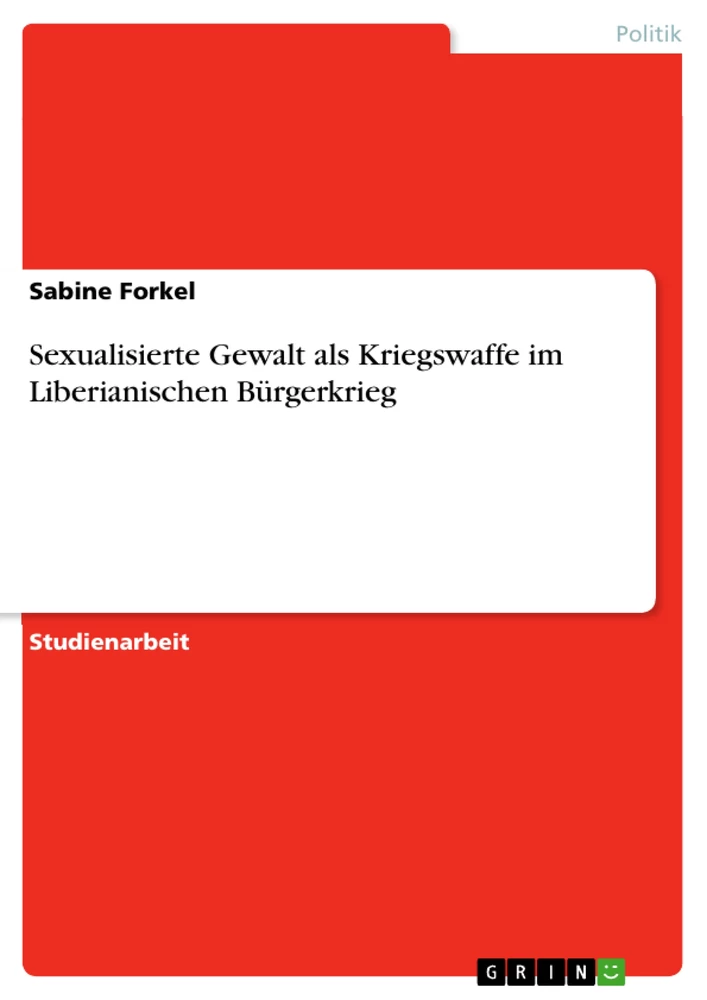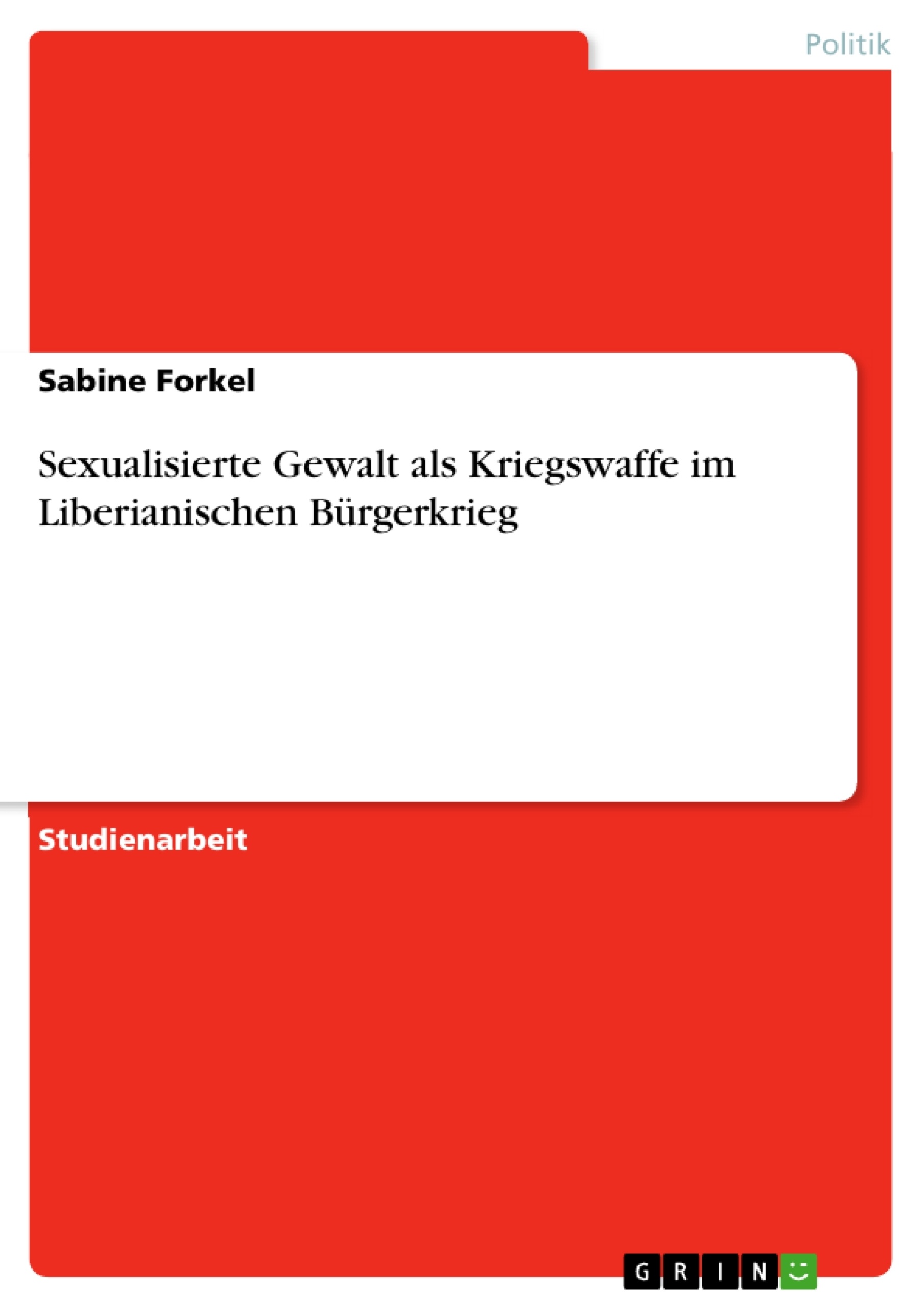Lange Zeit fand das Phänomen der sexualisierten Gewalt in bewaffneten Konflikten kaum Aufmerksamkeit, wurde verschwiegen, verharmlost oder gar negiert. Heute weiß man, dass sexualisierte Gewalt vermutlich in allen größeren Konflikten der Geschichte zum Einsatz kam und bis heute angewendet wird. Dabei wird in vielen Fällen sexualisierte Gewalt aus strategischen Gründen benutzt und auf diese Weise gezielt als Kriegswaffe instrumentalisiert.
Erst in den vergangenen Jahrzehnten wurde im Rahmen von Menschenrechtsdiskursen, den internationalen Abkommen zum Kriegsverbrechen und der Feminismusdebatten begonnen, dieses Thema zu enttabuisieren und zu problematisieren. Eine wichtige Rolle spielte dabei die durch die Ad-hoc-Kriegsverbrechertribunale vorgenommene Aufarbeitung der Bürgerkriege im ehemaligen Jugoslawien 1992 sowie des Genozids in Ruanda 1994. Diese konnten durch Zeugenaussagen einiger Opfer erstmals nachweisen, dass es während der bewaffneten Auseinandersetzungen massenweise zu Vergewaltigungen und erzwungenen Schwangerschaften kam. Beide Tribunale haben mittlerweile zahlreiche bahnbrechende Urteile gefällt und sexualisierte Gewalt unter vielen verschiedenen Verbrechenskategorien erfolgreich angeklagt. Im Zuge dessen wurde sexualisierte Gewalt genauer definiert und unter internationalem Recht als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gelistet.
Trotzdem wird bis heute das Phänomen sexualisierte Gewalt in seiner individuellen Grausamkeit oft als ein Nebenprodukt bewaffneter Konflikte verstanden. Diese Arbeit hingegen betrachtet sexualisierte Gewalt nicht aus individueller, sondern aus makrosoziologischer Sicht und zeigt die Ausmaße deren Einflussmöglichkeiten in bewaffneten Konflikten am Beispiel des Bürgerkriegs in Liberia auf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Hintergrund
- 2.1 Gründung des Staates Liberia
- 2.2 Staatsaufbau und gesellschaftspolitische Konflikte
- 2.3 Das Regime Samuel Doe
- 3. Der Liberianische Bürgerkrieg – Eine Analyse
- 3.1 Verlauf
- 3.2 Akteure
- 3.3 Konfliktursachen
- 3.4 Auswirkungen
- 4. Sexualisierte Gewalt im Liberianischen Bürgerkrieg
- 4.1 Begriffliche Eingrenzung
- 4.2 Motive und Auswirkungen sexualisierter Gewalt
- 4.3 Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe
- 4.4 Folgen für die Bevölkerung
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Rolle von sexualisierter Gewalt im Liberianischen Bürgerkrieg aus makrosoziologischer Perspektive. Der Fokus liegt auf der Einordnung sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe und deren Auswirkungen auf die Bevölkerung.
- Die Entstehung des Staates Liberia und die gesellschaftlichen Konflikte vor dem Bürgerkrieg
- Der Verlauf und die Akteure des Liberianischen Bürgerkriegs
- Die Verwendung von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe und Kriegsstrategie
- Die Folgen von sexualisierter Gewalt für die Bevölkerung und die Nachkriegsgesellschaft in Liberia
- Die Bedeutung der Einordnung sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten als ein strukturelles Phänomen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten ein und skizziert die historische Entwicklung des Themas. Kapitel 2 beleuchtet den historischen Hintergrund des Liberianischen Bürgerkriegs und die Entstehung des Staates Liberia. Kapitel 3 analysiert den Verlauf, die Akteure und die Ursachen des Bürgerkriegs. Kapitel 4 untersucht die Rolle von sexualisierter Gewalt im Liberianischen Bürgerkrieg und beleuchtet die Folgen für die Bevölkerung.
Schlüsselwörter
Sexualisierte Gewalt, Bürgerkrieg, Liberia, Kriegswaffe, Kriegsstrategie, Menschenrechte, Konfliktanalyse, Postkonfliktgesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird sexualisierte Gewalt als „Kriegswaffe“ bezeichnet?
Weil sie oft nicht nur ein Nebenprodukt von Konflikten ist, sondern strategisch und gezielt eingesetzt wird, um Bevölkerungen zu demoralisieren und zu zerstören.
Welche Rolle spielten internationale Tribunale bei der Aufarbeitung?
Die Tribunale zu Jugoslawien (1992) und Ruanda (1994) waren wegweisend, um sexualisierte Gewalt erstmals völkerrechtlich als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anzuklagen.
Wie war die Situation im Liberianischen Bürgerkrieg?
Die Arbeit analysiert aus makrosoziologischer Sicht das massive Ausmaß sexualisierter Gewalt während des Konflikts und deren Funktion innerhalb der Kriegsstrategien.
Was sind die langfristigen Folgen für die liberianische Gesellschaft?
Die Gewalt hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Nachkriegsgesellschaft, einschließlich Traumatisierung der Opfer und Zerstörung sozialer Strukturen.
Welcher historische Hintergrund führte zum Bürgerkrieg in Liberia?
Die Arbeit beleuchtet die Staatsgründung Liberias, gesellschaftspolitische Konflikte und das Regime von Samuel Doe als Ursachen für den späteren Krieg.
- Quote paper
- Sabine Forkel (Author), 2013, Sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe im Liberianischen Bürgerkrieg, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298226