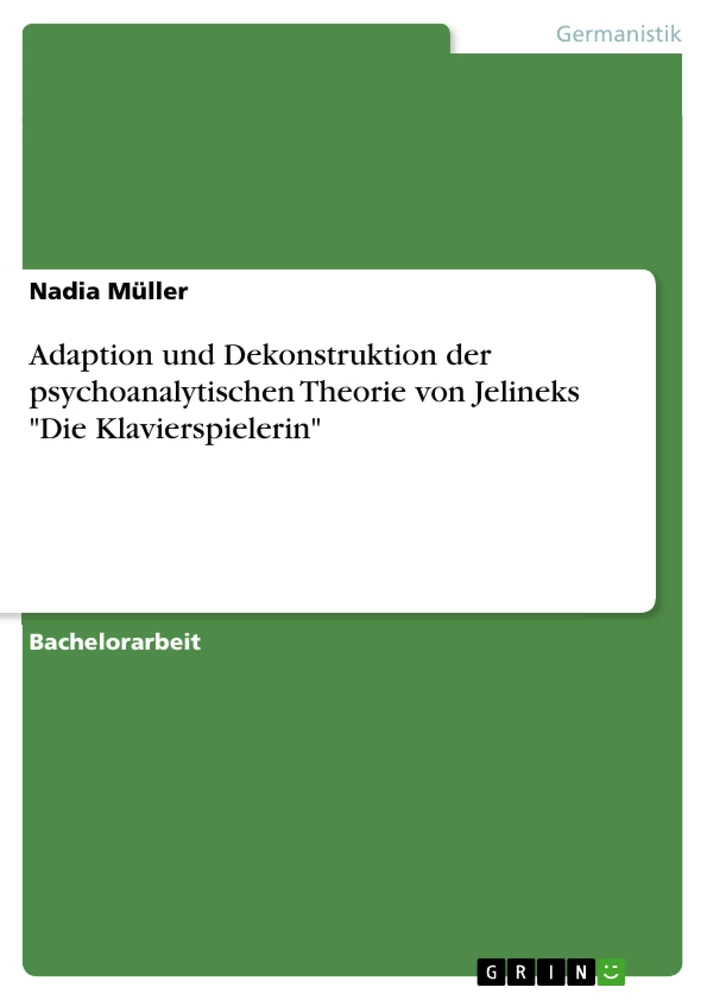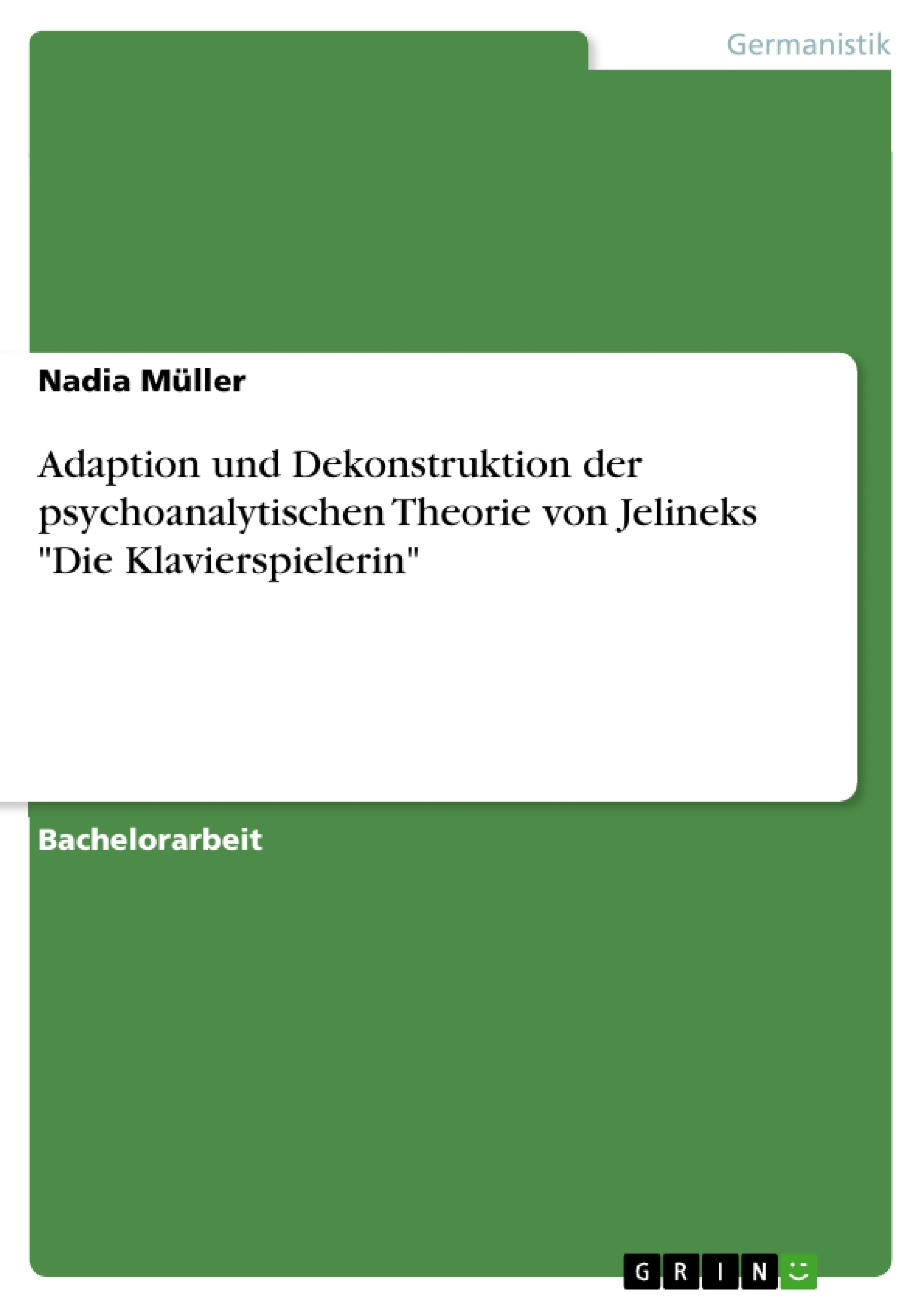Sie [Elfriede Jelinek] hasst Musik, sie hasst Wien, sie hasst Menschen. Und sie haßt vor allem sich selbst. Das macht die Jelinek-Lektüre so verdrießlich. Sie möchte ganz einfach ihre Leser zum Kotzen bringen. Bei labilen Naturen schafft sie es mit der Klavierspielerin bestimmt. Aber das ist eine Art von Qualität, auf die wir uns nicht einlassen mögen.
Mit diesem rigorosen Urteil diskreditierte der Rezensent Reinhard Beuth in ‚Die Welt‘ die österreichische Autorin Elfriede Jelinek mit ihrem 1983 erschienenen Roman „Die Klavierspielerin“ . Jelinek wurde nicht nur vereinzelt mit solch einer scharfen Kritik konfrontiert, sondern traf in den Rezensionen ihrer Werke immer wieder auf Urteile, die ihr Werk als „erbarmungslos und brutal“ dahinzustellen versuchten. Jelinek deutet die Ursache dahingehend aus, dass von einer Frau gefälligere Texte zu erwarten seien. Doch die Resonanz fiel kontrovers aus. Der Literaturkritiker Reich-Ranicki bezeichnete Jelinek als eine „ganz ungewöhnliche, völlig aus dem Rahmen fallende, radikale und extreme Schriftstellerin und in Folge dessen höchst umstritten.“ Die österreichische Schriftstellerin hat sich mit ihrem Roman Die Klavierspielerin, der zu den erfolgreichsten Arbeiten deutschsprachiger Autorinnen gehört, Respekt verschafft. Nach einer Vielzahl wissenschaftlicher Arbeiten erreichte der Roman den Klassikerstatus und fand Eingang in den Kanon. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Der theoretische Hintergrund – Psychoanalytische Theorien Freuds und Lacans
- Inszenierung der Psychoanalyse: Adaptive Elemente
- Mutter-Tochter- Symbiose:.
- Erikas Sadomasochismus......
- ,,Aneignungsversuch einer, phallischen Position\": Erika als Voyeurin: ........
- Erikas Scheitern als Herrin...………………….
- Konstruktion des erstarrten Herrschaftsdiskurses:...
- Dekonstruktion: Subversive Elemente
- Intertextualität
- Parodie Freuds und Lacans.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“ im Kontext der psychoanalytischen Theorien von Freud und Lacan. Sie untersucht, wie Jelinek die psychoanalytischen Konzepte adaptiert und dekonstruiert, um die patriarchalen Strukturen und Herrschaftsmechanismen in der Gesellschaft zu kritisieren. Die Arbeit beleuchtet die subversiven Elemente im Roman und analysiert, wie Jelinek die psychoanalytischen Theorien bis ins Groteske verzerrt, um ihre Gültigkeit in Frage zu stellen.
- Die Adaption und Dekonstruktion psychoanalytischer Theorien in Jelineks Roman
- Die Darstellung der Mutter-Tochter-Symbiose und ihre Auswirkungen auf Erikas Entwicklung
- Erikas „Penisneid“ und ihre Versuche, eine „phallische Position“ einzunehmen
- Die Subversion und Dekonstruktion psychoanalytischer Konzepte durch Intertextualität und Parodie
- Die Kritik an patriarchalischen Strukturen und Herrschaftsmechanismen in der Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Elfriede Jelinek und ihren Roman „Die Klavierspielerin“ vor und beleuchtet die kontroversen Reaktionen auf ihr Werk. Sie erläutert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz der Arbeit.
Kapitel 2 präsentiert den theoretischen Hintergrund der Arbeit und skizziert die zentralen Theorien von Freud und Lacan. Es zeigt, wie diese Theorien trotz ihrer patriarchalischen Prägung als posthumanistische Wegweiser galten.
Kapitel 3 widmet sich den adaptiven Elementen der Psychoanalyse in Jelineks Roman. Es analysiert die Mutter-Tochter-Symbiose, Erikas Sadomasochismus, ihre Versuche, eine „phallische Position“ einzunehmen, ihr Scheitern als Herrin und die Konstruktion des erstarrten Herrschaftsdiskurses.
Kapitel 4 beleuchtet die subversiven Elemente in Jelineks Roman. Es untersucht die Intertextualität und die Parodie als Strategien der Dekonstruktion und zeigt, wie diese Mittel die psychoanalytischen Theorien untergraben.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen der Psychoanalyse, der Dekonstruktion, der Intertextualität, der Parodie, der Mutter-Tochter-Symbiose, dem Sadomasochismus, dem „Penisneid“, der „phallischen Position“ und dem Herrschaftsdiskurs. Sie analysiert Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspielerin“ im Kontext der Theorien von Freud und Lacan und untersucht die subversiven Elemente in ihrem Werk.
- Arbeit zitieren
- Nadia Müller (Autor:in), 2015, Adaption und Dekonstruktion der psychoanalytischen Theorie von Jelineks "Die Klavierspielerin", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298520