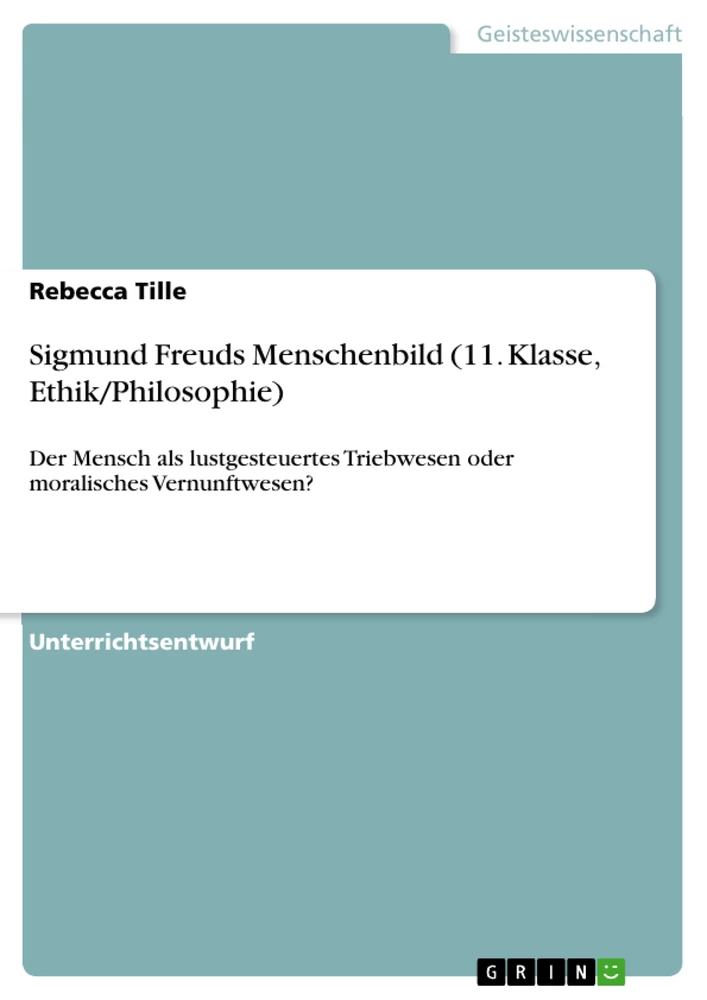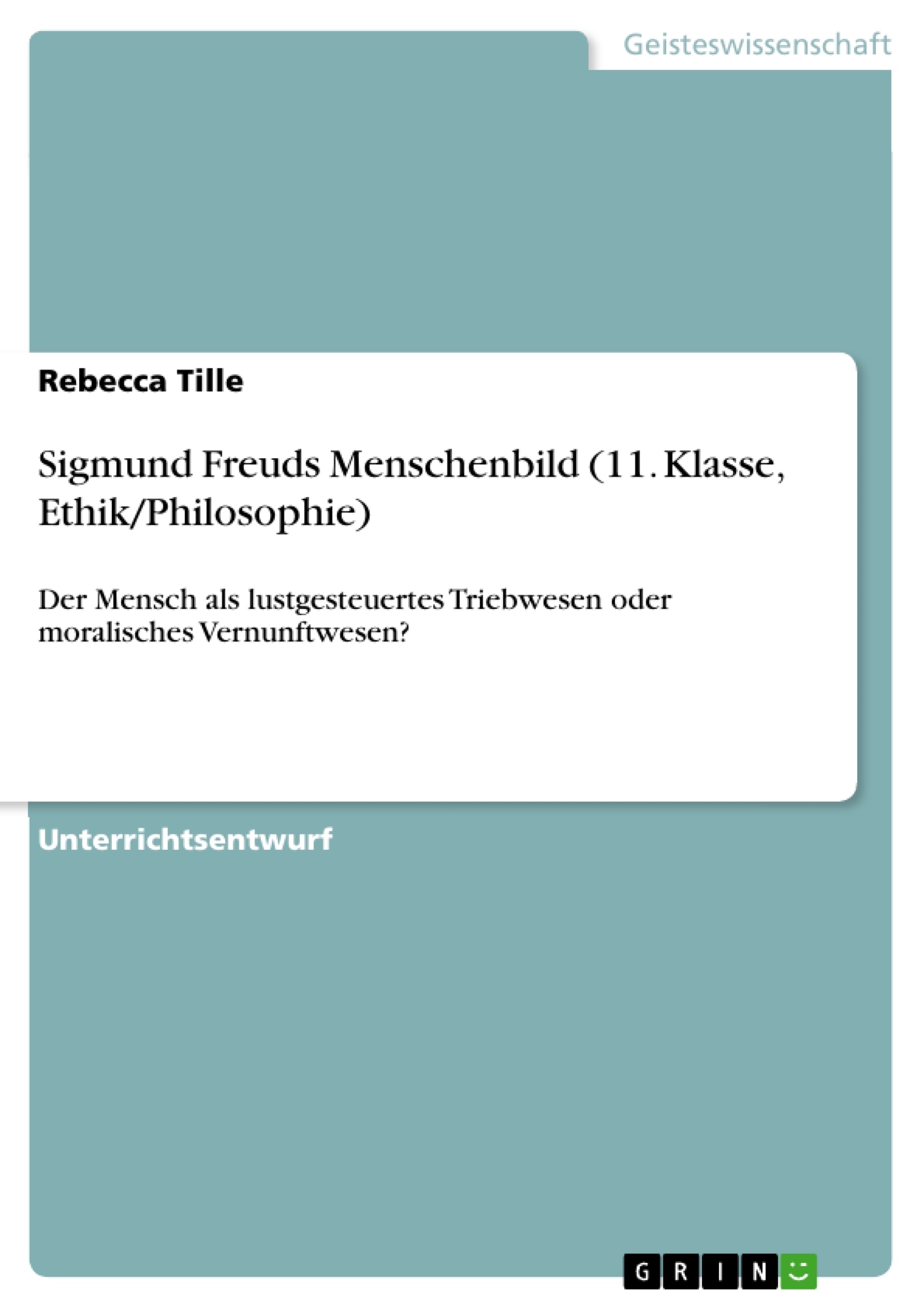Dieser Lehrprobenentwurf liefert eine Unterrichtsreihe zum Thema "Anthropologie" für eine 11. Klasse im Fach Ethik/ Philosophie und eine ausführlich geplante Unterrichtsstunde, in welcher das psychologische Menschenbild Sigmund Freuds - genauer sein Instanzenmodell - problemorientiert eingeführt, grundlegend erfasst und angewandt wird. Die Stunde wird durch die kontrastierende Fragestellung: "Ist der Mensch ein lustgesteuertes Triebwesen oder ein moralisches Vernunftwesen?" und eine Meinungslinie, auf der sich die S entsprechend positionieren sollen, motivationsfördernd und schüleraktivierend eingeleitet. Für die Erarbeitungsphase wird die Methode des Gruppenpuzzles herangezogen. Im 1. Schritt erarbeiten die S in Expertengr. textgestützt die einzelnen Instanzen Es, Ich und Über-Ich nach Inhalt, Prinzip u. Ziel. Im 2. Schritt findet ein Austausch statt u. mittels eines 2. Textes soll ein Schema zum Zusammenspiel der Instanzen erstellt werden. Nach der Präsentationsphase entwickeln die S im 3. Schritt in ihrer Exp-Gr. ein szen. Spiel zu einer selbstgewählten Dilemmasit. u bringen dabei Freuds Instanzenmodell zur Anwendung. Die Erarbeitungsphase wird gestützt durch Tipp- u. Lösungskarten. Nach der 2. Präsentationsphase erfolgt eine Auswertung sowie method. Reflexion.
Den Abschluss bildet die erneute Positionierung auf der Meinungslinie durch die S zur provokativen Einstiegsfrage, wodurch ein Transfer erfolgt.
In der Arbeit ist neben einer beispielhaften Begründungsanalyse der Lerngruppe, eine umfassende didaktisch-methodische Begründung (Lernziele, Lehrplanbegründung) sowie eine tabellarische Verlaufsplanung der Stunde zu finden. Der Anhang stellt das gesamte benötigte Material zur Durchführung der Stunde bereit (Sitzplan, alle Texte, method. Aufgabenblätter, Tipp- und Kontrollkarten sowie die Lehrerpräsentation).
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Bedingungsanalyse der Lerngruppe und Schlussfolgerungen für die Gestaltung des Unterrichts.
- Didaktisch-methodische Überlegungen und Begründungen.
- Stellung der Stunde in der Stoffeinheit.
- Sachanalyse.
- Darstellung und Begründung der Lernziele.
- Begründung der didaktisch-methodischen Entscheidungen.
- Tabellarische Verlaufsplanung.
- Literaturverzeichnis.
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Unterrichtsstunde zielt darauf ab, den Schülern die psychologische Deutung des Menschen nach Sigmund Freud näherzubringen. Insbesondere wird das Spannungsfeld zwischen dem Lust- und Moralitätsprinzip im Zentrum der Betrachtung stehen. Ziel ist es, dass die Schüler ein tieferes Verständnis für die Komplexität des menschlichen Wesens und seine verschiedenen Facetten entwickeln.
- Der Mensch als Triebwesen.
- Die Freud'sche Lehre vom Unbewussten.
- Das Spannungsfeld zwischen Lust und Moral.
- Die Rolle der Kultur und der Gesellschaft in der Entwicklung des Menschen.
- Die Bedeutung der Anthropologie für die Ethik.
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Im ersten Kapitel werden die Voraussetzungen der Lerngruppe und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Gestaltung des Unterrichts beschrieben. Kapitel 2 befasst sich mit den didaktisch-methodischen Überlegungen und Begründungen, einschließlich der Stellung der Stunde in der Stoffeinheit, der Sachanalyse, der Darstellung und Begründung der Lernziele sowie der Begründung der didaktisch-methodischen Entscheidungen. Die tabellarische Verlaufsplanung der Stunde wird in Kapitel 3 vorgestellt.
Schlüsselwörter (Keywords)
Anthropologie, Sigmund Freud, Psychoanalyse, Lustprinzip, Moralitätsprinzip, Bewusstseinsstufen, Trieb, Unbewusstes, Kultur, Gesellschaft, Ethik.
- Citar trabajo
- Rebecca Tille (Autor), 2015, Sigmund Freuds Menschenbild (11. Klasse, Ethik/Philosophie), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298714