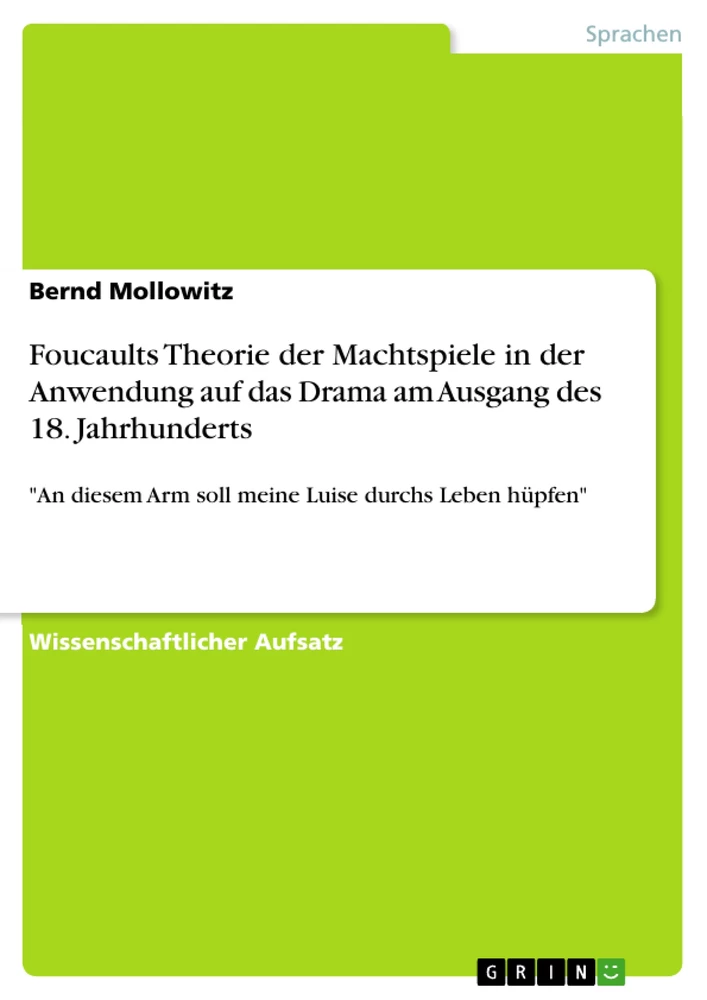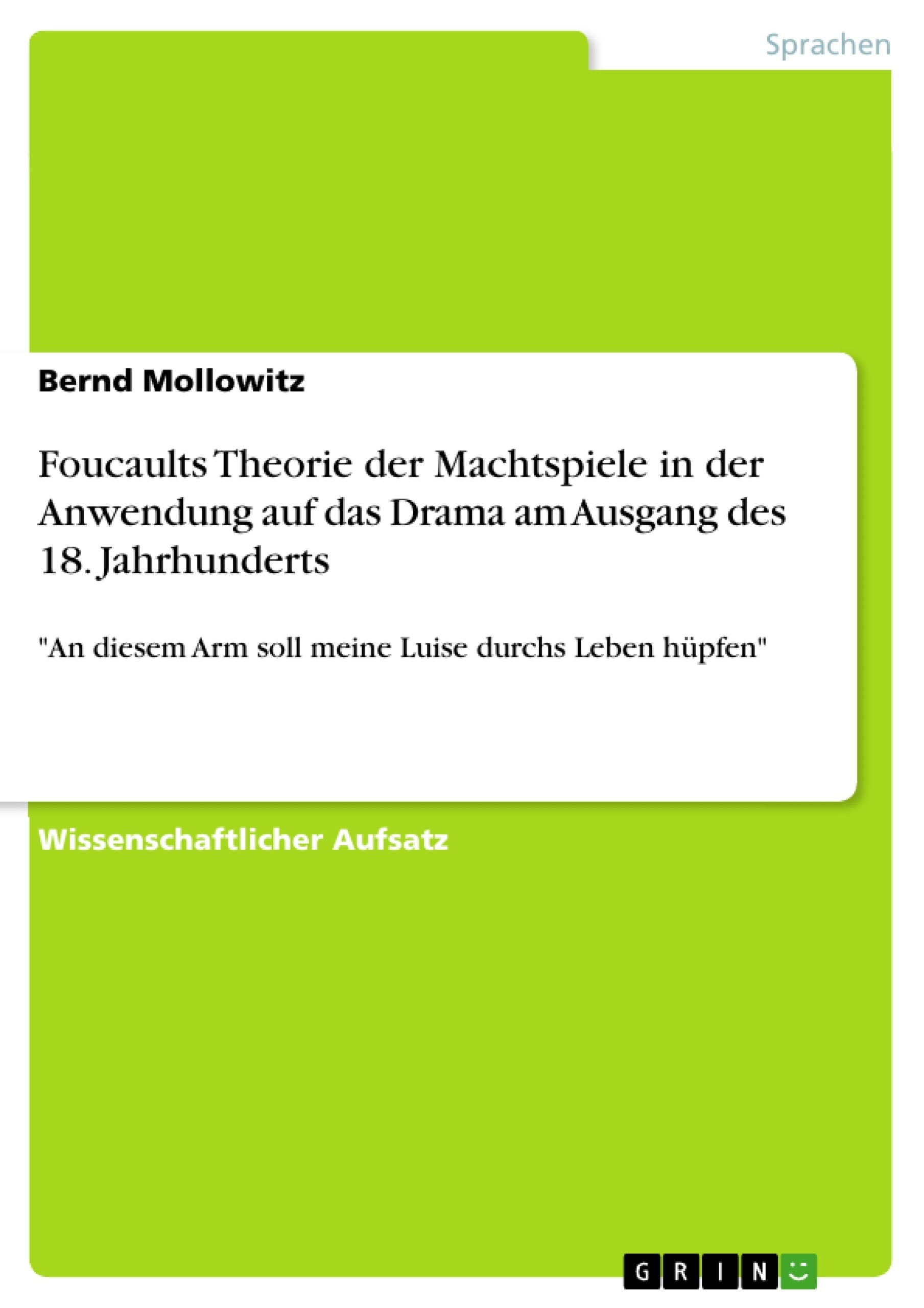Wenn es einen Sinn machen soll, die Schublade "Drama" anzuwenden, dann müssen "dem Dramatischen" eine besondere Aufgabe und auch ein besonderes Potential zukommen.
Foucault sieht in den freien Machtspielen der Subjekte eine Chance, Potentiale aufzugreifen und wechselseitig zu entwickeln. Galtung spricht davon, dass "Konflikte grundsätzlich als eine der stärksten Antriebskräfte unserer Existenz begriffen werden", als "ein Element, das für das gesellschaftliche Leben ebenso notwendig ist wie für das menschliche Leben die Luft". Diese Konflikte werden im Drama ausgetragen, das dadurch seine Einzigartigkeit erhält.
Die Arbeit untersucht schwerpunktmäßig die Machtspiele in Schillers "Kabale und Liebe" (und ist damit zugleich eine etwas andere Art der Interpretation als die herkömmlichen); die Frage wird geklärt, warum Schillers Schauspiel als Tragödie endet. Kontrastierend wird in einem Exkurs Goethes "Iphigenie" als letztlich versöhnliche Auseinandersetzung zwischen den Konfliktparteien angesprochen.
Inhaltsverzeichnis
I.1 Little boxes
I.2 Little box : Drama
I.3 Notwendige Vorbemerkung
II.1 Zur Begrifflichkeit
II.2 Die Begriffe "Macht" und "Herrschaft"
II.3 Der Begriff der "Gewalt"
III. Schillers Intention
III.1 Der Ist-Zustand
III.2 Der Soll-Zustand
IV. Schillers Methode
V. Interpretation Schiller, Kabale und Liebe
V.1 Ferdinand von Walter, Luise Miller
V.2 Der Musikus Miller
V.3 Die Kabalisten
V.4 Lady Milford
VI. Über die Rezeption
VI.1 Die zeitgenössische Rezeption
VI.2 Mit heutigen Augen gelesen oder Kommunikation als Lebenskunst
VII. Epilog oder Die Autonomie der Iphigenie
Anmerkungen
Quellentexte
Literatur
I.1. Little boxes
Kinderspielzeuge sind sie, die kleinen Schachteln, in die wir in unserem Ordnungswahn alles einzuordnen suchen, gebastelt und aufgestellt von großen und kleinen Kindern : "Im Menschen lebt ein tiefer Wille zur Einteilung, er hat einen heftigen, ja leidenschaftlichen Hang, die Dinge abzugrenzen, einzufrieden, zu etikettieren. Das Lieblingsspielzeug vieler Kinder ist die Schachtel. Aber auch der Erwachsene trägt immer ein unsichtbares Quadrat- netz mit sich herum." Diese Sehn-Sucht nach einer "artikulierten, gestuften, interpungierten Welt"1 scheint allgegenwärtig. Dabei dürfte jedem reflektierenden Menschen klar sein, dass es sich bei diesen Ordnungs-Behelfen, auf die zu stützen uns angeblich hilfreich sein könn- te, um bloße Krücken handelt. Krücken behindern aber auch, und sie verhindern den unver- bildeten Zugriff auf das, was wirklich zur Untersuchung ansteht. "Das Königreich des Men- schen betritt man ohne Krücken."2
Jeder Lernwillige wird mit zahlreichen dieser Krücken konfrontiert; sie helfen, gedank- liche Gerüste aufzubauen, welche Orientierung geben, wie alle Gerüste aber auch ein-rüsten und einen offenen Zugang versperren. Auch die Literaturwissenschaft arbeitet mit ihnen, und die Dreiteilung der fiktionalen Texte in die Gattungsbegriffe "Epik", "Lyrik" und "Dra- matik" gehört dazu, und das schon seit langer Zeit. Vom Griechen Aristoteles ist eine "Poe- tik" auf uns gekommen, deren Gesamtaufbau zwar nicht vollständig überliefert ist, die aber für die nachfolgenden Generationen Vor-Bild gewesen ist und ein Ansporn zum Weiterbau auf diesem Boden.
Wenn wir uns bei den folgenden Überlegungen mit Fragen der Dramatik beschäftigen, so gehe ich davon aus, dass diese Dramatik-Box in ihrer Abgrenzung zu den anderen Schachteln nur dann Sinn macht, wenn aus dieser Abgrenzung selbst schon Erkenntnisse abgeleitet werden können, die wir hinterher für die Arbeit im Detail an unserem Thema fruchtbar machenkönnen.
I.2 Little box : Drama
Unser Ordnung schaffender Spielplatz also ist das Drama, besser 'das Dramatische', denn es soll um Haltungen gehen, die sich in (poetische) Handlungen umsetzen. Was also kenn-zeichnet diese Haltung der Darstellung ? Anders als die lyrische Darstellung, die ihren Na- men von der "Lyra", einem harfenähnlichen Musikinstrument, ableitet (was auf die Nähe des lyrischen Schreibens zur Musik verweist) und deren Sprache rhythmisiert und in Bilder gekleidet ist, und anders als das epische Darstellen, das auf die Vermittlungsinstanz eines Erzählers verweist, reduziert sich die dramatische Darstellung auf eine reine Handlung, de- ren Protagonisten Sprechrollen übernehmen und Konflikte in Dialogen3 austragen.
In unserer Alltagssprache verwenden wir den Begriff "dramatisch" immer dann, wenn etwas Spannendes vor sich geht (ein dramatisches Fußballspiel etwa) oder wenn es Folgen hat, die wir 'tragisch' nennen. Wir werden sehen, dass auch dieser Begriff des Tragischen in der Alltagssprache eine ganz andere Bedeutung hat als in der Literaturgattung 'das Drama- tische'.
Wir übernehmen nun für unseren literarischen Gattungsbegriff aus der Alltagssprache das Moment derSpannung : Jedes Drama hat einen eigenen Spannungs-Bogen, der sich aber nicht insensationellen, unsere Aufmerksamkeit reizenden Aktionen zeigen muss, son-dern der vonder Spannung lebt, die in der Austragung des Konfliktes liegt zwischen zwei (oder mehreren) Positionen, die Anlass geben für den leitenden Dialog. Wir brauchen also These undAntithese, und wir brauchen Rollen-Spieler, die die unterschiedlichen Seiten vertreten (die sog. Protagonisten und Antagonisten).
Je nach der Lösung dieser Konflikte unterscheiden wir weitere Boxen : Wir trennen die 'Tragödie', die eben 'tragisch' endet, weil die handelnden Personen nicht zu einer Einigung gefunden haben, von der 'Komödie', in der der menschliche Streit sich oft in einer humor- vollen Einsicht in menschliche Unzulänglichkeiten auflöst, die die beteiligten Personen zu einer Einsicht kommen lässt, die letzte (tödliche) Konsequenzen verhindert.
Dass diese Differenzierung in ihrer Schubladenhaftigkeit zu grob ist, zeigt ein Vergleich zwischen Schillers Kabale und Liebe und Goethes Iphigenie: Während Schillers Schau- spiel als Tragödie endet, kommt es bei Goethes Schauspiel zu einer Versöhnung,die weit entfernt ist von einem Ende, das wir 'komödienhaft' nennen könnten. Ein Drama zu schrei-ben, das offensichtlich undramatisch endet, muss für Goethe eine Herausforderung gewesen sein, wie seine spätere Bemerkung zeigt, die Iphigenie sei als Schauspiel ganzverteufelt human. 4
Worin diese Bemerkung Goethes ihren Grund hat und worin die grundsätzlichen Unter- schiede hinsichtlich der Auflösung der beiden Schauspiele liegen, das wird die unten folgen-de Detail-Analyse zeigen. Zuvor allerdings bedarf es noch einer Vorbemerkung, und es muss noch an wesentlichem Begriffs-Instrumentarium gebastelt werden : neue kleine Boxen werden gezimmert.
I.3 Notwendige Vorbemerkung
Die Interpretation eines Textes meint dessen "Auslegung". Im Unterschied zu Sachtex-ten, die eine deutliche Handlungsanweisung an den Rezipienten im Interesse des Senders enthalten unddaher ein-dimensional ausgerichtet sind, verstehen fiktionale Texte sich als polyvalent und lassendem entsprechend nicht nur unterschiedliche Auslegungen zu, son-dern fordern sie sogar. Die Mehr-Dimensionalität dieser Texte verweigert eine ein-deutige Auslegung zugunsten einer Vielzahl vonVersuchen, die sich wechselseitig ergänzen oder sogar widersprechen. Jeder Leser ist ein eigenerInterpret und schreibt durch diese seine Interpretation den Text fort. Letzlich gibt es also gar nichtd e n Text, sondern einen Aus-gangs-Text und seine Fortschreibungen. Das verweist auf die Theorie vom 'unendlichen Text'5.
Diesen Einsichten weiß sich die vorliegende Interpretation verpflichtet. Sie möchte sich nichtals eine weitere in die Phalanx der bestehenden, sich zum Kauf aufdrängenden Stan-dard-Interpretationen einreihen, die versprechen, eine schnell verwertbareAuskunft zu ge-ben und die doch nur den üblichen Einheitsbrei anbieten und sich dabei auch nicht vor bloßen Wiederholungen problematischer Aussagen anderer scheuen.
Es geht also im vorliegenden Fall nicht, das möchte ich ausdrücklich betonen, um das, wasvermeintlich "Interessierte" suchen, wenn sie etwas "in der Hand" haben wollen, was sie verwerten können. Wer ein echtes Inter-esse hat, bemüht sich, "dazwischen" zu sein, zwischen denBestandteilen des Primärtextes also, und er wird Eigenes hinzufügen. Das werde ich im folgendenVersuch auch tun und betone deshalb, dass er nur demjenigen ver-ständlich sein wird, der den Originaltext selbst gründlich gelesen und sich ein Bild von ihm gemacht hat. Wer dazu nicht bereit ist,der greife zur handelsüblichen, weitgehend identi-schen Massenware.
II. 1 Zur Begrifflichkeit
Auch Begriffe sind polyvalent durch das Wechselspiel ihrer Denotationen und Konno-tationen.Ihrer Funktion nach aber sind Begriffe Verständigungsmittel und sollten daher als Grundlage jedesKommunikations-Versuchs fest-gelegt werden. Wer also - wie ich es im
Folgenden tun werde -polyvalente Begriffe zum Zwecke des besseren Verständnisses fest- legt, tut das im Bewusstsein,damit eine eigene Fest-Legung zu treffen, die weder letzt- gültig der zu begreifenden Sache gerecht wird nochvon anderen Kommunikations-Teilneh-mern in gleicher Weise übernommen werden muss. Für dieDauer dieser Interpretation aber sollen sie (um eine Verständigungsbasis zu schaffen) gelten.
II, 2 Die Begriffe "Macht" und "Herrschaft"
Dementsprechend sind die text-leitenden Begriffe in ihrem Verständnis von landläufigen Auffassungen abzugrenzen. Letztere behaupten in der Regel, dass die Begriffe 'Macht' und 'Gewalt' in unmittelbarem Zusammenhang gesehen werden müssen, häufig in Bedeutungs-union mit 'Herrschaft'. Diese semantische Verbindung kennt auch die vorliegende Arbeit, wird aber - wie zu zeigen sein wird - von ihr abweichen, um zu detaillierteren Ergebnissen zu kommen, die der "beträchtlichen Tiefe und Spannweite der wort- und begriffsgeschicht-lichen Dimension"6 entsprechen.
Wir tun gut daran, diese Begriffe zunächst in einem allgemeinen, folgend aber in einem speziellen Verständnis für die Verwendung innerhalb dieses Textes zu erarbeiten. Nehmen wir also für den Begriff Macht zunächst eine sehr allgemeine Wortfassung. Bei Wikipediafinden wir unter "Macht" "die Fähigkeit einer Person oder Interessengruppe, auf das Verhal-ten undDenken von einzelnen Personen, Personenmehrheiten und sozialen Gruppen einzu-wirken". DieseHinsicht wird etwas konkreter in der Fassung von Max Weber, der "Macht" definiert als "jedeChance innerhalb einer sozialen Beziehung, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel, worauf diese Chance beruht".7 (Da wir von einem anderen Macht-Begriff ausgehen werden, verzichten wir an dieser Stelle auf eine ge-nauere Untersuchung dieser "Chancen" und der verschiedenen Arten, seinen Machtanspruch durchzusetzen. Erst wenn "Gewalt" ins Spiel kommt, müssen wir in der Untersuchung genauer sein.)
Um den "Macht"-Begriff für die vorliegende Arbeit fruchtbar zu machen, habe ich mich fürdie Begriffs-Variante entschieden, deren Anregung ich beim späten Foucault gefunden habe unddie hier jetzt referiert werden soll (ohne den Anspruch, Foucault in jeder Hinsicht gerecht werden zu wollen).Ausgehen möchte ich dabei von einer (sicherlich auch von Foucault beeinflussten) Formulierung des Wikipedia-Artikels : "Macht spielt praktisch in allen Formen menschlichen Zusammenlebenseine Rolle und bedingt auf unterschiedliche Weise das Entstehen von Sozialstrukturen mit ausdifferenzierten persönlichen, sozialen oder strukturellen Einflusspotentialen." (Die Rolle des Begriffs"praktisch" in dieser Formulie-rung wird mir weder in syntaktischer noch in semantischer Hinsichtklar. Ist er als eigen-ständiges Satzglied zu verstehen, kann es in semantischer Hinsicht nur als Gegen-Begriff zu "theoretisch" verstanden werden, wobei sich mir in diesem Fall der Sinn nichterschließt. Ist er attributiv gebraucht, so gibt es semantisch auch nicht viel her : es diente in diesemFall einer ungenauen Absicherung in dem Sinne, dass es "meist" der Fall sei. Da beide Verständ-nisarten für die die folgende Interpretation nichts hergeben, lasse ich den Begriff einfach außen vor.)
Der Machtbegriff, und damit arbeiten wir im Sinne Foucaults, spielt also "in allen For-men menschlichen Zusammenlebens eine Rolle" und bedingt das Entstehen von Sozial-strukturen; d.h.,das Sozialgefüge, in dem wir leben, ist das Ergebnis eines "Spiels"8, in dem die Beteiligten versuchen, wechselseitig aufeinander Einfluss zu nehmen. Dieses Spiel ist natürlich und als natürliches zu akzeptieren, und zwar ohne ethisch-moralische Stellung- nahme. Wir sind als Individuen mit einem Potential an Eigen-Sinn10 ausgezeichnet und tun recht (im Sinne des Natur-Rechts) daran,dieses auch in das gesellschaftliche Spiel einzu-bringen. Das ist oben mit "ausdifferenzierten persönlichen" Einflusspotentialen gemeint; hinzu kommen die "sozialen" als diejenigen, die sichim gesellschaftlichen Kontext verfes-tigt haben und als "Strukturen" wirkmächtig werden (oft genugin überlieferten Traditions-formen). Zeigen sie sich als verfestigt, kündigen sich in ihnen Formen der 'Herrschaft' an, die das natürliche Macht-Spiel nicht nur stören, sondern letztlich gar zer-stören.
In diesem gedanklichen Zusammenhang ist es wichtig zu betonen, dass die Teilnehmer an diesem Gesellschafts-Spiel (wenn es denn ungestört ablaufen soll), a) Subjekteund b) frei sind, welche zwei Behauptungen Resultate eines und desselben Gedankenganges sind.Als "Subjekt" (lat. subicere, hier in der Bedeutung 'zugrunde liegen') liege ich meinem eigenen Spiel zugrunde und kann es prinzipiell aus meiner Positionheraus angehen und den Umgang mit ihm bestimmen, und in diesem Bestimmen liegt meine Freiheit. Dass dies eine "Freiheit" innerhalb einer Situations-Gebundenheit ist, versteht sich von selbst. Hier kommen die "Strukturen" ins Spiel.
Zur besseren Illustration verweise ich auf ein längeres Foucault-Zitat : Was ich sagen will, ist, dass in den menschlichen Beziehungen, was sie auch immer sein mögen, ob es nun darum geht, sprachlich zu kommunizieren, wie wir dies gerade tun,oder ob es sich um Liebesbeziehungen, um institutionelle oder ökonomische Beziehungen handelt,die Macht stets präsent ist : Damit meine ich die Beziehungen, in denen der eine das Verhalten desanderen zu lenken versucht. Es sind also Beziehungen, die man auf unterschiedlichen Ebe-nen, inverschiedener Gestalt finden kann. Diese Machtbeziehungen sind mobile Beziehun-gen (Unterstreichung von mir, B.M.) , sie können sich verändern und sind nicht ein für alle Mal gegeben. Sie seien, soFoucault, mobil, reversibel und instabil. Man sollte außerdem beachten, dass es Machtbeziehungen nur in dem Maße geben kann, in demdie Subjekte frei sind. Wenn einer von beiden vollständig der Verfügung des anderen unterstündeund zu dessen Sache geworden wäre, ein Gegenstand, über den dieser schrankenlos und unbe-grente Gewalt ausüben könnte, dann gäbe es keine Machtbeziehungen. Damit eine Macht-beziehung bestehen kann, bedarf es also auf beiden Seiten einer bestimmten Form von Freiheit. 11
Der Terminus bestimmten zeigt an, dass es nicht um eine absolute, von allen Bedingun-gen losgelöste Freiheit geht, sondern um die jemeinige, die situations-gebunden ist an meine Persönlichkeitsstruktur und an die Struktur des gesellschaftlichen Kontextes, in dem ich lebe. Letztere gebendie Rahmenbedingungen an, innerhalb derer ich meine "Freiheit" einbringen kann (oder gegebenenfalls - durch vorhandene Herrschafts-Strukturen - daran gehindert werde).
Festzuhalten ist, dass "Macht" im Foucaultschen Verständnis kein Begriff im pejorativen Sinneist, sondern dass er zunächst einmal wertneutral den Bereich unserer Möglichkeiten meint und indieser Hinsicht positiv zu bewerten ist. Macht ist ein Ensemble aus Handlun-gen, die sich auf mögliches Handeln richtet, und operiert in einem Feld von Möglichkeiten für das Verhalten handelnderSubjekte. (...) Sie ist auf Handeln gerichtetes Handeln. 12 Für die "Gesellschaft" bedeutet das alsFazit : Eine Gesellschaft ohne Machtbeziehungen wäre nur eine Abstraktion. Sie ist weder herstellbar noch wünschenswert. Anzustreben dagegen ist ein Subjektstatus, der es uns erlaubt, unseremPotential gemäß zu handeln (solange wir die Spiel-Regeln nicht verletzen).
Aus dem Gesagten ergibt sich die Möglichkeit eines defizienten Modus, der dann be-steht, wennaus den Macht-Beziehungen "Herrschafts-Tatsachen" geworden sind, in denen die Machtbeziehungen, anstatt veränderlich zu sein und den verschiedenen Mitspielern eine Strategie zu ermöglichen, die sie verändert, vielmehr blockiert und erstarrtsind . Das zeigt sich im Großen in politischenHerrschaftsformen und im Kleinen in vielfältige (n) Unter-werfungen, die innerhalb des Gesellschaftskörpers stattfinden und funktionieren 13 .
Diese Blockierung kann nur zustande kommen durch einen Verzicht des Subjekts auf seine Freiheit. Dazu kann es kommen einmal durch Gewalt-Ausübung (über die Formen der Gewalt wird noch zu sprechen sein) oder durch freiwillige Unterwerfung des Subjekts unter einen Vertrag, wie ihn etwa der Leviathan bei Hobbes kennt. Beide Formen blockieren das um seine Verwirklichung bemühte Potential der Subjekte, so dasszur Wiederherstellung der Freiheit nur Widerstand möglich ist. Die Asymmetrie sollte aufgelöst werden zugunsten dessen, was man "symmetrische Kommunikation" nennt. Dies geschieht nach Foucault, in-dem man ein anderes Spiel, eine andere Partie oder mit anderen Trümpfen spielt 14 . Wichtig ist, dass man seinen Subjektstatus als Spieler nicht aufgibt.
II. 3 Der Begriff der "Gewalt"
Lassen wir, bevor wir den "Gewalt"-Begriff thematisieren, Foucault noch einmal zusam- menfassen : Mir scheint, dass man unterscheiden muss auf der einen Seite zwischen Macht- beziehungen als strategischen Spielen zwischen Freiheiten, also Spielen, in denen die einen das Verhalten der anderen zu bestimmen versuchen, worauf die anderen mit dem Versuch antworten, sich darin nicht bestimmen zu lassen, oder ihrerseits versuchen, das Verhalten der anderen zu bestimmen, und auf der anderen Seite Herrschaftszuständen, die das sind, was man üblicherweise Macht nennt. 15
In diesem argumentativen Zusammenhang wird auch die Rolle der Gewalt reflektiert : Machtbeziehungen schließen den Einsatz von Gewalt natürlich ebenso wenig aus wie die
Herstellung von Konsens. Die Ausübung von Macht kann auf keins von beidenverzichten, und manchmal benötigt sie beides zugleich. Doch Gewalt und Konsens sindMittel oder Wirkungen, nicht aber Prinzip oder Wesen der Machtausübung. 16 Um das zuverstehen, ist es sinnvoll, den überlieferten Gewalt-Begriff näher zu untersuchen.
Ein Blick in das von Joachim Ritter herausgegebene "Historische Wörterbuch der Philo- sophie" listet eine Reihe von Gewalt-Begriffen auf, die dank ihrer Gebundenheit an den jeweiligen Verfasser nur relative Geltung beanspruchen können. Für unseren Zusammen-hang nicht uninteressant sind die Hinweise auf Hannah Arendt : "Gewalt kann niemals legi-tim sein, aber sie kann unter Umständen gerechtfertigt sein. Rechtfertigungen müssen sich, da sie eine Erfüllung der Zweck-Mittel-Funktion sind, immer Argumenten aus der Zukunft bedienen, während Legitimationen traditional verfahren."17
'Gewalt' - schaut man auf das Wortfeld - ist einerseits (in seinem Gebrauch zunächst durchaus wertneutral) dem lat. "vis" = Kraft, Stärke verwandt(z.B. verwendet in der Formu-lierung "sich selbst in der Gewalt haben"), während 'Gewalt'als "violentia" in pejorativem Sinne gebraucht wird mit der Konnotation "jemanden verletzen" (gleich-gültig,ob in physi- scher oder psychischer Form).
In seinem Buch "Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung" aus den 70er-Jahren bietet der Friedensforscher Johan Galtung eine Definition an, die uns im Hinblick auf unser Vorhaben weiterhelfen kann : "Gewalt liegt dann vor, wenn Men-schen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle somatischeund geistige Verwirklichung ge-ringer ist als ihre potentielle Verwirklichung." Und er fügthinzu : "Mit anderen Worten, wenn das Potentielle größer ist als das Aktuelle und das Aktuelle vermeidbar, dann liegt Gewalt vor."18 Der Terminus "strukturelle Gewalt" verweist darauf, dass eine Gewaltaus- übung nicht nur von einzelnen Personen ausgehen kann, sondern auch von (gesellschaft- lichen) Strukturen (die natürlich ihrerseits wiederum von einzelnen Personen repräsentiert werden können). Galtung sagt, dass eine mögliche Aufhebung von Gewalt sowohl von ein-zelnen Personen (gegen gewalttätige Strukturen) wie auch von Strukturen (gegen gewalt-tätige Personen) ausgehen könne. Dabei sei weder die Frage, ob überhaupt Gewalt vorliege, noch die Frage, worin sie ihren Ursprung habe, immer ein-deutig zu beantworten, sondern bedürfe der Interpretation der Beteiligten. Das macht das Phänomen und seine Beurteilung vielschichtiger, wie uns ein Beispiel zeigen soll.
Nehmen wir einen uns allen aus eigener Erfahrung bekannten Vertreter struktureller Gewalt : den Lehrer. Er arbeitet im Auftrag der Gesellschaft daran, junge Menschen im Sinne einer "Vergrößerung des Potentiellen" (nach Galtung) zu erziehen; dieser Prozess beinhaltet aber ein "Ziehen", und das wiederum ist ein gewalt-tätiger Vorgang, dessen Be- urteilung interpretationsbedürftig ist. Gibt es für ihn eine Rechtfertigung, etwa im Ver- ständnis Hannah Arendts durch den Verweis einer funktionalen Ausrichtung auf einen Zweck inder Zukunft hin ? Die Gesellschaft, die den Erziehungsauftrag gestellt hat, wird diese Frage bejahen : einmal im Hinblick auf sie selbst und einmal im Hinblick auf den zu Erziehenden - beide profitieren in Sinne einer "Vergrößerung des Potentiellen". Aber ein- mal ganz abgesehen von der Frage, ob der Lehrer im Einzelfalle fachlich dazu überhaupt in der Lage ist - was ist, wenn der Schüler andere Vorstellungen hat und diese Ausrichtung des Lehrers nur negativ als 'gewalttätig' oder gar als Ver-gewalt-igung erfährt ? Es ist hiernicht der Ort, die in der Sache liegenden unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeitenweiter zu beleuchten. Wichtig erscheint mir aber (gerade auch im Hinblick auf den von unszu behandelnden Schiller-Text), die Reichweite der möglichen Chancen und Gefahren an-zudeuten und abzuschätzen, die in dieser Definition Galtungs von Gewalt enthaltensind.
Dass Galtung argumentativ nicht weit von Foucault - unsere Ausgangsfrage betreffend - entfernt ist, zeigen seine Bemerkungen zum Stichwort "Konflikt". Auf die Voraussetzung, dass eine "völlige Beseitigung aller Konflikte" gar nicht wünschenswert sei, setzt er : "Ich möchte hingegen für eine positive Auffassung von Konflikt sprechen : Konflikt als Heraus- forderung; Inkompabilität von Zielsetzungen als gewaltige intellektuelle und emotionale Herausforderung an die Konfliktparteien. Mit einer solchen Auffassung können Konflikte grundsätzlich als eine der stärksten Antriebskräfte unserer Existenz begriffen werden, als Ursache, Begleiterscheinung und Folge von Wandel, als ein Element, das für das gesell- schaftliche Leben ebenso notwendig ist wie für das menschliche Leben die Luft."19 (Un- terstreichung von mir) Und :"Ein Konflikt sollte zweiParteien keineswegs voneinander trennen, er sollte sie vielmehr einen, und dies gerade deshalb, weil sie eines gemeinsam haben, nämlich ihre Inkompabilität. (...) Da sie dieInkompabilität gemeinsam haben, sollten sie auch zusammen danach streben, die Lösung zu finden."20 Das setzt die von Foucault geforderte Freiheit des Subjekts für Machtspiele(die ja auch nichts anderes als positiv verstandene Konflikte darstellen) voraus.
Als Fazit der begrifflichen Einführung in unser Thema kann also festgehalten werden, dass wir - folgen wir Foucault und Galtung - allen Grund haben, unsere Macht als 'vis' zu- gunsten eines Diskurses ( = Konfliktes) einzusetzen, dessen Zielsetzung in der Forderung nach einerVerbesserung in der Zukunft liegt. Literarisch verarbeitet wird ein solcher Dis-kurs sehreindringlich im Drama mit seiner Spannung zwischen unterschiedlichenDenk- und Handlungsoptionen. Hier hat 'das Dramatische' sein eigenes - nur ihm eigenes - Betä-tigungsfeld. Wir haben nun zu untersuchen, welche Machtspiele und Konflikte Schiller in "Kabale und Liebe" für darstellenswert erachtetund welche Konsequenzen er seinem Zu-schauer vor Augen führt.
III. Schillers Intention
Wer einen Text schreibt, intendiert, am Lesen des Gesamt-Textes der Welt teilzuhaben.
Das lat. Wort "textum" meint "das Gewebe", und in ebensolcher Form stellen wir uns auch das Gesamt der Welt vor, ohne auch nur ansatzweise zu beanspruchen, es entziffern zu kön- nen. Expositorische (Sach-) Texte gehen das Problem an, indem sie (mit methodisch redu- ziertem Anspruch) auf der Basis ihrer lückenhaften Kenntnisse dennoch Informationen oder Handlungsanweisungen geben (aus utilitaristischer Orientierung heraus), während fiktionale Texte zur Auseinandersetzung auffordern, den Leser zum eigenständigen Nach-Denken be- wegen wollen. Wenn wir uns mit dem Dramatiker Schiller beschäftigen, so ist uns aufgege- ben, seiner individuellen Art der Aufforderung nachzufragen. Dazu sollen zunächst die Aus- gangsposition geklärt werden (der Ist-Zustand) und in der Folge dann die Zielvorstellung (der Soll-Zustand).
III.1 Der Ist-Zustand
Dieser kann im Rahmen einer solchen Arbeit nicht einmal annähernd beschrieben wer-den. Daher müssen wir uns zunächst mit der allgemeinen Kennzeichnung "aufgeklärter Ab- solutismus" zufriedengeben und die konkreten Hinweise in Schillers Umfeld suchen.
Herzog Karl Eugen von Württemberg als "aufgeklärter" Monarch ? Wer sich mit der Vita Schillers beschäftigt hat, wird bei dieser Bezeichnung Bauchschmerzen bekommen.
Aufgewachsen am Hof seines Onkels Friedrich II von Preußen, hat Karl Eugen zeitlebens versucht, an dessen Ausstrahlung heranzukommen. Bekanntlich hat er aus dieser Motiva- tion heraus die "Karlsschule" gegründet, jene Kadettenanstalt, für die auch der junge Schi-ler - gegen seinen Willen und den seiner Eltern - rekrutiert wurde und mit deren (wenig aufklärerischen) Verhältnissen er in seinem Schauspiel Die Räuber abgerechnet hat. Karl Eugen geht als der Landesvater in die Geschichte ein, der, um seine kostspielige Hofhal- tung in Ludwigsburg (und seine Mätresse Franziska von Hohenheim)zu finanzieren, seine Landeskinder als Soldaten nach Amerika verkauft hat (wo sie elendiglich zu Grunde gegangen sind), der den Schriftsteller Schubart auf den Hohenasperg eingekerkert und ihm das Rückgrat gebrochen hat und der versucht hat, Schillers literarische Laufbahn durch ein Schreibverbot zu unterbinden.
Bekanntlich hat Schiller sich diesem Schreibverbot durch eine Flucht aus Württemberg entzogen, woraufhin er als Deserteur gilt und sich mit der Todesstrafe bedroht fühlt. Schil- lers weiteres Leben ist - bevor er schließlich in Weimar und Jena zur Ruhe kommt - von einem Überlebenskampf geprägt - wegen eben der Befürchtung, vom Württemberger gejagt zu werden, wegen seiner Schulden, die die Druckkosten der im Selbstverlag erschienenen Räuber verursacht haben, wegen des immer wieder misslingenden Versuches, an Dalbergs Mannheimer Theater eine Art Nationaltheater aufbauen zu können, und schließlich wegen wiederholter lebensbedrohlicher Krankheiten. Auch wenn er durch Gönner in der Folgemehrere Hilfestellungen erfährt (zuletzt durch vier junge Verehrer in der Nähe von Dresden, zunächst durch Henriette von Wolzogen, die ihn eine zeitlang auf ihrem Gut in Bauerbach / Thüringen versteckt) - an ein ruhiges Arbeiten unter gesichertem Auskommen ist für Schil- ler nicht zu denken. Untersolchen Bedingungen entsteht ein Werk, daseinen so immensen Freiheitsdrang verkörpert, wie ihn die Literaturwissenschaftlerin KäteHamburger außer bei Schiller nur noch bei Sartre zu finden meint.21 Wie dieser Freiheitsdrang konkret aussieht und in welchen Überlegungen er sich verkörpert, wird in einem nächsten Schritt untersucht werden ("Soll-Zustand"), bevor Schillers literarische Umsetzung anhand seiner programma-tischen Schriften thematisiert werden soll.
III.2 Der Soll-Zustand
Unsere persönlichen Wünsche, Hoffnungen und Enttäuschungen hängen von unseren Wahr-Nehmungen ab, und unsere Wahr-Nehmungen wiederum hängen von unserer Ausein- andersetzung mit den Situationen ab, die uns begegnen. Schiller stammt aus einer 'bürgerli- chen' Famile (der Vater war im Krieg Wundarzt und versorgt in Friedenszeiten die Gärten des Herzogs, die Mutter ist die Tochterdes Wirts des "Goldenen Löwen" in Marbach / Neckar), und seine Erziehung geschieht in pietistischem Geist.22 Der Umzug der Familie nach Lorch bringt Schiller in den Unterricht des Pfarrers Moser, den er sehr verehrt (und dessen Person er in seinem ersten Stück, den Räubern, ein Denkmal setzt), mit der Folge, dass Schiller schon als Kind Predigen spielt und schließlich selbst Pfarrer werden möchte.
Dem macht der Herzog einen Strich durch die Rechnung, da er Schüler für seine neu ge- gründete Schule rekrutieren muss (und er findet sie am einfachsten in den Familien seiner unmittelbar Untergebenen). Schiller wird dort erst eine juristische und dann einemedizi- nische Ausbildung erhalten. Wenn wir ihnund seine Intention als Dramatiker in den 80er-Jahren verstehen wollen, müssen wir alle diese Aspekte und ihre Wechselwirkung aufein-anderin Betracht ziehen.23
In der Geschichte der Medizin gilt Schiller als Vorläufer einer "ganzheitlichen" Metho- de24. Dieser Begriff "ganzheitlich" impliziert eine Orientierung der Wissenschaftler am ganzen Menschen, und das heißt konkret : an der Wechselwirkung von Körper (soma) und Geist (psyché). (Dieses Thema zeigt sich konkret in Schillers dritter Dissertation Versuch über den Zusammenhang der thierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen (1780); die beiden Vorgänger waren von der Karlsschule abgelehnt worden, darunter der von uns weiter unten herangezogene Versuch Philosophie der Physiologie.)
Schiller folgt in seinem Verständnis von der Aufgabe der Medizin der 1777 formulierten Aufforderung von Hissmann, "der Philosoph müste Arzt, und der Arzt Philosoph seyn"25.
Es zeigt sich hier schon, dassdie medizinische Ausbildung Schillers - obgleich zunächst bei ihm unbeliebt - für die Ausbildung seiner philosophischen Gedanken nicht ohne Bedeutung ist. In besonderer Weise beeinflusst worden ist er durch die an der Karlsschule behandelten Ideen von Ernst Platner (1744 - 1818), vermittelt durch Schillers sehr eigenständigen Lehrer Jakob Friedrich Abel (1751 - 1829)26.
Man wird der Verbindung zwischen Medizin und Philosophie in deren Verständnis da-durch gerechter, dass man- der Diktion der Zeit folgend - von Anthropologie 27 spricht : "Unsere Einsichten haben viel dadurch erlangt, daß man den Menschen in zwey große Hälften zerschnitt, den körperlichenTeil dem Anatomiker und Physiologen überließ und den geistigen dem Philosophen zu seinem Antheile gab; allein man schien zulezt zu ver-gessen, daß beides Theile Eines Ganzen sind und folglich in der genausten Verbindung mit einander stehen müssen. (...) DiesesBand zwischen den beiden getrennten Theilen des Menschen wieder anzuknüpfen, war dieAbsicht einer Wissenschaft, die man Anthropolo- gie nennte."28
Die Trennung des Menschen "in zwey große Hälften" ist in einem philosophiegeschicht- lich außerordentlich bedeutsamen Schritt von Descartes vorgenommen worden, dessen Phi- losophie damit so etwas wie einen gedanklichen Sündenfall darstellt, der die Philosophie-geschichte in ein Davor und ein Danach einteilt und die Erkenntnistheorie der Neuzeit be- gründet. Descartes hat es gewagt, an den überkommenen (vor allem kirchlichen) Lehr-Meinungen jeglicher Art zuzweifeln (womit er sich sehr viele Feinde geschaffen hat), und er hat sich vorgenommen,nur das gelten zu lassen, was sich als unbe-zweifel-bar richtig er-weist. Der Weg des Zweifels lässt aber keine inhaltliche Fest-Stellung als unbezweifelbar richtig gelten (da die menschlichen Erkenntniswerkzeuge dazu nicht taugen) außer dem formalen Vorgang des Zweifelns selbst : Ich kann (berechtigterweise) an allem zweifeln, auch am Vorgang des Zweifelns selbst; wenn ich letzteren aber bezweifle, brauche ich dazu wiederum den formalen Vorgang des Zweifelns : "Ich zweifle (Vorgang), dass ich zweifle" (inhaltliche Setzung). Streiche ich, weil ich den Zweifel nicht widerlegen kann, die inhalt- liche Setzung, so bleibt der Vorgang übrig. Dieser Prozess ist unabschließbar; damit ist der Zweifel selbst die einziggerechtfertigte Basis neuzeitlichen Denkens.
Bei dieser Fest-Stellung ist Descartes allerdings (leider) nicht geblieben, sondern er hat zum einen gefolgert, dass es ein Etwas geben müsse, das zweifle (nämlich das Ich), und so kommt er zu den Grund-Satz : "Ich zweifle, also bin ich"; zum anderen hat er dieses Etwas zur Substanz erhoben, zu einer Sache (res cogitans), der er eine zweite Substanz, die mate- rielle, gegenübergestellt hat (die res extensa). Grundlegend für seine Welt-Anschauung sind also zwei "res" im Sinne von zwei Substanzen, die einander nicht nur ausschließen, sondern sich sogar feindlich gegenüberstehen. Ist das der Fall, sprechen wir von einem Dual-ismus,von einem Zwei-Prinzip, das nicht aufgehoben werden kann, es sei denn durch die Unterordnung des einen Prinzips unter das andere. Und genau das ist bei Descartes der Fall : Da nach seiner Auffassung die res cogitans bewiesen ist, die res extensa aber proble-matisch, steht erstereüber letzterer, steht der Geist über der Materie, der Mensch über der Natur etc. Es ist leichtzu erkennen, dass diese Überlegungen in der Folge viel Unheil an-gerichtet haben im Blickauf die Ökologie, auf den "Haushalt" (oikos) dessen, was ist.
In der Auseinandersetzung mit diesem Dual-Ismus sind Schiller und Partner, die, wie oben erwähnt, Vertreter einer "ganzheitlichen" Methode sind, gefordert : Wer ganzheit- lich denkt, kann zwar von zwei unterschiedenen Momenten (Körper und Geist) ausgehen und er darf sie hinsichtlich ihrer Funktionen auch trennen, aber sie müssen dennoch eine - wie immer geartete - Einheit (= Ganzheit) bilden. Mit diesem "wie immer geartet" wird Schiller vor ein Problem gestellt, das er späterhin, in den ästhetischen Schriften der 90er-Jahre, wenn er zum Dialektiker gereift ist, wird angehen können, das er jetzt aber eher wie einen gordischen Knoten (und das heißt : auf verblüffende, unkonventionelle Weise) löst.
Das müssen wir uns noch etwas genauer anschauen : Schiller muss einerseits den Dua- lismus ablehnen aus einem Freiheitsgefühl heraus, "welches allumfassend sein will und daher eineprinzipielle Entgegensetzung von Vernunft und Sinnlichkeit als schmerzliche Einschränkung der eigenen Tragweite empfinden muß"29.Zugleich kann er andererseits nicht auf dessen Gegenposition zurückgreifen, auf den Monismus (von gr. monos = einzig, allein, ein), in dem die ganze Welt aus einem einzigen Prinzip erklärt wird, denn eben diese ist vonzwei für ihn inakzeptablen Gegnern besetzt : zum einen vom Materialismus (der kei-nenGeist kennt und so für Schiller auf einen Immoralismus hinausläuft) und zum anderen von der Vorstellungvom reinen Geist, der sich in der Herrschaft Gottes manifestiert (wel-che Position wegen ihrer Nicht-Achtung der Körperlichkeit und Sinnlichkeit für Schiller einen bloßen Asketismus bedeutet). Er muss aus seiner Welt-Anschauung heraus beide ablehnen : "Einerseits möchte er der Moral gegen jeden Materialismus eine transzendenteGrundlage verschaffen, andererseits aber nicht einfach der Pfaffendogmatik verfallen."30
Schiller hält also zunächst einmal, um die beiden erwähnten Gegenpositionen abzuwei-sen, an der Substanzentrennung fest (wenn auch nicht im Sinne des Descartes) und betont den qualitativen Unterschied zwischen Körper und Geist; in eins damit spricht er beiden eine je andere Wirkungsabsicht zu.Als Idealist sieht er dabei gerade den Geist vor einer zentralen Aufgabe : Der Mensch ist bestimmt zur Überschauung, Forschung, Bewundrung des großen Plans der Natur 31. Gottgleichheit ist die Bestimmung des Menschen 32. Diese Setzung, in den medizinischen Schriften entwickelt, hatKonsequenzen auf Schillers hier thematisierte Vorstellungen vom Soll-Zustand und damit auch auf sein Vorhaben in seinen dramatischen Werken.
Mit dieser Setzung ist aber das Problem, wie qualitativ unterschiedliche Substanzen (Körper und Geist) aufeinander einwirken können, wie es zu dem für die ganzheitliche Medizin unverzichtbaren "commercium mentis et corporis"33, zu der Verbindung von Körper und Geist, kommen kann, nicht nur noch nicht gelöst, sondern dieses zeigt sich im Gegenteil drängender denn je. Um diesen Knoten zu lösen,setzt Schiller schließlich Mittel ein, die für ein wissenschaftliches Problem als überaus unkonventionell gelten : Er setzt einfach eine dritte Kraft ein, die er Mittelkraft nennt und deren Setzung er mit einer Erklä-rung versieht, die jeden konsequent denkenden Menschen in Erstaunen versetzt : Dem sei wie ihm wolle. (!) Es ist wirklich eine Kraft zwischen derMaterie (...) und dem Geiste vor-handen. Diese Kraft ist ganz verschieden von der Welt unddem Geist. Ich entferne sie : da-hin ist alle Wirkung der Welt auf ihn. Und dannoch ist der Geist noch da. Und dannoch ist der Gegenstand noch da. Ihr Verlust hat einen Riß zwischen Welt und Geist gemacht. Ihr Dasein lichtet, weckt, belebt alles um ihn - Ich nenne sie Mittelkraft. 34 Das Ausrufezeichen ist von mir gesetzt; betont werden soll, dass Schiller hier aufeine einfache Setzung zurück-greift. Diese ist zwar inhaltlich - wie die späteren Schriften des Autors zeigen - schiller-typisch, nur dass sie späterhin dialektisch abgesichert wird; dazu ist Schiller in diesem frü-hen Stadium noch nicht in der Lage. Er gibt das auch offenzu : Es mag nun diese Kraft ein von Materie und Geist verschiedenes Wesen sein, oder nicht (...) , dies ist mir izoganz gleich- gültig. (...) Auch gestehe ich gern, daß eine Mittelkraft undenkbar sein mag. (...)
Die Erfahrung beweist sie. Wie kann die Theorie sie verwerfen ? 35
Das ist eine mehr als gewagte Argumentation : Ich lasse den empirisch arbeitenden Me- diziner über den Philosophen siegen (es ist halt so, weil es so ist), ziehe aus dieser "Argu-mentation" aber zugleich Schlüsse mit weitreichenden Konsequenzen für die metaphysi-sche Seite meines Weltbildes : Geist und Materie sind Teile einer Einheit, aber mit unter-schiedlichen Aufgaben versehen; dabei ist der Geist nicht nur anders alsdie Materie - er ist sogar gott-gleich. Wir nehmen das erstaunt zur Kenntnis, verlassen das Feld der medi-zinischen Schriften undwenden uns den Philosophischen Briefen 36 zu, um die Auswirkun-gen dieser Denkweise auf den nicht-medizinischen Bereich in den Blick zu nehmen.
Diese Briefe (Erstdruck 1786 in Schillers Zeitschrift Thalia) weisen eine merkwürdige Struktur auf 37. Es ist in vom Ansatz her ein Briefroman : Ein junger Mann, Julius, schreibt an einen erfahreneren Freund, Raphael; dieser antwortet in einem Brief, bevor Julius wieder zu Wort kommt und u.a. seine früheren und jetzt angeblich überwundenen Ansichten in dersog. Theosophie darstellt. Die Philosophischen Briefe sind als fiktionaler Text zu verstehen; dieser ist als solcher polyvalent und bedarf der Interpretation. Wenn wir hier also einem In-terpretationsweg folgen, heißt das nicht, dass es nicht auch andere gebe.
Julius leidet an einer Krise seiner persönlichen Identität, die ihre Wurzeln in einer Krise seiner Weltanschauung hat. Raphael tritt als sein Freund und Berater und damit auchals Arzt auf38: Du hast eine Krankheit zu überstehen, von der du nur allein durch dichselbst vollkommen genesen kannst, um vor jedem Rückfall sicher zu sein. Je verlaßner dudich fühlst, desto mehr wirst du alle Heilkräfte in dir selbst aufbieten, je weniger augenblickliche Linderung du von täuschenden Palliativen empfängst, desto sicherer wird es dir gelingen, das Übel aus dem Grunde zu heben. 41 Hier spricht aus Raphael der Arzt Schiller (wie wir ausder Kenntnis seiner medizinischen Vorgehensweise wissen), aberzugleich spricht Schiller auch aus Julius (wie wir aus anderen seiner Texte dieser Zeit ablesen können). Er teiltsich hier in diese beiden Personen auf, und somit ist der Dialog der Briefe ein Dialog desAutors mit sich selbst.
Was aber ist nun der Gehalt dieser Briefe ? Diese Frage ist für uns von Bedeutung, wenn wir die Rolle Ferdinands im Schauspiel Kabale und Liebe verstehen wollen. Denn dass Ferdinand Schillers Grund-Gedanken vertritt, wird bei einem Vergleich offensichtlich.
Um den Gehalt der Briefe aus der eigenartigen gedanklichen Anordnung herauszudestillie-ren, müssen wir die Chronologie des Textes aufbrechen und drei Stadien unterscheiden : Das erste Stadium wird durch die Theosophie des Julius repräsentiert (das ist ein Text-Zeugnis der Gedanken des Julius vor Raphaels Einfluss auf ihn; in der Chronologie der Philosophischen Briefe werden sie erst zu einem späteren Zeitpunkt wiedergegeben); das zweite Stadium besteht in Julius'eigenen Zweifeln an dieser Gedankenkonstruktion, bevor in einem dritten Schritt (mit Hilfe des 'Arztes' Raphael) eine Perspektive als Lösungsansatz entwickelt werden kann (mehr nicht, denn dann bricht der Text ab und wird von Schiller in der Folgezeit auch nicht mehr aufgenommen).
Stufe 1 : Die Theosophie des Julius. Sie beginnt mit der Darstellung des Zusammenhangs von Gott und Welt, wie sie der junge Julius aufgeschrieben hat(dass sich hier Gedanken des Pietisten Oetinger spiegeln, sei wenigstens erwähnt): Der Mensch ist prinzipiell in der Lage (und hier greift Schiller entsprechende Überlegungen aus den o.a. medizinischen Schriften auf), durch seine Wahr-Nehmung der in der Welt auffindbaren Verweise auf Vollkommen-heit zu einem Spiegelder Natur und damit Gottes zu werden. Als Spiegel ist er gott-ähnlich, und über diesen Gedanken ist die Idee der Unsterblichkeit nicht weit, wie sie schon Schillers Lehrer Abel entwickelt hat : "...daß mein Ich nicht nur ins Unendliche fortdauern werde, sondern auch in's Unendliche an Sittlichkeit und entsprechender Glückseligkeit, und folglich überhaupt an geistiger Kraft und Wirksamkeit fortzuschreiten bestimmt sey. Nur dieses alles zusammen erschöpft die Idee der Unsterblichkeit."39 In der Theosophie klingt das wie folgt : Alle Geister werden angezogen von Vollkommenheit. Alle - es gibt hier Verirrungen, aberkeine einzige Ausnahme - streben nach dem Zustand der höchsten freien Äußerung ihrerKräfte, alle besitzen den gemeinschaftlichen Trieb, ihre Tätigkeit auszudehnen, alles an sich zu ziehen, in sich zu versammeln, sich eigen zu machen, was sie als gut, als vortrefflich, als reizend erkennen. (...) Alle Vollkommenheiten im Universum sind vereinigt inGott. (...) Die Anziehung der Elemente brachte die körperliche Form der Natur zu Stande. Die Anziehung der Geister in's Unendliche vervielfältigt und fortgesetzt, müßte endlichzur Aufhebung je- ner Trennung (der Natur als eines geteilt erscheinendes Gottes) führen, oder (darf ich es aussprechen, Raphael ?) Gott hervorbringen. Eine solche Anziehung ist die Liebe (Unter-streichung von mir; B.M.) . Also, Liebe, mein Raphael, istdie Leiter, worauf wir emporklim-men zu Gottähnlichkeit. (...) Liebe also - das schönstePhänomen in der beseelten Schöp-fung, der allmächtige Magnet in der Geisterwelt, dieQuelle der Andacht und der erhabens-ten Tugend - Liebe ist nur der Widerschein diesereinzigen Urkraft, eine Anziehung des Vor-trefflichen, gegründet auf einen augenblicklichen Tausch der Persönlichkeit, eine Verwechs-lung der Wesen. 40 ("Verwechslung" meint hier eine"Wechselwirkung".) Ferdinand, derStellvertreter Schillers in Kabale und Liebe, lässt grüßen; in diesen Gedanken liegt seine Liebes-Religion begründet, mit der er Luise umwirbt.
Stufe 2 : Die Zweifel des Julius. Julius gibt Raphael die Schuld, die Zweifel an diesen idealen Vorstellungen gesät zu haben : Was hast du aus mir gemacht, Raphael ? (...) Ich empfand und war glücklich. Raphael hat mich denken gelehrt, und ich bin auf dem Wege, meine Erschaffung zu beweisen. (Die Betonung liegt hier auf dem 'denken', das keinen Glauben zulässt, ohne Beweise hervorgebracht zu haben)(...) Du hast mirden Glauben gestohlen, der mir Frieden gab. Unterstützt werden die Zweifel durch eben jene materia-listische Gegenposition zu Schiller, die wir schonals von ihm abgelehnte aus seinen medi-zinischen Schriften kennen : Mein Herz suchte sich eine Philosophie, und die Phantasie unterschob ihre Träume. Die wärmste war mir die Wahre (...) Ein kühner Angriff des Mate- rialismus stürzt meine Schöpfung ein. 41
Die Bedenken, die Schiller in seiner ersten medizinischen Dissertation von 1779 noch durch eine bloße Setzung zum Schweigen bringen konnte (s.o.), melden sich nun, offen- sichtlich durch Raphael Einfluss, verstärkt zu Wort und lassen sich nicht so leicht zum Schweigen bringen. Eine Setzung ist eben nur eine Setzung und hat keinerlei erkenntnis-theoretische Relevanz.
Stufe 3 : Die Aufhebung des Zweifels.Raphael, der väterliche Freund und Arzt, ver- weist Julius auf die pädagogische Absicht, die er mit seiner Einwirkung auf Julius verfolgt :
Daß ich aus deinem süßen Traume dich geweckt habe, reut mich noch nicht, wenn gleichdein jetziger Zustand peinlich ist. (peinlich meint hier : schmerzhaft) Um Julius vor denEinflüssen verderblicher Ansichten zu schützen, blieb mir nichts anders übrig, als dieseunvermeidliche Seuche durch Einimpfungunschädlich zu machen. (...)
Du warst gut ausInstinkt, aus unentweihter sittlicher Grazie. Ich hatte nichts zu fürchten für deine Moralität, wenn ein Gebäude einstürzte auf welchem sie nicht gegründet war. (...) Die Stufe,worauf du standest, war deiner nicht wert.Der Weg, auf dem du emporklimm- test, bot dirErsatz für alles, was ich dir raubte.
Der erfahrene Pädagoge Raphael weiß um die Not-Wendigkeit, das, was uns der bloße Instinkt eingibt (und was uns damit auf der Stufe der unbedarften Naivität verharren lässt), dadurch zu einer reflektierten Einsicht zu bringen, dass wir an das zunächst naiv Geglaubte mit den Mitteln der Kritik herangehen, um es widerstandsfähiger zu machen. Über den Drei-schritt von unbewusster Naivität, unnachgiebiger Kritik an dieser naiven Einstellung und - als Ergebnis - bewusster Einsicht schreitet unser Bewusstsein voran.
Wenn Julius - im Anschluss an die Darstellung seiner Theosophie - mit den Worten fortfährt : Hier, mein Raphael, hast Du das Glaubensbekenntnis meiner Vernunft, dürfen wir diese Aussagen als eine Art Fazit betrachten, in dem er - durch die Kritik geläutert - wieder zu seinen Grund-Ansichten zurückfindet. Und er bestätigt sie auf eine ähnliche Weise, wie er schon in den medizinischen Schriften den gordischen Knoten gelöst hatte : Übrigens könnte meine Darstellung durchaus verfehlt, durchaus unecht sein - noch mehr, ich bin überzeugt, daß sie es notwendig sein muß, und dennoch ist es möglich, daß alle Resultate daraus eintreffen.
Ob Schiller mit dieser Argumentation selbst zufrieden sein konnte ? Wir dürfen daran zweifeln, denn er hat die Philosophischen Briefe weder beendet noch die Arbeit daran weiter verfolgt. Auch als Jahre später sein Freund Körner noch einmal in die Rolle des Raphael schlüpft und den Gedankenkreis wieder aufnehmen will, geht Schiller nicht da- rauf ein. Körner, der zu dem Zeitpunkt bereits ein gewiefter Kantianer ist (und dem in den Folgejahren das Verdienst zukommen wird, Schiller auf Kant aufmerksam zu ma- chen), wird mit diesen bloßen Setzungen (sowohl in den medizinischen Schriften wie in den Philosophischen Briefen) nicht einverstanden gewesen sein; Schiller merkt das, und er bemerkt auch die Zweideutigkeit in Körners 'Lob' über ihn : "Das unedelste Metall wird zu Gold durch eine Art von Alchemie der Begeisterung,"42 (!)
Dieses philosophische Begründungsproblem ist aber nicht so gewichtig, dass es Schil- lers "Alchemie der Begeisterung" hier schon veränderte : Es ist Schillers gedankliche Position zu dieser Zeit, und Ferdinand wird ihr Sprachrohr sein. Vervollkommnung und Liebe sind in diesen Jahren die Grundpfeiler des Schillerschen Denkraumes, und dass nur sie die hehre Aufgabe leisten können, die in der Schöpfung mannigfaltig und ver- streut auftretenden Fragmente göttlicher Provenienz zu einem Ganzen zu fügen (wie es die Aufgabe nur des geistbegabten Menschen sein kann - und muss), zeigtein Brief aus der Zeit seines Bauerbacher Exiles an seinen dortigen Gesprächspartner (und späteren Schwager), den Bibliothekar Reinwald aus Meiningen : Gleichwie keine Vollkommenheit einzeln existieren kann, sondern nur diesen Namen in einer gewisen Relation auf einen allgemeinen Zwek verdient, so kann keine denkende Seelesich in sich selbst zurückziehen und mit sich begnügen. Ein ewiges nothwendiges Bestreben, zu diesem Winkel den Bogen zu finden, den Bogen in einen Zirkel auszuführen, hiesse nichtsanders, als die zerstreute Zügel der Schönheit, die Glieder der Vollkomenheit in einen ganzen Leib aufzusammeln - das heißt mit andern Worten : Der ewige innere Hang, in dasNebengeschöpf überzugehen, oder daßselbe in sich hineinzuschlingen, es anzureissen, istLiebe. 43 In seinem Bauerbacher Refugium hat Schiller die Arbeit an Kabale und Liebe beendet.
Damit sind wir beim Thema der Liebesreligion, das diesem Drama zugrundeliegt, und bei Ferdinand und Luise angelangt. Dass Schiller seine eigenen Anschauungen auf die Per-sonen seiner Dramen überträgt, bestätigt er im selben Brief : Jede Dichtung ist nichts an-deres, als eine enthousiastische Freundschaft oder platonische Liebe zu einem Geschöpf unseres Kopfes. 44
IV. Schillers Methode
In der Folge der Frage nach der inhaltlichen Seite des Schillerschen Werkes ist dienach der formalen zu stellen : W i e setzt Schiller seine Gedanken ins Werk ? Welchen Weg wählt er, und da der Begriff "Weg" auf den griechischen Terminus 'methodos' verweist, wird hier also nach Schillers 'Methode' gefragt.
Die Box, in die Schiller in der Regel gesteckt wird, ist die des 'Idealismus'. Dass eine solche Box durchaus Sinn machen kann, hat Rüdiger Safranskis ausgezeichnete Darstellung "Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus"45 gezeigt. Was aber ist mitdieser Schublade 'Idealismus' gemeint ? Als -Ismus beansprucht sie grundsätzliche Geltung, und das, was grundsätzlich gelten soll, ist der Primat des Geistes. Die Spielarten reichen von der extremen Position, dass alles Geist sei (als Gegenposition zum strengen Materialismus), bis hin zu der weicheren Auffassung, dass beide, Geist und Materie, existierten, dem Geist aber der Vorrang zugesprochen werde. Schiller - das haben wir unter III. gesehen - ist ein Ver-treter dieser weicheren Auffassung, wenn er den Bedeutungsvorrang des Geistigen auch nachdrücklich betont : daß wir unseren physischen Zustand, der durch die Natur bestimmt werden kann, gar nicht zu unserem Selbst rechnen, sondern als etwas Auswärtiges und Fremdes betrachten, was auf unsere moralische Person keinenEinfluss hat. 46 Und : Es ist der Geist, der sich den Körper baut. 47 Es ist Friedrich Nietzsches eigenwilliger Diktion vorbehalten gewesen, Schiller als "Moral-Trompeter von Säckingen" zu diskreditieren48. Die Bedeutung, die 'Vernunft' und 'Moral' für Schiller haben, wird auch in dieser abfälligen Bemerkung richtig erkannt. Wir erinnern uns, dass Schiller (um seinem Vorbild, dem Pfarrer Moser, zu folgen) selbst Pfar- rer hatte werden wollen; seine Vorliebe, anderen zu predigen, wird sich nun in sublimierter Form in seiner Theaterarbeit zeigen.
Schiller hat Kabale und Liebe als bürgerliches Trauerspiel bezeichnet. Das ist ein zu dieser Zeit in Mode gekommenes Genre. Zunächst einmal bedeutet es, dass nunmehr neben dem Adel auch der einfache Bürger als Sujet auf der Bühne erscheinen kann und damit auch als tragödienfähig angesehen wird. Wer nun aber in diese Schublade "bürgerlich" zu stecken ist, darüber gehen die Meinungen ebenso auseinander wie die genaue soziologische Zuord- nung. So wird z.B. - und dieser Ansicht möchte ich folgen - grob zwischen zwei Gruppen unterschieden, deren eine von den Vertretern des überkommenen ständischen Systems ge-bildet wird, deren Zuordnung seit der Urbanisierung im Spätmittelalter / in der frühen Neuzeit auf ökonomischer Basis erfolgt : Die Spannereicht vom handwerklichen Klein-bürgertum über den kaufmännischen Mittelstand bis ins Patriziat der Städte. Dieser traditi-tionell ausgerichteten, konservativ eingestellten Gruppierung stehen die Vertreter eines neuen liberalen Bürgertums gegenüber, deren ökonomische Prosperität eine neue ideolo-gische Fundierung braucht, die sich über den literarischen Markt vermittelt.49 Von hier aus lässt sich der (vorübergehende) Erfolg desbürgerlichen Trauerspiels erklären, das sich mit Fragen bürgerlicher Lebensführung und bürgerlicher Kommunikationsformen auseinander-setzt.
Konkret heißt das, dass nun nicht mehr nur allgemeine Fragen der höfischen Lebens-führung und der Staatsräson auf die Bühne gebracht werden, sondern Fragen, die das Herz-stück bürgerlicher Zuordnung betreffen : die Familie. Da diese in der Folge ökonomischer Verschiebungen ebenfalls eine - schrittweise - Veränderung erfährt (von der Großfamilie zur Kleinfamilie), geht es jetzt auf der Bühne um Moralvorstellungen, diedieses Feld be-treffen : das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern allgemein und die Frage der Gatten-wahl konkret, denn im Zuge liberaler Autonomie-Bestrebungen tritt verstärkt die Frage auf, ob die jungen, heiratsfähigen Frauen selbst über die Wahl ihres Zukünftigen entscheiden dürfen oder nicht, und es versteht sich von selbst, dass jetzt Themen wie 'Zuneigung' oder 'Liebe' zunehmend eine Rolle spielen. Das geht nicht ohne Probleme ab : "Die Gattenwahl wird der jungen Frau als freier Akt eigener Entscheidung zugebilligt, aber ihre Autonomie wird zugleich dadurch eingeschränkt, dassihre Wahl den Prinzipien von Tugend und Ver-nunft folgen müsse."50 Was aber unter "Tugend" bzw. "Vernunft" zu verstehen sei, darüber gehen die Meinungen auseinander (was zu den dramatischen Konflikten führt), wie ein Text von Schillers Lehrer Abel("Beitrag zur Geschichte der Liebe", 177851 ) zeigt, dessen Plot Schiller aufgenommen und verarbeitet hat, wie unten noch zu analysieren sein wird.
In diesem thematischen Rahmen werden sich die Machtspiele der handelnden Personen des Schillerschen Dramas abspielen, und sie werden sich auch beeinflusst zeigen von den sie behindernden Herrschaftsformen, die das soziale / politische Gefüge vorgibt. In dieser Hinsicht "politisiert" Schiller "das bürgerliche Trauerspiel ganz radikal, bringtes, wie man treffend gesagt hat, 'in Angriffsstellung' : Das Liebesdrama wird zum Politikum."52 Der
Zuschauer kann diesen Prozess von der intendierten Selbstbestimung zur faktischen Fremd- bestimmung53, der sich als Widerspruch in den auf der Bühne handelnden Personen abspielt, studieren.
Dieses Studium dem Zuschauer zu ermöglichen, ist Schillers eigentliche Intention in seiner Theaterarbeit, wie er in seinen programmatischen Schriften ausführt : Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken ? (1784) (späterhin unter dem Titel : Die Schaubühne als eine moralische Anstalt betrachtet) und Erinnerung an dasPublikum (Handzettel zur Aufführung des 'Fiesko'). Lassen wir Schiller zu Wort kommen : Je erhab-ner das Ziel, nach welchem wir streben, je weiter je mehr umfassend der Kreis, worin wir uns üben, desto höher steigt unser Mut, desto reiner wird unser Selbstvertrauen, desto un-abhängiger von der Meinung der Welt. Dann nur, wenn wir bei unsselbst erst entschieden haben, was wir sind, und was wir nicht sind, nur dann sind wirder Gefahr entgangen, von fremdem Urteil zu leiden - durch Bewunderung aufgeblasen,oder durch Geringschätzung feig zu werden. 54
Das Studieren zeigt sich also in einem Üben, in einem Ein-Üben jener Verhaltens- weisen, die - nach Ansicht des Autors - dem autonomen Geist-Wesen Mensch gerecht werden, das über eine von der Vernunft gesteuerte Moral verfügt. (Seine Brust gibt jetzt nur Einer Empfindung Raum - es ist diese : ein Mensch zu sein. 55 Damit nimmt das Theater für den "heilungsbedürftigen Patienten" eine "therapeutische Funktion" wahr.56 Da die Therapiesich aber nicht nur auf die Seele erstreckt, sondern auch dazu beitragen soll, die Realität zu meistern, hat das Theater eine sozial- wie psychotherapeutische Doppelfunk- tion. In beiderlei Hinsicht fungiert der Autor Schiller auch als Arzt (s.o.).
Lassen wir ihn selbst noch einmal zu Wort kommen : Die Schaubühne ist mehr als jede jede andere öffentliche Anstalt des Staates eine Schule der praktischen Weisheit, ein Weg-weiser durch das bürgerliche Leben, ein unfehlbarer Schlüssel zu den geheimsten Zugängen der menschlichen Seele. Was können wir studieren ? - nun, die anderen Menschen mit ihren Lastern, die uns prototypisch auf der Bühne vorgestellt werden : Mit diesen Lasterhaften, diesen Toren müssen wir leben. Wir müssen ihnen ausweichen oder begegnen; wir müssen sie untergraben, oder ihnen unterliegen. Jetzt aber überraschen sie uns nicht mehr. Wir sind auf ihre Anschläge vorbereitet. Die Schaubühne hat uns das Geheimnis verraten, sie ausfin-dig und unschädlich zu machen. 57
Schiller sieht sich als Arzt und Therapeut. Das beinhaltet, dass er mit dem Zuschauer eine komplementäre Kommunikation führt : er führt, denn er ist der Kundige. Das betont Schiller selbst : Heilig und feierlich war immer der stille der große Augenblickin dem Schauspielhaus, wo die Herzen so vieler Hunderte, wie auf den allmächtigen Schlag einer magischen Rute, nach der Fantasie eines Dichters beben - (...) wo ich desZuschauers Seele am Zügel führe, und nach meinem Gefallen, einem Ball gleich demHimmel oder der Hölle zuwerfen kann. 58
Rute und am Zügel führen - das sind starke Worte aus dem Mund eines Schriftstellers in einer Zeit, die sich die Mündigkeit auf die Fahnen geschrieben hat. "Selber denken" ist die Aufforderung, die Kant in seinem Aufklärungs-Aufsatz den Zeitgenossen mitgegeben hat. Komplementäre Kommunikation kann gelingen, solange sie sich nicht verfestigt und damit pathogene Züge erhält. Das sollten wir auch den Protagonisten unseres Dramas ins Stamm-Buch schreiben - es ist Zeit, sich ihnen zuzuwenden.
V. Interpretation Schiller, Kabale und Liebe
Unser zur Interpretation anstehendes Drama wird geprägt durch Machtspiele, Strukturen der Herrschaft und Strukturender Gewalt.59 (Diese Begriffe sind oben unter II. in ihrem für unseren Zusammenhang relevanten Verständnis erläutert worden.) Sie zeigen sich im Wech-selspiel der Sprechhandlungen der beteiligten Personen - wie und in welcher Form, das herauszufinden wird unsere Aufgabe sein.
Zu diesem Zweck ist der Begriff "Sprechhandlung" zunächst einmal zu erläutern. Auch das Sprechen wird also als eine Handlung verstanden (das ist eine Festsetzung mit weitrei-chenden Konsequenzen für ein Drama, das aus Sprache, aus Rede und Gegenrede, besteht). Eine sprachliche Handlung ist dabei nicht einfach nur als ein Ausdruck von Gedanken zu verstehen, sondern sie erweist sich durchaus als eine"konkrete Handlung,mit der etwas be-wirkt wird"60 Zu Akten der Gewalt werden solche Sprechhandlungen, "wennWorte bedrän-gen, erschlagen, zum Sprechen, Schweigen, (Nicht-) Handeln zwingen."61 Kabale und Liebe weist eine Fülle solcher Gewaltakte auf.
"Sprachliche Gewalt kulminiert in diskursiver."62 Verstehen wir unter einem "Diskurs"eine gemeinschaftliche Form der verbalen Auseinandersetzung, so hat diese auch Auswir-kungen auf den gesellschaftlichen Umgang miteinander. Judith Butler verweist in ihrem Buch "Haß spricht. Zur Politik des Performativen"63 darauf, dass das Subjekt sich überdie Sprache konstituiert. Was heißt das ? "Performieren" meint "durchführen" - aufdie Sprache bezogen, heißt das, dass die Kompetenz die allgemeine Sprachfähigkeit betrifft, die Perfor-manz aber den tatsächlichen Sprachgebrauch. Wie dieser durchgeführtwird, hat also Ein- fluss auf die Herausbildung des Subjekts. Das betrifft zunächst einmal die Art und Weise, wie dieses Subjekt behandelt wird : Wird es überhaupt als Subjekt anerkannt, das seinen eigenen Wahrnehmungen zugrunde liegt (lat. subicere), oder versucht man es zum Objekt (lat. obicere) zu degradieren, zum Gegen-Stand, indem man es ver-ding-licht ?64
Über diese Behandlung werden gerade auch Normen der Gesellschaft transportiert. Was will diese Gesellschaft von mir als Subjekt ? Will sie in mir ein spontanes, selbsttätigesIn-dividuum sehen, das über seine Performanz aktiv Einfluss zu nehmen versucht auf diekol- lektive Weiterentwicklung der Gesellschaft, oder will sie mich im Sinne vorgegebener Nor-men prägen und so konditionieren ? Über Sprache wird also auch zu prägen versucht; es kommt auf die Rezeption durch den Einzelnen an, wie stark diese Prägung letztendlich ist. Ich kann mir passiv etwas sagen lassen und es internalisieren, also aufnehmen und verinner-lichen, oder ich kann mich mit dem, was mir gesagt wird, aktiv auseinandersetzen und mei-ne eigenen Konsequenzen - in eigener Verantwortung - daraus ziehen. Ulrike Koch verweist in ihrer Arbeit auf den negativen Aspekt, dass"Sprache immer schon von Ausschlüssen, Abgrenzungen und Verknappungen geprägt"65 war, und sie folgert : "Demnach gäbe es auch kein Sprechen, das nicht gewaltsam wäre."66 Dieser Folgerung wird die vorliegende Arbeit sich nicht anschließen. Sie wird nach Wegen einer alternativen Sprach-Performanzsuchen.
Bei dieser Suche soll uns die Auslegung des Schiller-Textes behilflich sein. Schließlich beansprucht Schiller, als Autor zugleich Therapeut und Arzt zu sein und für die (mentale) Gesundheit des Rezipienten Sorge tragen zu wollen. Wir werden uns die Sprechhandlungen der Protagonisten anschauen und sie daraufhin befragen, ob hier freie Machtspieleoder blockierende Herrschaftsstrukturen vorliegen und ob Gewalt ausgeübt wird, undwir werden uns zu fragen haben, was der Autor mit der Darstellung dieser Beispiele wohl beabsichtigt. Schließlich ist der Arzt / Autor die zwecksetzende Instanz und er hat immerhin die Freiheit, sich seine Personen und ihre Konstellation selbst auszusuchen.
Eine andere Frage ist, ob ein Autor die Entwicklung dieser seiner Protagonisten von vornherein (vom Anfang des Dramas bis zu seinem Ende) festlegt oder ob er nicht selbst als Autor im Prozess des Schreibens erst erfährt, wohin die Personen sich entwickeln. Schiller gehört, so unsere These, zu den letzteren Autoren : "Wenn Schiller seine Figuren nicht auf Schienen setzt, die geradeaus laufen, sondern sie ihre eigenen Wege gehen läßt, so deshalb, weil er nicht ihr Vormund und Dirigent, sondern ihr Beobachter ist. (...) Poetisches Schrei-ben wird in der Moderne zunehmend eine Fahrt ins Unbekannte, ein Prozeß der Erkundung, und wirkt daher experimentell."67 Konkret heißt das : Schiller nimmt die Ideen seiner Welt-anschauung68 und die Ideen anderer, besetzt sie mit Rollen und lässt die Rolleninhaber selbst ihre wechselseitigen Erfahrungen mit ihnen machen.
"Damit werden die Figuren zu Textproduzenten (...), die MitspielerInnen des Trauer- spiels werden zu Autoren und Autorinnen, die eine Liebesgeschichte, ein Familienrühr- stück, eine Märtyrertragödie, ein Intrigendrama anstreben. Mit Gewalt wollen sie ihre dra-matischen Konzepte durchsetzen, wobei bestimmte Texte mit bestimmten Formensprach-licher und diskursiver Gewalt korrelieren."69 (Wir erinnern uns an Foucaults Diktum,dass das Durchsetzen-Wollen zu den natürlichen Machtspielen des Menschen gehört, die nach seiner und Galtungs Ansicht durchaus produktiven Charakter habenkönnen im Sinne einer lebendigen Interaktion. Da das vorliegende Drama in einerKatastrophe endet, werden wir uns zu fragen haben, was bei dieser Konstellation falsch gelaufen ist.)
Festzuhalten ist : " Schillers Figuren erstreben, wie sich zeigen wird, selbst dramatische Autorschaft, Regie und Rollenverteilung."70 In Kabale und Liebe sind es im wesentlichen 6 Personen, die diese Autorschaft beanspruchen; sie werden wir in den folgenden Schritten zu beobachten und in ihrem Sprechhandeln zu analysieren haben :Ferdinand und Luise (V.1),
Miller (V.2), Wurm und der Präsident (V.3) und Lady Milford (V.4).
V.1 Ferdinand von Walter, Luise Miller
Interpretationen stehen mehrere Wege (Methoden des Vorgehens) offen. Es ist oben herausgearbeitet worden, dass der Dramatiker Schiller sich als Therapeut und Arzt versteht; also liegt es nahe, dem produktionsästhetischen Ansatz zu folgen und zu fragen, wie der Therapeut seinen Patienten (hier : den Zuschauer) zu behandeln versucht. Auf der anderen Seite macht es Sinn, über den rezeptionsästhetischen Ansatz die Frage zuverfolgen, wie der Zuschauer die Entwicklung auf der Bühne wahr-nimmt. Es leuchtet ein, dass erst das Wech-selspiel beider Ansätzeeinen oberflächlichen Zugriff und eineindimensionales Auslegen (was einem Widerspruch in sich gleichkommt) verhindert. DasProblem des rezeptions-ästhetischen Ansatzes, dass wir nicht die zeitgenössischen Zuschauer sind, sollte mit reflek-tiert werden.
Ein Drama hat einen Spannungsbogen, der sich von der Problem-Stellung bis zur Pro- blem-'Lösung' erstreckt. Insofern ist es klar, dass Schiller zu Beginn seines Dramas das zur Untersuchung anstehende Problem exponieren und die Protagonisten vorstellen muss. Wir als Zuschauer sehen Luise (nach der das Schauspiel ursprünglich benannt werden sollte) erstmalig in der 3. Szene des 1. Aktes und Ferdinand in der 4. Wenn derAutor uns zunächst den Raum vorstellt, in dem Luise 'zu Hause' ist, unterstreicht er dessen Bedeutung für die gesamte Handlung : Es ist das kleinbürgerliche Milieu des Musikus Miller. "Kleinbürger-lich" ist hier weniger als ökonomische Kategorie zu verstehen (der Musikus Miller ist von seinem sozialen Status her ein geachteter Mann), sondern als eine moralische, die sich in der typischen 'Kleinbürgermoral' zeigt, derenEnge sprichwörtlich ist und späterhin in die Nähe der Einstellung eines Spießers gerückt wird.Wir werden unter V.2, wenn wir uns Miller als Vertreter dieser Einstellung näher anschauen, darauf zu sprechen kommen.
Das Zimmer beim Musikus zeigt sich als geschlossener Raum, der Geborgenheit zu ver- sprechen scheint. Diesen Raum betritt eine Luise, die spürbar ver-unsicher-t ist; der auf- merksame Zuschauer wird schon an ihren ersten Statements ablesen können, dass die heimi-sche Geborgenheit für Luise Risse bekommen hat. Nach der Begrüßung des Vaters stellt sie unvermittelt fest : O ich bin eine schwere Sünderin, Vater, um gleich darauf fortzufahren : der Himmel und Ferdinand reißen an meiner blutenden Seele. Schon diese Worte zeigen deutlich, in welchem Konflikt Luise sich befindet : Auf der einen Seite steht der Himmel für die Religion dieses Hauses, die christliche, die vorgibt, wie richtiges Handeln auszusehen habe (falsches Handeln gilt als Sünde), auf deranderen Seite steht Ferdinand, über den sie offensichtlich andere Vor-Stellungen erfährt, solche, die mit den christlichen nicht überein-stimmen. Beide Vor-Stellungen reißen an ihr, setzen sie also unter Druck, und da Luise von ihrer blutenden Seele spricht, erscheint es naheliegend, dass sie sich nicht für eine der bei- den Seiten entscheiden kann. Eine blutende Seele ist eine verletzte Seele, und da es sich um eine seelische, nicht aber um eine körperliche Verletzung handelt, ist von struktureller Gewalt auszugehen. Ansprüche werden an Luise erhoben, deren Druck sie sich nicht erweh-ren kann.
Der Ausdruck blutende Seele zeugt von einer tiefen Verwundung, die Luise zu heilen versucht durch Überlegungen, die eine Brücke schlagen sollen zwischen den beiden sie be-drückenden Anforderungen; Gott wird von ihr als Künstler gesehen, der seine Bestätigungerhalte über das Lob seines Meisterstücks - gemeint ist Ferdinand. So versucht Luise,beiden Ansprüchen gerecht zu werden und keinen zu vernachlässigen. Es ist ein hilfloserVersuch einer Versöhnung, wie sich sehr schnell zeigen wird, denn die Zeiten, in denenihr diese Versöhnung gelungen sei, lägen, wie Luise selbst formuliert, in der Vergangenheit : Ich wusste von keinem Gott mehr, und doch hatt ich ihn nie so geliebt.
Greifen wir auf Schillers Überlegungen aus den theoretischen Schriften zurück, so zeigen sich hier Chancen wie Probleme der dort dargestellten Liebes-Religion. Wenn Luise von keinemGott mehr wusste, so heißt das, dass sie ihn nicht mehr zum Objektihrer Wahr-Nehmung gemacht hat, zu einem Objekt, das ihr als (potentiell freiem) Subjekt nicht nur entgegen-steht, sondern ob seiner Qualitätenauch über ihr zu stehen beansprucht; nein, Luise hat - ganz im Sinne der in dieser Liebes-Religion intendiertenGottähnlichkeit des Menschen - Gott in das Gefühl ihrer Liebe aufgenommen, das auf ein egalitäres, symmetri-sches Verhältnis verweist und das im Unterschied zu dem objektivierten keine Trennung zwischen sich und Gott mehr zulässt. Insofern kann Luise behaupten, Gott nie so geliebt zu haben wie in dieser Anschauung.
Die Folge davon, dass Luise diese Anschauungen in die Vergangenheit setzt, zeigt, dass sie gegenwärtig dieser Einstellung entfremdet ist (sonst könnte sie sich auch nichtso zerris-sen fühlen) - um dennoch für sich einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden, verzichtet sie auf eine Verwirklichung dieser Idee in diesem (irdischen) Leben und hofft stattdessen - jetzt wieder in typisch christlicher Manier - auf eine Vereinigung mit Ferdinand in einem 'Leben' nach dem Tode : ich entsag ihm für dieses Leben. Damit steht schon in diesem 1. Akt, 3. Szene, fest, dass die Verbindung zwischen Ferdinand und Luise keine Chance der Verwirklichung hat. Es hätte zum Prozess des Scheiterns gar nicht der "Kabale" bedurft - die Liebe selbst hat (in dieser Konstellation) von vornherein keine Chance, ihre eigene Religion zu verwirklichen.
Luises "Machtspiel" besteht also von Anfang an darin, das Zerrissensein zwischen zwei Lebenseinstellungen für das irdische Leben zu akzeptieren und auf eine Versöhnung beider Ansprüche im Jenseits zu hoffen. Irdische Resignation und jenseitige Hoffnung prägen ihr Leben. Festzuhalten ist, dass sie selbst für die Unvereinbarkeit beider Ansprüche hier Schranken des Unterschieds anführt, die Ferdinand und sie trennen, die für sie verhasste Hülsen des Standes sind. Dass sie selbst diese internalisiert hat, zeigt sichin ihrer Bemer-kung Ferdinand gegenüber : Dass du doch wüsstest, wie schön in dieserSprache das bür-gerliche Mädchen sich ausnimmt. Die Standesunterschiede spiegeln sichin einer je unter-schiedlichen Sprache.
Schauen wir uns also Ferdinands Sprache bei seinem ersten Auftreten an : Sie ist eben- sovereinnahmend wie sein ganzes Verhalten : Er fliegt auf sie zu, ohne auch nur im gering- sten die Wirkung seines Verhaltens zu reflektieren : Luise sinkt entfärbt und matt aufeinen Sessel, er bleibt vor ihr stehen. Nehmen wir dieses Bild als typisch für das Verhälnis der beiden, so sehen wir einen dominierenden Ferdinand und eine dominierte Luise.Diese Do-minanz zeigt sich eben auch in seiner Sprache, die geprägt ist vom Possessivpronomen mein, das Besitz anzeigt : Du bist meine Luise. Wer sagt dir, dass du noch etwas sein soll-test ? Sie ist sein Privat-Besitz, wobei "privatum" (vom lat."privare" abgeleitet, das auch "berauben" heißt) den ausschließlichen und alle anderenausschließenden Besitz meint.
Schlimmer noch : Ob das der Fall sein soll, bestimmt nicht sie, sondern sie w i r d be- stimmt : wer sagt dir. Luise wird definiert, begrenzt, in dem, was sie zu sein hat,durch den Anderen. Sie ist eindeutig - nach Ferdinands Vorstellung - der passive (und damit der er-leidende) Teil der Beziehung. Diesem Grundgedanken folgen auch die weiteren Sätze : Ich will über (!) dir wachen / Mir vertraue dich / An diesem Arm soll meine Luise durchs Leben hüpfen (!) - man schaue sich diese Bilder in Ruhe an und bemerke, dasshier jemand Füh-rungsansprüche äußert, die zwar die Sorge für den anderen bergen, in der Form, in der sie vorgebracht werden, aber einer Entmündigung gleichkommen. Es ist der Vertreter des Adels als eines dem Anspruch nach übergeordneten Standes, der hier aus Ferdinand spricht
Dass Ferdinand nicht in der Lage ist, das zu reflektieren, spricht gegen ihn. Auch scheint er sein Gegenüber weder zu vernehmen noch zu verstehen. Wenn sie von einem Abgrund spricht, in den ich ganz gewiss stürzen muss, oder von einem Feuerbrand, den er in ihr jun - ges friedsames Herz geworfen habe, so sind das Bilder, die in ihrer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Dem Abgrund ist man ebenso rettungslos ausgeliefert wie einem Feuerbrand, und es ist auch klar, dass er, Ferdinand, aus ihrer Sicht derdieses verschulden-de Täter ist (du hast ... geworfen) und dass sie das erleidende Opfer ist (friedsam).
Das erste Aufeinandertreffen der beiden, die eigentlich durch ihre Liebe innigst verbun- den sein sollten, erweist sich in diesem Drama als ein Musterbeispiel einer misslungenen Kommunikation. Als "misslungen" bezeichnen wir eine solche Interaktion, in der die Betei-ligten auf mindestens einer Zeichenebene scheitern : auf der syntaktischen, der semanti-schen oder der pragmatischen. Luise hat offensichtlich die ersten beiden Ebenen erreicht, scheitert aber an der Umsetzung auf der pragmatischen; bei Ferdinandmuss man befürch- ten, dass er schon Schwierigkeiten mit der semantischen, der Bedeutungs-Ebene, hat, denn er widerspricht einerseits den von ihm selbst propagierten Idealen und er kann sich anderer-seits nicht in seine Kommunikationspartnerin hineinversetzen- der Inhalt ihrer Botschaft erreicht ihn nicht. So kommt es bei der letztlichen Umsetzung auf der Handlungsebenedazu, dass Luise nicht nur den Raum verlässt, nein, sie stürzt hinaus, und er ist schlicht sprachlos. Er versteht nicht und ist daher auch nicht in der Lage, seine Position zu überden-ken und alsFolge davon sein Verhalten und seine Sprache zu ändern.
Nun ist es am Leser / Zuschauer, sprachlos zu sein. Dazu bedarf es allerdings der Kennt-nisse der Liebesreligion, wie Schiller sie in seinen theoretischen Schriften entworfenhat und als deren Sprachrohr Ferdinand als der alle Standesschranken niederreißende Protagonist sich erweisen müsste. Eine Liebesreligion, die keine Schranken und Beschränkungen mehr kennt, setzt, soll ihre Realisierung gelingen, gleichberechtigte Partner voraus, die beide in ihrem Streben nach Vollkommenheit sich wechselseitig als gleichberechtigt schätzen (oder, wie Hegel es wenige Jahre später formulieren wird : anerkennen). Da geht es - diese Ideen vorausgesetzt - nicht, dass das bürgerliche Mädchen in einer meta-bürgerlichen (und das meint hier : aristokratischen) Sprache sich schön ausnimmt. Eine solche Wirkung zementiert die Verhältnisse geradezu.
Fazit : Es wird hier, im 1. Akt schon, überdeutlich, dass eine die Standesschranken auf- hebende Liebesreligion einer anderen Sprache bedarf. Und es erweist sich hier schon ebenso deutlich, dass Ferdinand über diese Sprache nicht verfügt. Schiller zeigt hier an seinem Prot-agonisten das Problem auf, dass von einer theoretischen Idealvostellung hin zu deren prak-tischer Umsetzung mehr erforderlich ist als ein bloßer guter Wille. Die situative Realität, in die dieHandelnden eingebunden sind, gibt die Rahmenbedingungen vor. In Ferdinands Haltung und Diktion spricht sich (unwissentlich und unwillentlich) ein Bewusstsein aus, das vom Herrschaftsanspruch seiner Herkunftnicht lassen kann. Hier haben wir sie, die von uns oben angesprochene Blockade der freien Machtspiele durch Herrschaftsverhältnisse.Unter dieser Voraussetzung sind Ferdinands Ideen bloße Lippenbekenntnisse.
Diese Vermutung des Zuschauers / Lesers bestätigt sich in der Auseinandersetzung zwischen Ferdinand und dem Präsidenten, seinem Vater, in der 7. Szene des 1. Aktes. Um sich von seinem Vater und dessen Vorstellungen abzugrenzen, schleudert der Sohn seinem Vater Sätze entgegen, deren Pathos den jugendlichen Helden zeigen sollen, die aber bei nä-herem Zusehen in sich schon frag-würdigsind : Weil meine Begriffe von Größe und Glück nicht ganz die Ihrigen sind / Mein Ideal von Glück ziehtsich genügsam in sich selbst zurück. In meinem Herzen liegen alle meine Wünsche begraben.Wer Schiller kennt, weiß, dass er in diese Formulierungen verliebt ist; der Marquis vonPosa, der idealistische Held des nächsten Schiller-Stückes Don Karlos, der dem großen, weltbeherrschenden Monarchen Philipp II zutrotzen wagt, wirft seine Schatten voraus. Von "Schatten" ist auch deshalb zu sprechen, weil beide, Ferdinand und Posa, mit ihrem Verhalten nicht das einlösen können, was ihre idealis-tische Gedankenkonstruktion vorgibt. Ferdinand lässt sich auch zu Bildern hinreißen, die zu der von ihm vertretenen neuen 'Religion' der menschlichen Vollkommenheit nicht passen wollen. Er verweist auf den Thron Gottes - eine Vorstellung, der ein Herrschaftssymbol in- härent ist und die damit nicht der egalitären Vision entspricht. Das wird Ferdinands Vater nun nicht begreifen - dazu reicht sein derzeitiges Begriffsrepertoire nicht hin, doch spürt er instinktiv die Angriffsfläche, die sichihm bietet. Seine Retourkutsche folgt augenblicklich, da für ihn alle diese Sätze eben nurhohle, angelernte Phrasen bedeuten : Meisterhaft ! Unverbesserlich ! Herrlich ! Nach dreißig Jahren die erste Vorlesung wieder.
Wenn schon der erste Akt dem Zuschauer einen Ferdinand in all seiner Widersprüch- lichkeit gezeigt hat, so bestätigt und verschärft sich dies Bild in weiteren Szenen. In der 5.
Szene des 2. Aktes kommt Ferdinand - noch beeindruckt von seiner Unterredung mit Lady Milford - ins Millersche Haus und trifft auf eine Luise, die ihn mit den Worten begrüßt : Mein Tod ist gewiss. Diese vorausdeutende Erkenntnis bleibt von ihm wiederum unver- standen; wenn die Regieanweisung von ihm fordert : geht schnell auf sie zu, bleibt sprach- los (!) mit starrem Blick vor ihr stehen, dann verlässt er sie plötzlich, in großer Bewegung, so zeigt es sich, wie stark bei Schiller "die Körpersprache ein Schlüssel zu den Bewegun-gen des Geistes ist"71: Jeder Affekt hat seine specifiken Äußerungen, und so zu sagen, sei- nen eigentümlichen Dialekt, an dem man ihn kennt (aus der 3. Dissertation)72. Ist somit der Körper direkter oder verschlüsselter Ausdruck der Seele, besteht die Möglichkeit, das Innere von außen zu erschließen, ja sogar die Seele gleichsam beiihren geheimsten Operationen zu ertappen (Vorrede zur ersten Auflage der Räuber).
"Das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Schiller die dramatische Methode liebt und das Theater mit seiner Präsentation von Figuren in ihrer körperlichen, aber in jeder Hinsicht sprechenden Erscheinung als Schule der Psychologie betrachtet"73, denn wie oben bereits im Zusammenhang mit Schillers Programmatik erwähnt, kommt es ihm darauf an, seine Zuschauer psychologisch einfühlsam mit den Eigenschaften und vor allem mit den dahinter stehenden Motiven der den Betrachter auch im Alltag umgebenden Menschen vertraut zu machen.
In der hier angesprochenen 5. Szene des 2. Aktes wird Ferdinand charakterisiert durch die Regieanweisungen "schnell", "sprachlos mit starrem Blick" und "in großer Bewegung".
Das starre Verharren in Sprachlosigkeit drückt Unverständnis aus, das die beiden Gebärden der Bewegung zu kompensieren versuchen. Ein ganz anderes Bild zeigt sich in den Anwei-sungen Luise betreffend, wenige Sekunden später : nach einer Pause, mit stillem bebendem Ton und schrecklicherRuhe. Unser Sprachgefühl entdeckt hier eine Reihe angedeuteter Oxymora : Wie kannein Ton still sein, wie passen die Attribute (still / bebend) zueinander, wie kann Ruhe schrecklich sein ? - sie können nicht nur, sondern sie kennzeichnen Luise und ihre Haltung in außergewöhnlich präziser Weise. Während sie das Un-Verhältnis ihrer Liebe klar durchschaut, versteht er gar nichts und rettet sich wieder einmal in eine Phrase, die in diesem Zusammenhang jedem Zuschauer als zu pathetisch erscheinen muss : Der Augenblick, der diese zwo Hände trennt, zerreißt auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung. Sagt es und eilt schnell fort und rennt... als liefe er vor der spätestens jetzt not-wendig gewordenen Reflexion weg.
Soweit zum Thema "Liebe". Die "Kabale" beginnt erst im 3. Akt und ist, wenn wir das bisher Gesagte reflektieren, nicht mehr als ein Katalysator für den endgültigen Untergang gang einer Beziehung, die zuvor schon ohne jede Chance gewesen ist (die durch die Herr- schaftsverhältnisse blockierten Machtspiele der Beteiligten vorausgesetzt). Wir können uns die Analyse weiterer Textpassagen sparen (sie verfestigen nur das bestehende Bild und füh-ren unweigerlich in die Katastrophe) - vielmehr sollten wir jetzt eine Art Fazit aus dem Ver-halten der beiden Liebenden ziehen und uns abschließend fragen, was der aufmerksame Zu-schauer / Leser an Einsichten gewinnt. Dies ist die eine Seite der Medaille, die, umgedreht, in die Frage mündet, was der Autor Schiller intendiert. Ich will- diese Aspekte einleitend - mit einem längeren Zitat aus der Literatur über Schiller beginnen : "Zu studieren ist an Schillers Figuren der Widerspruch zwischen Selbst- und Fremdbestimmung. Der psycholo-gische Befund determinierender Umstände schränkt das Vermögen zur Freiheit ein (wie die Herrschaftsverhältnisse die freien Machtspiele - B.M.) oder hebt es sogar auf, während andererseits die (...) Entdeckung innerer Welt innere Unabhängigkeit ermöglicht. Schillers Psychologie hat eine moralische (ebenso soziale wie politische) Dimension, wie umgekehrt sein Moralismus durch seine Psychologie in Frage gestellt wird. Er ist Skeptiker, wenn er sieht, wie wenig die Figur ihr Handeln verantwortet, etwa wenn sie vom Affekt gegängelt wird, und wiederum Optimist angesichts eines Selbstgefühls, das sich über die inneren und äußeren Beschränkungen der Sinnenwelt zu erheben vermag."74 Um es mit Schubladen-schlagworten zu sagen :Der theoretische Idealist Schiller und der praxisorientierte, drama-turgische Realist Schiller arbeiten sich wechselseitig aneinander ab; Schiller sieht (sicher-lich selbst betroffen) seine Idealisten scheitern, aber er würde sie nicht auf die Bühne bringen, wenn er an ihnen nicht ein letztlich positives Beispiel würde geben wollen. Wenn also freie Machtspiele durch bestehende Herrschaftsverhältnisse blockiert werden, so ist es an der Zeit, diese Blockaden zu beseitigen. Wer Schiller kennt, weiß, dass der erste Schritt dazu ein Anstoß von innen, aus der Persönlichkeit der Betroffenen stammend, sein muss. (Das Modalverb "muss" resultiert aus der Einsicht in die Not-Wendigkeit der bestehenden Verhältnisse.)
"Als methodische Konsequenz ergibt sich für den Interpreten, der dem Psychologen Schiller folgt, die Aufgabe, die Figuren seiner Dramen zu hinterfragen (...), sich also nicht damit zu begnügen, was sie oberflächlich und vordergründig an Ideen, Absichten, Entschlüssen oder auch von außen auferlegten Bestimmungen bekunden, sondern mög-lichst zu eruieren, was unter dieser Decke verborgen liegt. (...) Unter der Oberfläche sozialer und politischer Konstellationen findet in Anziehung und Abstoßung das Kräfte- spiel der Seelen statt."75
Das auf dem Spiel stehende Ideal ist das der Unbedingtheit der Liebe (und in eins damit das eines zu dieser unbedingten Liebe fähigen, gott-ähnlichen Menschen); seine Verwirklichung scheitert an der gesellschaftlichen Bedingtheit der es anstrebenden Protagonisten. Ferdinand bleibt, wie gezeigt, in seinem Denken und Handeln der adlige Held.76 Er idealisiert seine Partnerin einerseits, ist aber andererseits nicht in der Lage, sie überhaupt - in ihren eigenen Ansprüchen - wahrzunehmen und mit ihr in ein symme- trisches Kommunikationsverhältnis zu treten. Wie wir oben gesehen haben, dominiert er sie durch seine Gesten, vorallem aber durch seine Sprache. Was er für die Sprache seines Herzens hält, das erweistsich als Sprache seines Standes.77 (Ich bin ein Edelmann. 1. Akt, 4. Szene) Seine Anmaßung verweist dabei nicht selten auf das inhaltliche Gegenteil.
Wenn er in der Auseinandersetzung mit Luise formuliert : keinGedanke tritt in dies An-gesicht, der mir entwischte, so weiß der aufmerksame Zuschauer, dass Ferdinand keinen einzigen der Gedanken Luises erwischt, da er ihrer Einstellung gegenüber (von Anbeginn an) blind ist.78
Ferdinand erhebt sich aber in adeliger Anmaßung nicht nur über Luise, sondern auch über alle anderen. Wenn er in diesem Zusammenhang von Insektenseelen (2. Akt. 5. Szene) spricht, so gibt er letztlich nur die Selbst-Überhebungwieder, wie sie sich zur Zeit Schillers in den problematischen Selbsteinschätzungen der Stürmer und Dränger als eines Genies zeigt. Schillers Lehrer Abel formuliert dem entsprechend in seiner "Rede über die Entste-hungund die Kennzeichen grosser Geister" von 1776 : "Das Genie voll Gefühl seiner Kraft voll edlen Stolzes, wirft die entehrende Fesseln hinweg, höhnend den engen Kerker in dem der gemeine Sterbliche schmachtet, reißt sich voll Helden-Kühnheit loß, und fliegt gleich dem königlichen Adler weit über die kleine niedre Erde hinweg, und wandelt in der Sonne. Ihr schimpft, daß er nicht im Gleise bleibt, daß er aus den Schranken der Weißheit und Tugend getreten, Insekten, er flog zur Sonne."79 Dass sich in dieser Selbsteinschätzung eine Herrschafts-Attitüde zeigt, ist weder dem Stürmer und Dränger noch Ferdinand klar. Sie passt aber so gar nicht in das Ideal der Theosophie des Julius, die Schiller entworfen hat.
Werfen wir einen Blick auf Luises Sprache; der Germanist Walter Müller-Seidel hat seine diesbezügliche Untersuchung "Das stumme Drama der Luise Millerin" genannt.80
Er zitiert wiederum einen anderen Germanisten (Günther Müller) : "Nirgends wie hier hat Schiller die Daseinsmöglichkeit der geistigen Person in eine solche Enge getrieben."81 Und er selbst formuliert : "Die Art, wie in "Kabale und Liebe" Spracheund Sprachnot82 in den dramatischen Vorgang eingreifen und diesen vorantreiben, sucht man in den Dramen der Zeitgenossen vergebens. (...) Das stumme Drama der Luise Millerin ist der Versuch, sich der handelnden Welt zu entziehen und das Unbedingte der Idee noch gegen die Bedingt-heiten der Welt zu retten."83 Luises "Stummheit" darf aber nicht dazu verleiten, in ihr eine Person zu sehen, die nichts zu sagen hat - im Gegenteil. In den Anmerkungen der Frank-furterSchiller-Ausgabe wird betont : "Keine der vorherigen Frauengestalten aus Schillers Dramen steht auf einer solchen Höhe der Reflexion, besitzt solche Fähigkeiten zur Selbst-analyse und das Vermögen, sich so einfach und bündig auszudrücken."84
Dass mit ihr kein unmündiges Persönchen auftritt, sondern dass sie sich als gewachsene (und noch wachsende) Persönlichkeit erweist, zeigen die auch hier sehr aussagekräftigen Regieanweisungen. Die Formulierung mit stillem, bebendem Ton undschrecklicher Ruhe (2. Akt, 5. Szene) ist oben bereits angesprochen worden. Ihr an die Seite zu stellen sind dramaturgische Hinweise wie sehr ernsthaft (des öfteren), imTon des tiefsten inwendigen Leidens (3. Akt. 4. Szene), groß und schrecklich und schreckliches Stillschweigen (in der Begegnung mit Wurm - 3. Akt, 6. Szene) und schließlich eine Reihe von Anweisungen, ihr Gespräch mit der Milford betreffend (ein Gespräch, das in der Literatur wiederholt als einziges Beispiel einer gelingenden Kommunikation bezeichnetwird, da beide Beteiligte aufeinander eingehen und sich aneinander abarbeiten und so beide auch zu einer veränder-ten Einstellung kommen - wir werden späterhin, bei der Beurteilung der Person der Lady, darauf zurückkommen). Dem gesellschaftlichen Rangunterschied zum Trotz gibt Luise sich in deren Gegenwart groß mit entschiedenem Ton / gelassen und edel / standhaft / feinund scharf ihr in die Augen sehend. Das beeindruckt die Lady in zunehmendem Maße, sie spricht Luise heitre Ruhe zu und nennt sie schließlich edle, große, göttliche Seele (Zitate aus Akt 4, Szene 7). Die Zitate sprechen für eine eigenständige, ihrer selbst bewusste Persönlichkeit. Schließlich ist sie es auch, die am Ende, mitten in der Katastrophe, den Durchblick bewahrt, wenn sie Ferdinand gegenüber äußert : Ein entsetzliches Schicksalhat die Sprache unsrer Herzen verwirrt. Dieses "Schicksal" ist dem aufmerksamen Beobachter kein blindes Fatum, sondern selbstverschuldete Unmündigkeit, um mit Kant zu sprechen.
(An dieser Stelle ist es sinnvoll, den Begriff "tragisch" zu thematisieren. "Tragisch" ist per Definition eine Situation dann, wenn der Handelnde - was auch immer er tut und wofür er sich entscheidet - sich schuldig macht. In Schillers Drama liegt eine solche Ausweglosigkeit der Situation nicht vor - eine entsprechende Reflexion hätte diesen Ausweg eröffnet. Die 'Tragödie' - im uneigentlichen Wortsinne - des vorliegenden Dramas resultiert aus einem Versäumnis der handelnden Personen, wie wir weiter unten noch ausführen werden.)
Beide, Ferdinand und Luise, spielen ein metaphysisch gut abgesichertes Machtspiel.
Ferdinand vertritt die zu Schillers Zeit sehr progressive Auffassung einer Liebesbeziehung jenseits jeglicher hierarchischer Setzung, Luise ist davon angesteckt, beurteilt deren Ver-wirklichungschancen aber realistischer, entsagt ihr für dieses Leben (vgl. S.18) und hofft, christlich erzogen, auf deren Möglichkeit im jenseitigen Leben. Wenn man so will, hat Luise also zwei 'metaphysische Eisen im Feuer' (wenn die Bemerkung erlaubt ist). Ihr Machtspiel scheitert weder an der Tatsache der diesseitigen Entsagung noch an ihrem Tod noch daran, dass sie die Bindung an den Vater nicht aufgibt - ihr Machtspiel scheitert daran, dass sie ihren Plan, ihrem Leben selbst ein Ende zu setzen, nicht durchführen kann, weil sie durch äußere Faktoren daran gehindert wird. Für sichgenommen birgt aber auch schon der Entschluss zum Selbstmord einen Identitätsverlust,(da er sich letztlich gegen die eigene Per-son richtet und nicht gegen die Bedingungen, die Autonomie - hier auf Erden - verhindern). Schließlich wäre Luise (gesetzt, ihr Planwäre aufgegangen) nur durch ihre Bereitschaft zum Verzicht zur Heldin geworden - eine dramaturgische Idee, die nicht ins Spielfeld von Schil-lers Idealismus passt.
Der Mann dagegen, Ferdinand, versucht dadurch zum Helden zu werden, dass er sich über alle bestehenden Ordnungen hinwegsetzt, aber auch (s.o.) über alle partnerschaftlich verstandenen Beziehungen zu anderen Menschen. Sein Machtspiel scheitert daran, dass er das Ideal, in dessen Namen er auftritt, selbst nicht zu leben bereit ist. Er bedarf zu seiner Selbstkonstituierung der herrschaftlichen Pose, die in einem vonihm nicht bemerkten und nicht durchschauten Missverhältnis zur intendierten Liebesreligion steht : "Liebe bedeutet für ihn nur, Gefühl zu haben, er empfindet sie als einen statischen, abgehobenen und priva-ten Zustand und übersieht, daß sie ein Bestandteil menschlicher Arbeit und sozialen Mit-einanders ist, das dieses Kontextes auch bedarf."85 Ein paar Jahre später werden Hegel und Marx diesen hier angesprochenen Arbeitsbegriff in den Mittelpunkt ihrer Analyse setzen.
In seinem Verhalten offenbart sich der krasse Widerspruch zu seinem Ideal; in ihm "ar-tikuliert sich die Angst des Subjekts, sich in der Liebe zu offenbaren und sich damit parti- ell aufzugeben, die eigene Sicherheit und Einheit zu gefährden. Die verdrängte Schwäche wirkt nun auf das Ich zurück, das Angst hat um das, was es von sich bisher in der Liebes-beziehung preisgegeben hat".86 Als Luise, die ihn durchschaut hat, zurecht auf seine herr-schaftliche Attitüde hinweist (dein Herz gehört deinem Stande), ergreiftFerdinand in seiner Wut eine Violine, zerreißt (...) die Saiten. zerschmettert das Instrument auf dem Boden und bricht in ein lautes Gelächter aus. Mit diesem irren Gelächter als Begleit'musik' zu diesem Ausbruch des latent immer vorhandenen Gewaltpotentials sind auch die ursprünglich freien Machtspieleder beiden Haupt-Protagonisten endgültig zerstört.
Was hat Schiller mit dieser Konstellation bei seinen Zeitgenossen erreichen wollen ?
Was passiert mit uns, wenn wir dem auf der Bühne Gesehenen nach-denken ? Mögliche
Antworten werden weiter unten zu geben sein.
V.2 Der Musikus Miller
Bisher haben wir uns mit Luise und Ferdinand im engsten Kreis jener Personen bewegt, die innerhalb dieses Dramas den zur Untersuchung anstehenden Konflikt austragen. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass diese beiden Personen den für die Entwicklung der Handlung hinreichenden Konfliktstoff bergen. Schiller als Dramatiker erweitert den Kreis seiner Personenkonstellation, um das Problem und das Scheitern einer Lösung noch an-schaulicher herauszuarbeiten. Der Musikus Miller, Luises Vater, steht dabei dem Zentrum des Konflikts sehr nahe; zum einen ist er es, der auf Luise den entscheidendenEinfluss ausübt, zum anderen gehört er (wie Luise und Ferdinand) zu den Personen, diedem Be- trachter / Leser zunächst einmal sympathisch erscheinen.
Er charakterisiert sich selbst als plumper, gerader teutscher Kerl (1. Akt, 2. Szene). Das Attribut teutsch ist zur Zeit des "Sturm und Drang" positiv besetzt. So nennt Ferdinand sich in seiner Auseinandersetzung mit seinem Vater (1. Akt., 7. Szene) mit Stolz teutscher Jüngling. Das Selbstbewusstsein, das aus dem sich-deutsch-Nennen herrührt, versteht sich mit Blick auf die intendierte Abgrenzung von allem Französischen, das in - aus deutscher Sicht - unechtem, gekünsteltem Schein daherkommt. Das Attribut gerade, das Miller sich zuspricht, verweist auf "Geradlinigkeit", Ehrlichkeit, auch Verlässlichkeit - alles Bestand-teile jener beschränkenden Kleinbürgermoral, von der oben schon die Rede war. Plump - adjektivisch oder adverbial gebraucht - drückt (wie das "Deutsche Wörterbuch" von Grimm zeigt) auch in jenen Tagen schon etwas Schwerfälliges, schwer Bewegliches aus; wenn Mil-ler sich stolz darauf beruft, geschieht das im gleichen Sinnewie bei gerad und ist in beiden Fällen wieder gegen französische Unzuverlässigkeit, Oberflächlichkeit und Tändelei gerich-tet. Er redet und handelt teutsch und verständlich (2. Akt, 6. Szene).
In Millers Person zeigt sich also kleinbürgerlicher Stolz auf die eigene Lebenseinstellung in sehr deutlicher Form. Er ist stolz auf seinen Namen (Ich heiße Miller, 1. Akt,1. Szene u. ö.) und auf seinen Raum, in dem er allein Verfügungsgewalt hat : Das istmeine Stube (2. Akt, 6. Szene). Darin zeigt sich eine eigene Standesehre; Stadtmusikanten sind zu der Zeit freie Bürger, die mit der Stadt einen Vertrag geschlossen haben, der ihnen Privilegien garan-tiert, aber auch Pflichten auferlegt (z.B. die Verpflichtung zur Ausbildung). Damit repräsen-tiert Miller nicht "d a s Bürgertum schlechthin" (eine Schublade übrigens, die angemessen zu füllen sich Soziologen immer schon schwergetan haben), sondern ein historisch gewach-senes, das obendrein ein dem Ende zugehendes ist87. Miller "stemmt sich gegen einen histo-rischen Prozess, der bald gnadenlos über ihn hinweggehenwird und den er verzweifelt ab-zuwehren sucht, ohne ihn zu durchschauen"88. Versuchen wir es.89
Die Rolle der (vor allem klein-)bürgerlichen Familie erfährt im 18. Jahrhundert eine Veränderung : Sie wird insofern aufgewertet, als sie die Aufgabe hat, die in der politischen, aber auch privat-beruflichen Situation enstandenen Frustrationen, die gekennzeichnet sind durch ein (allen aufklärerischen Tendenzen zum Trotz) verweigertes Mitspracherecht, aus- zugleichen. Als "kompensatorisches Gegengewicht zur entfremdeten Arbeitswelt"90 trägt ihr Bild einerseits idyllische Züge und fungiert andererseits als moralisches Vorbild für eine alternative Gesellschaftsauffassung. Diese Idylle ist aber Utopie, noch dazu eine standesge- bundene, und eine Utopie ist ein Nirgendwo-Ort (wenn auch mit dem Wunsch versehen, sie zu einer konkreten Utopie91 zu machen, die auf ihre Verwirklichung aus ist).
Das Private dieses idyllisch verstandenen Bereichs "ist also durchaus ambivalent konzi-piert als potentiell kritische Alternative und utopischer Aufbewahrungsort der 'Ahnung einesbesseren menschlichen Zustandes' (Horkheimer) einerseits und als affirmatives Ele-ment der Entspannung, als kleine Welt, in der alles scheinbar intakt ist; trotz der Widrig-keiten der übrigen Gesellschaft hilft sie, die Ungerechtigkeiten besser zu ertragen."92 Dabei kommen Mann und Frau je unterschiedliche Aufgaben zu.
"Der Umstand, daß sich im Bereich der Familie zum einen die Zurichtung neuer Men- schen zu produktiven Arbeitskräften für die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft voll- zieht, zum anderen bei diesem Vorgang Qualitäten wie Liebe, Harmonie und emotionale Zuwendung gefordert sind, die der Logik der Produktion geradezu widersprechen, hat ins- besondere für die Frau die Konsequenz der Widersprüchlichkeit ihrer eigenen Identität."93
Beispiel 'Liebe' : Miller verdeutlicht Wurm (1. Akt, 2. Szene), dass er selbst kein In- teresse daran habe, seine Tochter jemandem an die Hand zu geben : Das Mädel muss mit Ihnen leben - ich nicht - warum soll ich ihr einen Mann, den sie nicht schmecken kann, aus purem klarem Eigensinn an den Hals werfen ? Den Weg Wurms, über den Vater an die Tochter kommen zu wollen, nennt Miller einen altmodischen Kanal. Der weitere Verlauf des Dramas zeigt ein modifiziertes Bild : Luise hat zwar die Freiheit, einenMann, der ihr nicht recht ist, abzulehnen, aber sie hat nicht die Freiheit, den zu nehmen,den sie liebt (zumindest setzt der Vater all seine Autorität ein, das zu verhindern). Daswiederum hat seinen Grund darin, dass die Tochter als eine Art 'lebender Versicherung' verstanden wird, die dem Vater etwas rückzuerstatten hat. Dementsprechend hat sie sichihren Lebenspart- ner auszusuchen : Das betrifft die ökonomische Sphäre (a) ebenso wiedie der religiösen Bindung (b). zu a) : Die Sprache des liebenden Vaters verrät sich immer wieder durch Äußerungen, die aus dem ökonomischen Bereich stammen : Der Handel wird ernsthaft, der künftige Schwiegersohn wird als Kundschaft gesehen und die Beziehung der Tochter als Kommerz (alle Akt 1, Szene 1) ; den von Luise geplanten Selbstmord nennt er Diebstahl und dessen mögliche Konsequenzen für ihn selbst beschreibt er wie folgt : Die Zeit meldet sich allge-mach bei mir, wo uns Vätern die Kapitale zustatten kommen, die wir im Herzen unsrer Kinder anlegten - Wirst du mich darum betrügen, Luise ? Wirst du dich mit dem Hab und Gut deines Vaters auf und davon machen ? (5. Akt. 1. Szene). Er spricht von Barschaft anLiebe (5. Akt, 3. Szene) und lässt sich schließlich von Ferdinand mit Gold kaufen (5.Akt, 5. Szene), nicht ohne Skrupel, aber letztlich doch mit der Beruhigung, dieses Goldder Tochter zukommen zu lassen, so dass er dieses Vorhaben in der Konsequenz "als eigene Nobilitierung"94 erfährt.
Diese Zitate zeigen die Richtung an, in der Millers eigentliches Interesse zu suchen ist.Es sieht so aus, als sei er allein an Luises Wohlergehen interessiert, doch in Wahrheit sichert er nur seinen eigenen Herrschafts- und Autonomiebereich.95 Liebe und Leiden- schaft sind in dieser Hinsicht störende Faktoren; sie zeigen einen spontanen Charakter, der die Verhältnisse destabilisiert. Wenn derHausvater seine patriarchale Macht sichern, stabilisieren will, muss er Frau und Tochter zurichten. Das vollzieht Miller an seiner Frau (stellvertretend seifolgendes Zitat angeführt : Willst du dein Maul halten? Willst das Vio-loncello am Hirnkasten wissen ? (...) Marsch du in deine Küche (1. Akt, 2. Szene), und das vollzieht er auch an seiner noch unverheirateten Tochter, denn solange diese noch unver- heiratet ist, ist sie"als einzige nicht sicher und dauerhaft in das patriarchalische Herrschafts-system eingebunden" und stellt"also eine latente Gefahr für das väterliche Machtgefüge dar" undund bedarf daher "einer spezifischen Konditionierung".96
zu b) Um die eigene patriarchalische Macht zu sichern, versucht Miller eine stabilisieren- de Ordnung aufzubauen; dabei hilft ihm die christliche Religion; über den Besitzanspruch Gottes versucht er den eigenen Besitzanspruch an seiner Tochter zu sichern. Sowird die von Ferdinand intendierte Liebes-Religion als überhimmlische (!) Alfanzerei eingestuft, die die Handvoll Christentum (...), die der Vater mit knapper Not soso noch zusammenhielt, gefähr- fährdet. (1. Akt. 1. Szene) Als Konsequenz urteilt er über Ferdinand wiederum mit ökono-misch orientierter Begrifflichkeit : Ein konfiszierter widriger Kerl, alshätt ihn irgendein Schleichhändler (!) in die Welt meines (!) Herrgottshineingeschachert (!)(1. Akt, 2. Szene). Über Luise sagt er : Ich hab sie von Gott (5.Akt,5. Szene), nennt sie meine Luise, mein Himmelreich (5. Akt, 1. Szene) (man beachte diedoppelte Usurpation durch das Possessiv-pronomen) und setzt die so geforderte Luiseunter Druck : Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben (ebd.).
Mit diesen Aspekten ist Millers Machtspiel umrissen. Er weiß um die Gefährdung seiner Position. Gleich in der ersten Szene gebraucht er, wenn er seine Herrschafts-Stellung im Haus anspricht, das Präteritum : Ich war Herr im Haus. Dieses Machtspielerweckt den Ein-druck, wenigstens ehrlich zu sein und offen seine Forderungen darzustellen (plump und ge-rad) . Aber es ist grund-legend mit Herrschaft verbunden, und Herrschaftsverhältnisse behindern nicht nur, sondern verhindern die freie, wechselseitigeInteraktion, ohne die Machtspieleihr Potential nicht entfalten können.
Resümieren wir, so ist von dem positiven Eindruck des liebenden Vaters und geradlini-gen Kleinbürgers nicht viel geblieben. Der Zuschauer hat einen weiteren Sympathieträgerverloren. Der Musikus denkt in ökonomischen Kategorien; in seinem Verhältnis seinen Mitmenschen gegenüber (selbst wenn sie ihm sehr nahestehen) geht es letztlichum Inves-tition, um Gewinn und Verlust. Das Kind istdes Vaters Arbeit (2. Akt, 6. Szene),und er will seinen Lohn dafür. Damit unterscheidet er sich nicht von den übrigenHerrschaftsträgern. "Schiller analogisiert in diesem Drama die Rolle des Landesvaters (der, wie in der Kammer-herrn-Szene gezeigt, seine Landeskinder in den Krieg verkauft - B.M.) mit der des bürger-lichen Familienvaters; beider Macht dokumentiert sich im Handel mit Menschen, so daß feudal-öffentliche Gewaltausübung und die verinnerlichte Gewalt der bürgerlichen Familie miteinander korrespondieren."97
V.3 Die Kabalisten
Es gibt deren drei : den Fürsten / Herzog, den Präsidenten und Wurm. Wir brauchen ihnen nicht die gleiche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen wie den bisherbesprochenen Personen. Diese Drei teilen sich in die Aufgabe der für ein Drama als notwendig angesehe-nen Gegen-Spieler. Ihre Machtspiele entlarven sich von vornherein als untauglich, da sie of-fensichtlich mit Herrschaftsansprüchen durchsetzt sind. Zugleich sind sie - wie oben schon festgestellt - eigentlich für das Stück auch unwesentlich, da sie zwar durch die Kabale zur Beschleunigung des dargestellten Vorgangs beitragen, für seine Problematik aber nicht not-wendig sind - der eigentliche Gegenspieler für die von ihnen intendierte Liebesbeziehung sind die beiden Liebenden selbst. Der Konflikt spielt sich in deren Innerem ab. Insofern ist der von Iffland vorgeschlagene Titel Kabale und Liebe zwar sehr reißerisch und damit recht markt-tauglich gewählt, aber letztlich auch irreführend.
Der Fürst / Herzog tritt persönlich gar nicht in Erscheinung, aber er steht "meist bedroh- lich" im Hintergrund : "Überhaupt scheint sich die Größe des Fürsten noch dadurch zu steigern, dass er als übergeordnete und nicht konkret fassbare Macht stets im Hintergrund bleibt."98 An der konkreten Kabale ist er nicht beteiligt, eröffnet ihr aber den Raum durch sein allgegenwärtiges Herrschafts-System. Mit der Vorstellung des gnädigsten Landes-herrn (2. Akt, 2. Szene) wird auf diese Weisegründlich aufgeräumt. Dass Schiller über die-se Figur mit seinem Zieh-Vater Karl Eugen abrechnet, wird allein schon an der Kammer-diener-Szene deutlich. Es bleibt Ferdinand vorbehalten, die grundsätzliche Kritik vorzubrin-gen : Kannder Herzog Gesetze der Menschheit verdrehen ? (2. Akt, 3. Szene) Mit den "Ge-setzen derMenschheit" ist das unveräußerliche Naturrecht gemeint, in das einzugreifen kein Herrscher ein Recht hat (nach der politischen Theorie der Zeit - in der Nachfolge von ThomasHobbes).
Das Machtspiel des Präsidenten basiert auf einem Herrschaftskalkül; einzig an der Auf- rechterhaltung und Fortführung seiner Herrschaft ist er interessiert. Deshalb möchte er seinen Sohn in einer führenden Stellung am Hofe sehen : Mich lass an deinem Glück ar- beiten, und denke auf nichts, als in meine Entwürfe zu spielen. Dafür erwartet er Dankbar- keit. (1. Akt, 7. Szene). Dass sein Sohn ihm nicht dankbar ist, quittiert er mit Unverständnis.
Er ist subjektiv von seinen "Wohltaten" Ferdinand gegenüber genauso überzeugt wie Ferdi- nand gegenüber Luise. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Als seine Pläne zu scheitern drohen, stimmt er dem Plan der Kabale zu : Das Geweb ist satanisch fein (3.Akt, 1. Szene). Das Prädikativum fein steht für 'feinmaschig' - es ist dem- entsprechend schwer erkennbar und man kann ihm nicht entrinnen. Das Attribut satanisch deutet auf das Merkmal der Hinterlist und Heimtücke. Dem Präsidenten ist es recht, wie ihm alles recht ist, was in sein Herrschaftskalkül passt. Luise und Miller reizen ihn nicht dadurch, dass sie Standesgrenzen nicht achten, sondern dadurch, dass sie seine Pläne ge- fährden. Dagegen ist ihm jedes Mittel recht : "Die präsidiale 'potestas' realisiert sich als sprachliche und körperliche 'violentia'."99
Der Autor dieses "satanisch feines Gewebes" ist der Haussekretät des Präsidenten mit dem sprechenden Namen Wurm. Wie ein Wurm windet er sich links und rechts der Stan- desgrenzen und agiert, selbst ein Bürgerlicher, mit aristokratisch geprägter Anmaßung.
Eine einzige Regieanweisung Schillers reicht aus, ihn zu kennzeichnen : boshaft freund- lich (3. Akt, 6. Szene). Vordergründig "freundlich" gibt er sich Luise gegenüber, doch ist es eine ebenso hintertriebene Freundlichkeit, wie das feine Gewebe satanisch ist.Wurm ist ein Nachfolger des Franz Moor aus Schillers "Räubern", intelligent, mit scharfem Ver-stand, zugleich sich zurückgesetzt fühlend. Er ist damit ein Kind der Aufklärung,aber ei- ner solchen, die wir heute (mit Jaspers) eine 'falsche Aufklärung' zu nennen gewohnt sind. "Falsche Aufklärung meint, alles Wissen und Wollen und Tun auf den bloßen Verstand gründen zu können (statt den Verstand nur als den nie zu umgehenden Weg der Erhellung dessen, was ihm gegeben werden muß, zu nutzen); sie verabsolutiert die immer partikula-ren Verstandeserkenntnisse (statt sie nur in dem ihnen zukommenden Bereich sinngemäß anzuwenden); sie verführt den Einzelnen zum Anspruch, für sich allein wissen und auf Grund seines Wissens allein handeln zu können, als ob der Einzelne alles wäre {statt sich auf den lebendigen Zusammenhang des in Gemeinschaft in Frage stellenden und fördern-den Wissens zu gründen)."100 An dieser Hypertrophierung der unzulänglichenbloßen Verstandesorientierung scheitert sein Machtspiel - ein solches, so ist eingangs gezeigtworden, entfaltet sein produktives Potential nur im freien Spiel der Beteiligten; wer esal- lein für sein persönliches Partikularinteresse einsetzen möchte, muss scheitern. Es bleibtihm am Ende nur das (befriedigende ?) Bewusstsein des gemeinsamen Scheiterns mit demanderen Konstrukteur des satanisch feinen Gewebes, dem Präsidenten : Arm in Arm mit dir zum Blutgerüst ! Arm in Arm mit dir zur Hölle ! Es soll mich kitzeln, Bube, mit dir ver-dammt zu sein. Wenn er ihm dabei auf die Schultern klopft und ihn Kamerad (5. Akt,letz- te Szene) nennt, so hält er noch im Scheitern die Übertretung der Standesgrenzen aufrecht, was in seinem Weltbild wohl als partieller Triumph zu geltenhat.
V.4 Lady Milford
Bleibt uns, das Machtspiel der Milford zu untersuchen - einer Person, die schon aus dem Grund unser Interesse erlangt, dass sie die einzige ist, die innerhalb des Dramas eineVeränderung durchlebt, und zwar eine am Ende selbständig gewählte, so dass in Be- zugauf ihre Person (und nur auf ihre) von einer "Autonomie" gesprochen werden kann. Diese Tatsache lenkt unser besonderes Interesse gerade auf ihr Machtspiel. Zugleich ist festzustellen, dass sie dieeinzige Person ist, die plötzlich und spurlos verschwindet, sich der Katastrophe entzieht, damit aber auch jeden Einfluss auf den weiteren Gang des Tex- tes verliert.
Dass die Milford Schillers wachsendes Interesse während des Niederschreibens bean- sprucht, hat er in einem Brief an Reinwald vom 3. Mai 1783 betont. Entsprechend ist es ihmmit der Person des Posa (aus dem Don Karlos) gegangen. Die beiden Figuren weisenähnliche Persönlichkeitsstrukturen hinsichtlich ihrer Tugendhaftigkeit auf : "Das Interesse des Dichters beruhte zweifellos auf der Aussicht, an ihr (gemeint ist die Lady - B.M.) einen geradezu musterhaften, vollkommenen Umschwung, die Erhebung aus einer lasterhaften Welt zu höchster Tugend, vorführen zu können. Daß dies nur unter Schwierigkeiten zu rea-lisieren war, zeigt sich daran, welchen Raum Schiller der Nebenfigur geben, welche exzen-trischen Wendungen er sie durchlaufen lassen musste."101 Schauen wir uns diese näher an.
Die 1. Szene des 2. Aktes gehört insofern gleich ihr, als sie sie nicht nur beherrscht (ihre Gesprächs'partnerin' ist ihre Kammerjungfer) - nein, sie darf auch gleich einige State- ments von sich geben, die man von einer Mätresse am Hof nicht erwartet hätte, Sätze, die aus dem Mund eines Stürmers und Drängers stammen könnten : Ich mussins Freie - Men-schen sehen und blauen Himmel, und mich leichter reiten ums Herz (!) herum. Die Seelen der Menschen, die sie am Hofe umgeben, vergleicht sie mit Sackuhren, und sie nennt diese Menschen schlechte und erbärmliche (...) , die sich entsetzen,wenn mir ein warmes, herz-liches Wort entwischt. Und an ein Gespräch mit ihnen sei auch nicht zu denken, wenn sie das Herz nicht haben, andrer Meinung als ich zu sein. Und bei ihrem Herzog vermisst sie die Fähigkeit, seinem Herzen (zu) befehlen, gegenein großes feuriges Herz groß und feurig zu schlagen. Und : mein Herz hungert...
Setzen wir einmal ein Publikum voraus, dem die Sprache des StuD nicht fremd ist - in kurzer Aufeinanderfolge wird das Wahrnehmungsorgan des Stürmers und Drängers, das Herz, an- und aufgerufen, und das ausgerechnet von einer gekauften Gespielin des Fürsten, dessen Bild Schiller sicherlich bei Franziska von Hohenheim, der teuren Mätresse Karl Eu-gens, abgeschaut hat. Erstaunen, Verwirrung wird die Reaktion beim Zuschauer sein, und das greift Schiller auf, um mit einem Satz der Milford alle Zweifelzu beseitigen : Ich habe dem Fürsten meine Ehre verkauft, aber mein Herz habe ichfrei behalten. Dass sie dieses Herz Ferdinand schenken möchte, wird man ihr nicht verübeln, auch wenn sie mit diesem Begehren den jungen Leuten einen weiteren Stolperstein in den Weg legt.
Die Regieanweisungen in ihrem Gespräch mit Ferdinand (2. Akt, 3. Szene) tun ein übriges, ihr nicht nur die Teilnahme der Zuschauer, sondern schließlich auch Ferdinands zu sichern : mit einer Beängstigung, dass ihr die Worte versagen / schmerzhaftvon ihm weggehend / schaut ihm groß ins Gesicht / mit Sanftmut und Hoheit / mit immer zunehmen-der Rührung. Hier denkt, spricht und handelt eine empfindsame Seele und bringt Ferdinand in schrecklichste () Bedrängnis, und er handelt mal wieder so, wie wir es von ihm gewohnt sind, wenn er vor ein Problem gestellt wird : Er bleibtin sprachloser Erstarrung stehen. (...) Dann stürzt er fort.
Das Problem der Milford ist damit aber nicht gelöst - sie liebt Ferdinand immer noch, und obendrein droht sie durch seine Ablehnung zum Gespött des ganzen Landes zu werden. Es ist ihr klar, dass - als sie Luise empfängt - ihr Wohl und Wehe eben vomVerlauf dieses Gespräches abhängt. Es ist oben schon gesagt worden, dass Luises beherztes Auftreten sie beeindruckt und schließlich davon überzeugt, den eigenen Anspruch zurückzunehmen : Der Geste, Luise von oben herab zu behandeln (dreht sich nach Luisen um, und nickt nur eben mit dem Kopf, fremd und zurückgezogen) folgt der misslingende Versuch, Luise durch eine Anstellung zu bestechen; deren Auftreten (gelassen und edel / standhaft / fein und scharf ihr in die Augen sehend) verunsichert die Lady ebenso wie des Bürgermädchens Fragen : Sind Sie glücklich, Mylady und (gepaart mit der Geste, die Hand vor der Lady Brust zu halten) :
Hat dieses Herz auch die lachende Gestalt Ihres Standes ? Ausgerechnet die Instanz des Herzens, wenige Auftritte zuvor von Lady Milford selbst noch als wesentlich dargestellt, wird angesprochen und befragt (= in Frage gestellt). Das Ausweichmanöver, Luise durch Wertgegenstände zu bewegen, Ferdinand zu entsagen, ermöglicht Luise einen abschließen-den Triumph (siesteht eine Weile gedankenvoll. dann tritt sie näher zur Lady, fasst ihre Hand und siehtsie starr und bedeutend an) - jede dieser Gesten zeigt Luise überlegt und überlegen; sie zeigt keine Aufgeregtheit und holt die Lady endgültig in eine symmetrische Kommunikation, indem sie ihre Hand anfasst, und sie verschafft sich einen großen Abgang durch den Hinweis auf ihren Selbstmord, der Folge einer Heirat der Lady mit Ferdinand sein werde.
Wieder allein, steht die Lady erschüttert und außer sich und endlich erwacht sie aus ihrer Betäubung. "Außer-sich-sein" und "Betäubung" gehen zusammen und beschreiben den Zustand eines Menschen, der etwas so Außergewöhnliches erlebt hat, dass eine tiefe Veränderung in ihm vorgeht, wenn er wieder bei sich ist. Die Lady ist einer kongenialen Gesprächspartnerin begegnet, ja, sogar einer, die das Gespräch überlegen gedreht hat, und nun beginnt sie mit sich selbst zu kämpfen, schrittweise ihre Erfahrungen zu verdauen : dem Bild einer verwahrlosten Bürgerdirne wird das der eigenen Ehre gegenübergestellt, aber schon mit der Einsicht, dass die eigene Ehre ein prahlende (s) Gebäude sei und dem Bürgermädchen höhere ( ) Tugend zukomme - der Komparativ macht nur Sinn, wenn die Lady selbst als Vergleichsmaßstab genommen wird. Der Zuschauer erlebt Lady Milford im Kampf mit sich selbst : Sie weiß, dass sie von Luisegetroffen wurde (und zu Recht), aber ihre Gestik zeugt noch von innerem Widerstand : Mit majestätischen Schritten auf und nieder. Wenn sie in dieser emotionsgeladenen Situation formuliert : Auch ich habe Kraft, entsagen, so spielt da noch eine gutesStück Trotz mit, und es bedarf einer Pause, bis sie lebhaft zu dem Entschluss kommt, ihr jetziges Dasein am Hofe aufzugeben, ihren Besitz zu verschenken und ein neues Leben anzufangen : Lady Milford ist nicht mehr. Und sie rechnet über einen Brief, der öffentlich gemacht werden soll, mit dem Herzog ab.
Der Zuschauer reibt sich verwundert die Augen : Lady Milford hat über Stufen der schrittweisen Entwicklung (Kammerdiener-Szene, Gespräch mit Ferdinand, Gespräch mit Luise)in ehrlicher Selbst-Reflexioneinen autonomen Entschluss gefasst, der zur (von Anfang an vertretenen) Forderung ihres Herzens viel besser passt als das Leben einer zum Objekt degradierten Hofmätresse. Das ist es, was oben die Formulierung "Erhebung aus einer lasterhaften Welt zu höchster Tugend" gemeint hat. "Autonomie" meint, sich selbst (auto) das Gestz (nomos) zu geben, also eine Handlung zu vollziehen nach einer Maxime, von der der Philosoph Kant wenige Jahre später in seinem "katego-rischen Imperativ" fordern wird, dass sie zugleich Prinzip einer allgemeinen Gesetzge- bung werden könne. Die Entscheidung der Lady ist - von der Form und vom Inhalt her - eine autonome Entscheidung; ihr Machtspiel, lange Zeit ganz anders strukturiert und ausgerichtet, ist durch die Begegnung mit anderen Machtspielen in der Lage, eine sinn- volle Konsequenz zu ziehen. Mit dieser Fähigkeit steht sie in diesem Schauspiel allein.
Lady Milfordist in dieser Konsequenz die einzigwirklich positiv besetzte Rolle inner- halb des Dramas. Soll dieses - aus Gründen der reinigenden Wirkung auf den Zuschauer - in einer Katastrophe enden, muss das auch so bleiben, und Schiller muss Lady Milford aus der weiteren Handlung entfernen.
VI. Über die Rezeption
Öffnen wir ein neues Schächtelchen und nennen wir Schiller einen Klassiker. Damit könnten wir zum einen seine Zugehörigkeit zur literarischen Epoche der Klassik aus- drücken wollen (eine Zuordnung, die Kabale und Liebe nicht gerecht wird) oder zum anderen die Eigenschaft des Textes als eines zeitlos gültigen (analog etwa zum Begriff der 'klassischen Mode'). Soll letztere Zuordnung zutreffen, so wäre am Text die Eigen- schaft nachzuweisen, dass er Leser zu ganz unterschiedlichen Zeiten etwas angeht. Über dieses "etwas" können wir im Sinne Schillers nun auch Genaueres feststellen : ein solcher Text hätte im Sinne einer therapeutischen Hilfestellung dem Leser "etwas zu sagen", ihm bei seiner Lebens-Bewältigung zu helfen oder gar ihn zu "heilen". Fragen wir in diesem Sinne nach, so stehen wir vor einer zweigeteilten Aufgabe : Wir haben die zeitgenössische Rezeption ebenso zu untersuchen wie unsere mögliche heutige.
VI.1 Die zeitgenössische Rezeption
Schiller will, so ist oben gezeigt worden, seine zeitgenössischen Zuschauer "am Zügel führen", er will sie in dem Sinne beeindrucken, dass dieser Ein-Druck Auswirkungen auf ihr Leben hat. Schillers Absicht in Ehren - aber wer sind seine Zuschauer ? Mannheim ist Residenzstadt, und die Zuschauer setzen sich in erster Linie aus dem Hofadel zusam- men. Der bevorzugt leichtere Kost, wie sie etwa die Stücke Ifflands bieten. Allerdings eröffnet sich gerade für das Theater eine Chance : Als Kurfürst Karl Theodor 1778 seine Residenz nach München verlegt (er will dort seine Erbschaft antreten), bestimmt er, dass das Schauspiel als wichtiger Wirtschaftsfaktor in Mannheim verbleiben soll. Mehr noch : dem Intendanten Dahlberg schwebt ebenso wie Schiller vor, aus der Mannheimer Bühne ein National-Theater zu machen, wie Lessing es Ende der sechziger Jahre vergebens in Hamburg versucht hat. Schillers Räuber haben mit ihrer vielbeachteten Aufführung einen verheißungsvollen Grundstein gelegt. Außerdem verspricht das in Mode gekommene Gen-re "bürgerliches Trauerspiel" große Aufmerksamkeit.
Schiller ist sich der Chance, aber auch des Wagnisses bewusst, ein Liebedrama zu einem Politikum zu machen. Er schreibt an Dalberg : Außer der Vielfältigkeit der Karaktere und der Verwiklung der Handlung , der vielleicht allzufreyen Satyre, und Verspottung einer vor-nehmen Narren- und Schurkenart hat dieses Trauerspiel auch diesen Mangel, daß komi-sches mit tragischem, Laune mit Schreken wechselt, und, ob schon die Entwiklung tragisch genug ist, doch einige lustige Karaktere und Situationen hervorragen.Wenn diese Fehler, die ich E.E. mit Absicht vorhersage, für die Bühne nichts anstößiges haben so glaube ich daß sie mit dem übrigen zufrieden seyn werden. (Brief vom 3. April1783) Das Problem liegt in der allzufreyen Satyre; Schiller attackiert höfische Gewalt,und er hat sich allein damit schon sehr weit vorgewagt. "Doch dass er seine Heldin, ansich ein frommes Mäd-chen, als wehrloses Opfer höfischer Schikanen so weit bringt, an der Gerechtigkeit der göttlichen Vorsehung zu zweifeln (III,6), war noch einmal stärkererTobak für viele seiner Zeitgenossen."102 Ohne Zweifel - es handelt sich um ein Drama derAufklärung : Der Arzt Schiller klärt seine Patienten (lat. 'pati' = leiden) auf, um den Weg zu bereiten für eine Heilung. Wie diese aussehen soll in Zeiten hemmungsloser struktureller Gewalt und absoluter Herrschaft, das versteht sich von selbst, das braucht Schiller nicht mehr darzu-stellen.
Ist die Reaktion des Publikums entsprechend ausgefallen ? Neben einigen positiven Rezensionen gibt es viel Kritik. Hans-Erich Struck fasst wie folgt zusammen : "Das Klein-bürgertum war an dem politischen Gehalt weniger interessiert und bevorzugte die bürger-lichen Rührstücke. Das Bildungsbürgertum hatte entweder grundsätzliche Vorbehalte, vergleichbar den Verrissen des Spätaufklärers Karl Philipp Moritz, oder störte sich an der verbliebenen Überhöhung durch die pathetische Sprache."103 Diese Einwände des Publi-kums kommen uns auchheute noch sehr bekannt vor : entweder überfordert der Inhalt oder es missfällt die Form.
Schauen wir uns die Rezension des angesprochenen Karl Philipp Moritz, eines späte- ren Mitstreiters der Klassiker Goethe und Schiller (!), vom 4. September 1784 an; sie schließt mit den Sätzen : "Das Rechten mit der Gottheit, das im Moment des höchsten Schmerzes wirklich etwas fürchterlich erhabenes und pathetisches hat, wird unsinnig abgeschmackt, wenn es so oft wiederholt wird, wie in diesem Stücke, wo es eine elende Zuflucht des Verfassers ist, der wenigstens durch das Gräßliche unser Gefühl betäuben will, da es ihm an der Kunst, das Herz zu rühren, gänzlich fehlt - so läßt er nun seinen Held bei jeder verliebten Grille, die er sich in den Kopf setzt, ausrufen - - Doch, ich bin endlich einmal müde, mehr Unsinn abzuschreiben. Bloß der Unwille darüber, daß ein Mensch das Publikum durch falsche Schimmer blendet, ihm Staub in die Augen streuet, und auf solche Weise den Beyfall zu erschleichen sucht, den sich ein Lessing und andre mit allen ihren Talenten, und dem eifrigsten Kunstfleiß kaum zu erwerben vermochten, konnte zu dieser ekelhaften Beschäftigung anspornen. - Nun sey es aber genug; ich wasche meine Hände von diesem Schillerschen Schmutze, und werde mich wohl hüten, mich je wieder damit zu befassen !"104 Harte Worte, dieSchiller getroffen haben werden; an der Kunst, das Herz zu rühren, fehle es ihm "gänzlich" (!) und er "erschleiche" sich den Beifall und wolle "das Ge-fühl betäuben"- das klingt ganz und gar nicht nach Aufklärung und auch nicht danach, dass die Patienten den Weg der Gesundung bereit sind zu gehen. Dieser Arzt wird bei seinen Patienten nochviel Überzeugungsarbeit zu leisten haben ...
VI.2 Mit heutigen Augen gelesen oder Kommunikation als Lebenskunst
Wenn das Drama Kabale und Liebe sich tatsächlich als "klassischer Text" erweisen möchte, so muss er uns Lesern und Zuschauern heute noch etwas Wesentliches zu sagen haben - oder weshalb sonst bringen wir diesen Text heute noch auf die Bühne oder in den Film, weshalb sonst wird er in den Abituranforderungen unserer Schulen verbindlich ge-macht ? Das ständisch geprägte Herrschaftsverhalten ist jedenfalls unser Thema nicht mehr, auch hat die religiöse Thematik ihre Sprengkraft verloren. Wovon, so ist zu fragen, sollen wir geheilt werden und was kann dieser Text dazubeitragen ?
Die Frage, wovon uns zu heilen eine Not-Wendigkeit sein solle, kann aber angesichts des Wahnsinns, der allabendlich über die Nachrichtensendungen in unsere Wohnzimmer schwappt, nur ein Ignorant stellen. Hatte man zu Schillers Zeiten noch die Hoffnung, durch eine Aufhebung der Standesschranken eine Besserung herbeiführen zu können, so wissen wir heute, dass Schranken ganz anderer Art im Wege stehen. Das, was oben bei der Bespre-chung der Kabalisten über eine falsch verstandene Aufklärung schon gesagt worden ist, hat sich in den 230 Jahren seitdem verabsolutiert. Jeder, der meint, einen Gedanken zu fassen, versucht heutediesen mit ego-manischer Zielsetzung gegen alle anderen zu behaupten. Wenn die Beschreibung des Thomas Hobbes, der Mensch sei dem Menschen ein Wolf und verantworte so den 'Krieg aller gegen alle', je zutreffend gewesen ist, so nicht am Ausgang des angeblich 'finsteren' Mittelalters, sondern heute.
Lassen wir sie also für einen Moment mal gelten, die utopische Forderung des Ernst Bloch : homo homini sit - der Mensch sei dem Menschen ein Mensch : "DennWahrheit, dies ernsteste Wort, ist mit dem Vorhandenen nicht erschöpft. Tausend Jahre Unrecht ma-chen keine Stunde Recht, tausendfach reproduzierter Krieg entwertet nicht, was ihn endlich aufheben will und könnte."105
Was will und - vor allem - was kann den Krieg106 aufheben ? Und was hat vor allem Schillers Text damit zu tun ? Darauf will und kann (und muss) ich als Leser im Sinne der "Theorie des unendlichen Textes" (s.o.) eine Antwort - meine Antwort - geben. Texte sind unfertig, wenn der Autor seinen Teil gegeben hat; der Leser "antwortet auf die Fiktion des Schreibers mit seiner Fiktion. Der Leser potenziert alsosie Fiktion."107 Ich wiederhole : ich muss (= ich bin aufgefordert zu) antworten.Andere mögen anders antworten und den Text Schillers anders lesen (dass es dabei nicht nur um Schillers Text, sondern um den "Text der Welt" geht, versteht sich von selbst) - das ist ja gerade das Faszinierende an den Lesarten, dass sie unterschiedlich ausfallen können. Wichtig ist nur, dass sie untereinander in einen offenen Dialog eintreten, und mit diesem offenen Dialog sind wir wieder bei unserem Thema, den Macht-Spielen, die Freiheit voraussetzen.
Beginnen wir den Dialog mit einem Blick in die Literatur; in dem von Benno von Wiese herausgegebenen Standardwerk "Das deutsche Drama" fasst der Germanist Wolfgang Bin-der am Ende seiner Analyse von "Kabale und Liebe" zusammen : DieTragödie sei "nicht in erster Linie eine Tragödie des Standesunterschieds oder des Mißtrauens oder der unbe-grenzten Liebe, sondern eine Tragödie des endlichen Menschen. Aus dem paradiesischen Sein der Idylle ins menschliche Dasein der Zeit geworfen, kann er das Ewige nur in sich bewahren und entsagen oder außer sich suchenund in Sünde fallen." Schillers Figuren wie Karl Moor, Karlos und eben auch Ferdinand "erstreben ein Glück, das eine göttliche Welt voraussetzt. Sie machen sich schuldig und geben der Welt ein gewisses Recht, sie zu ver-nichten"108.Soweit Binder.Bei allem Respekt vor der Analyse dieses Doyen der Germanis-tik und insbesondere der Hölderlin-Forschung sehe ich in diesen Zeilen die zeittypische, spät-existentialistische Interpretation der 50er Jahre, die Ideen, wie sie Ferdinand (an Schillers Statt) vertritt, nur als "paradiesisches Sein der Idylle" ansehen können. "Idylle" und "Paradies" verweisen als Termini auf eine nicht realisierbare Anmaßung, die dem "endlichen Menschen" (ins "Dasein der Zeit geworfen") nicht zukomme und die der "Welt ein gewisses Recht" gebe, "sie zu vernichten". Wer aber ist hier als "Welt" verstanden ? Und wer oder was hätte - in der Auseinandersetzung um Ideen oder andere Ansichten - je das Recht, jemanden zu vernichten ? Da kann ich gedanklich nicht folgen.
Wenden wir uns exemplarisch einer ganz anderen (wenn man Schubladen mag : wohl feministischen) Deutung des Stoffes zu. Sie thematisiert in zentraler Perspektive das Ver-hältnis von Mann und Frau in diesem Text. Als eine Fehl-Leistung der bürgerlichen Auf-klärung sieht sie die Übertragung des naturrechtlichen Modells vom Gedanken der natür-lichen Egalität der Menschen (alle Menschen sind von Natur aus frei) auf die (ebenso na-türlich verstandene) geschlechtliche Ungleichheit zur Zeit Schillers : "Jedes Individuum - männlich oder weiblich - konnte und solltenach Vollkommenheit streben, jedoch sei die-se Vollkommenheit je nach Geschlecht verschieden. (...) Ein Verstoß gegen das normierte Männlichkeits- und Weiblichkeitsideal war nunmehr nicht mehr allein ein Verstoß gegen gesellschaftliche Normen, sondern gegen Natur und Vernunft selbst."109 Diese Beschrei-bung, so pointiert einseitig sie auch formuliert sei, entbehrt nicht einer grundsätzlichen Berechtigung, wie Brigitte Wartmann in ihrer Untersuchung110 gezeigt hat oder wie es das Zitat selbst einesIdealisten wie Fichte vermuten lässt.111 Nun leben wir nicht mehr im aus-gehenden 18. /beginnenden 19. Jahrhundert; ich kann zwar nicht behaupten, dass sich in den meisten Köpfen seitdem Grundlegendes geändert habe, aber wir sind doch heute in der Lage, aus dem Naturrechts-Gedanken Konsequenzen ganz anderer Art zu ziehen. Wie wäre es mit der Überlegung, dass, wenn ich auf mein Naturrecht poche (dass alle Menschen von Natur aus gleich - und frei - sind), mir eine einfache Überlegung zeigt, dass dieses Recht nicht nur mir, sondern eben allen - und damit auch dem Anderen meiner selbst, dem Du - zukomme ? Hegel hat in seinem Satz des Selbstbewusstseins formuliert, dass mein Selbst-bewusstsein sich nur habe (= dass es sich seiner selbst bewusst werde), indem es sich in einem anderen Selbstbewusstsein spiegele, und dies geschehe durch wechselseitige Aner-kennung. Denn angenommen, ich würde dem Anderen die Anerkennung als gleich berech-tigt verweigern, etwa indem ich ihn als etwas Untergeordnetes ansähe, so würde ich mich selbst in ihm auch nur als Untergeordnetes spiegeln und erkennen können. (Diese Einsicht darf nun nicht zu der Fehleinschätzung führen, dass es darum gehe, dass eine Hand die an-dere wascheund ich aus reinem Nützlichkeitsinteresse den Anderen pro forma anerkenne - es geht hier um nichts weniger als um die Autonomie des Selbstbewusstseins, um die Freiheit meiner Selbstgewissheit, und da helfen utilitaristische Taschenspielertricks nicht weiter.
Wenn Karen Beyer nun in ihrer Interpretation darauf verweist, dass Ferdinands Fehlver- halten (wir haben es oben analysiert) als "Ersatz und Kompensation seiner Schwäche gegen- über der Welt des Vaters" anzusehen sei und dass er "zur Konstituierung seinesIchs" "der Dominanz und Macht über die Frau bedürfe", so greift dieser Ansatz zu kurz, denn das Ich kann sich auf diese Weise - folgt man Hegels Denkansatz (und ich folge ihm) - nicht konsti-tuieren. In der Folge dieser Überlegungen trifft auch Karen Beyers Konsequenz auf Luise nicht zu : "Um als seinEcho dienen zu können, muss Luise jeder Selbstheit enteignet zum selbstlosen Spiegelwerden, denn nur als Objekt, als Materie ohne Autonomie, kann sie den Mann 'rein',d.h. ohne störende Eigentlichkeit, reflektieren."112 Man(n) kann so denken, aber so denkt Mann eben falsch.
Ich habe diese beiden Interpretationsansätze ausgewählt, weil sie typisch sind für die Art von Schuldzuweisungen, wie sie in der Literatur vorkommen. Mal ist es dieHybris "des" Menschen, mal die des männlichen Menschen - ich könnte etliche andere hinzufügen. Schuldige gibt es immer und - wie wir bei Binder gesehen haben - schon ist von "Sünde" die Rede, und wo eine Sünde ist, da ist - je nach Stand-Punkt - auch schnell ein Sünden-Bock ausgemacht. Drehen wir (das wäre mein Vorschlag, meine Les-Art) den Spieß doch einmal um und verschärfen die idealistische Forderung nach selbstgewisser Autonomie (die Schiller in seinen frühen theoretischen Schriften entwickelt hat)sogar noch - nicht, indem wir uns zu einem göttlichen Wesen stilisieren wie in Schillers Theosophie des Julius, son-dern indem wir die Chancen unseres endlichen Mensch-Seins ausloten113, unsere "Werde-Lust"114 begreifen und mehr von uns erwarten, als wir bisher gewagt haben umzusetzen. Mehr auch, als Ferdinand und Luise in der Lage oder bereit waren einzusetzen. Der Fehler läge dann bei beiden Liebenden in ihrer Halbherzigkeit, darin, dass sie es nicht gewagt haben, ihre Idee konsequent zu denken und zu leben. Keine Hybris also und keine Sünde, sondern eher ein Versäumnis.
Das müsste nun ausgeführt werden; ich habe es an anderer Stelle getan und möchte michhier nicht wiederholen. 115 Wenn ich mir das Drama "Kabale und Liebe" ansehe, so bin ich Schiller dankbar für den Mut, seine Ideen der dramatischen Realität auszusetzen und aufzu-zeigen, woran sie scheitern. Sein Text i s t klassisch, weil ich auch heute noch, 230 Jahre später, mit ihm "etwas anfangen" kann. Habe ich eine solche gesellschaftsverändernde Idee, wie Schiller sie mit der Liebes-Religion hatte, bedarf sie einer entsprechenden Wahr-Neh-mung; habe ich diese Wahr-Nehmung, bedarf es des Mutes, sie zu leben und sie miteinander zu kommunizieren : Kommunikation als Lebenskunst. Davon ist oben (vgl. S. 6 der Arbeit) schon die Rede gewesen, da "Konflikte" als "eine der stärksten Antriebskräfte unserer Exis-tenz" bezeichnet wurden. Dazu bedarf es aber vor allem einer anderen Sprache als der heute geläufigen und vor-'herrschenden'. "Haß spricht" nennt Judith Butler ihr Buch. Das gibt die (vermutlich korrekte) Beschreibung einer bedenklichen Realität, die bestimmt wird durch eine utilitaristisch verformte und damit missbrauchte Sprache. Die "herrschende" Realität hataber nicht das letzte Wort. Wir dürfen andere Worte finden. Du sollst mir bleiben, Luise formuliert Ferdinandin der ihm eigenen possessiven Verblendetheit . Ich werde dir bleiben wäre die bessere, sich selbst in die Verpflichtung nehmende, autonome Formulierung.
VII. Epilog oder Die Autonomie der Iphigenie
Wer sich der Mühe nicht unterziehen möchte, meine oben angesprochenen Ausführungen über alternative Wege der Kommunikation und Interaktion (auf der Basis wechselseitiger Anerkennung) oder andere Beispiele aus der Fülle ähnlich gelagerter Beiträge zu studieren, der kann auch den Weg gehen, sich oben erwähntes Schauspiel, die Iphigenie von Goethe, anzusehen. Sie wird als "Drama der Autonomie" bezeichnet116. Was es mit der "Autonomie" auf sich hat, ist im Verlaufe der Arbeit geklärt worden. Sie besagt, dass ich es bin, der sein Leben selbst bestimmt (ich bin also voll ver-antwort-lich, ich habe, wie Guardini sagt117, auf - vor allem - ethische Fragen so zu antworten, "daß ich selbst in die Antwort hinein-komme"). Diese meine Antwort ist verpflichtet dem Blick auf den Anderen, dem die gleiche Autonomie zukommt. In dieser Verpflichtung liegt das Gesetz, das ich mir selbst gebe, der nomos.
Iphigenies Weg hat sie zu den Taurern verschlagen; dort hat sie als eine Art Asyl die Aufgabe einer Priesterin übernommen, die den Barbaren Ideen der Humanität zu vermitteln versucht. Eine dreifache Problematik bedrückt sie : sie lebt in der Fremde und hat Sehnsucht nach der Heimat (das Land der Griechen mit der Seele suchend), sie ist Frau (der Frauen Zustand ist beklagenswert) und sie wird vom König Thoas, dem gegenüber sie zu Dank verpflichtet ist, umworben. Dieser König, das zeigt sich hier schon, ist kein echter Gegen- spieler, da er ihr gewogen ist. Das trifft auch auf Orest, ihren Bruder, und dessen Freund Pylades zu, die als Fremde auf Tauris auftauchen, um eine Statue zu rauben, und dabei in der Gefahr stehen, getötet zu werden.
Jeder der vier Kontrahenten hat ein eigenes Machtspiel : Der König will Iphigenie zur Frau, und die drei Griechen suchen eine Möglichkeit, Tauris zu verlassen und nach Grie- chenland zurückzukehren (mit unterschiedlicher Begründung). Unter den Griechen kommt es zur Auseinandersetzung über die Methode des Vorgehens. Pylades nimmt die typisch utilitaristisch-konstruktivistische Haltung ein : Ich habe ein Interesse, denn ich habe einen Auftrag, und wenn ich den erfülle, ist jede Art meines Handelns gerechtfertigt (der Zweck heiligt die Mittel). In seinen Augen ist langes Zögern und Nach-Denken falsch : Es bedarf hier schnellen Rat und Schluss. Dieses Vorhaben setzt Iphigenie in einen moralischen Konflikt - sie hat eigene Interessen, sieht auch die des Bruders und seines Freundes, und nicht zuletzt fühlt sie sich König Thoas gegenüber verpflichtet. Und sie beginnt nach-zu- denken; sie kämpft, nicht mit einem äußeren Gegner, sondern mit sich selbst : O bleibe ruhig, meine Seele / Beginnst du nun zu schwanken und zu zweifeln ? Und : O trüg ich doch ein männlich Herz in mir / Das, wenn es einen kühnen Vorsatz hegt / Vor jeder an- dern Stimme sich verschließt.
Der kühne Vorsatz meint die heimliche Flucht, zu der Pylades nachdrücklich auffordert; die andre Stimme ist die des eigenen Gewissens, des eigenen Herzens. Und Iphigenie hört auf letztere : Sie spricht nicht, wie von Pylades gefordert, dem König gegenüber das kluge ( = das hinterlistige) Wort - sie entscheidet sich für das wahre Wort und gibt den Plan der Flucht vor dem König preis. Sie kann, sie will nicht anders : Allein mein eigen Herz ist nicht befriedigt. Das verteufelt Humane (und damit Undramatische) an diesem Schauspiel (wie Goethe sich ausdrückt) liegt darin, dass die Kontrahenten ihre je eigenen Machtspiele haben, diese aber nicht um jeden Preis durchsetzen wollen, sondern bereit sind, sich mit den Machtspielen der Anderen ernsthaft auseinanderzusetzen und sich - wie es oben genannt wurde - an ihnen "abzuarbeiten". Es wäre für König Thoas ein Leichtes gewesen, seine Herrschaft auszuspielen; er aber, der Barbar, erweist sich als human (was nichts anderes meint, als dass er dialogfähig ist und sich, wie Gadamer es formuliert, "etwas sagen lässt") und lässt die Griechen gehen. (Diese untragische Lösung bestätigt noch einmal, dass es - bei entsprechender Wahr-Nehmung und daraus folgender Reflexion - auch für die Prota-gonisten im Schauspiel Kabale und Liebe eine Lösung jenseits der Tragödie gegeben hätte.)
Wer dieses Musterbeispiel einer gelungenen symmetrischen Kommunikation als reali- tätsfern abtut, der mag seine Gründe dafür haben. Er muss sich aber auch bewusst sein, dass er mit ihrer Vorgehensweise die einzig mögliche Lösung jeglichen Problems im Sinne einer Versöhnung ablehnt. Rousseau spricht für den Fall des Gelingens eines Diskurses von derNot-Wendigkeit der "vertu", der Tugend, die darin besteht, bereit zu sein, den Anderen zu hören, ihn zu verstehen und sich offen mit ihm auseinanderzusetzen. Das - und nichts anderes - ist gemeint, wenn oben von einem Weg einer "alternativen Sprach-Performanz" die Rede war (siehe S. 16). Luise und Ferdinand hätte sich der Horizont der Utopie eröff- net.
Sehe ich mich in meiner Umwelt um, so muss ich befürchten, dass etliche meiner Mit- Bürger schon nicht über die hinreichende Sprach-Kompetenz, die für ein solches Vorgehen nötig wäre, verfügen. Damit fehlt die Basis für eine Verhaltensänderung im Sinne autono-mer Entscheidungen. Darauf setzt sich als weitere Hürde der Unwille, die Sprach-Perfor-manz im Sinne der rousseauschen "vertu" oder der der Humanität nach Goethe und Herder zu üben (das Üben setzt ein Studium, ein Sich-Bemühen voraus). - So einfach liegen die Dinge, und wir tun uns doch so schwer.
Es gibt keinen Weg vorbei an der Persönlichkeitsbildung, an rationalen Modellen der Konfliktlösung, das heißt auch an der Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit Anders- denkenden und, selbstverständlich, Andersgeschlechtlichen.
(Christa Wolf, Dritte Vorlesung)
Anmerkungen
Quellentexte
Abel, Jakob Friedrich : Eine Quellenedition zum Philosophieunterricht an der Stutt- garterKarlsschule (1773 - 1782); hrg. von Wolfgang Riedel, Würzburg1995
Goethe, Johann Wolfgang : Iphigenie auf Tauris (zit. nach der Reclam-Ausgabe)
Schiller, Friedrich : Werke und Briefe in zwölf Bänden. Frankfurt / Main 1988 f. (DeutscherKlassiker-Verlag)
Die Zitate aus Kabale und Liebe folgen der Reclam-Ausgabe.
Literatur
Bergen, Ingeborg : Biblische Thematik und Sprache im Werk des jungen Schiller. Einflüsse des Pietismus. Dissertation Mainz 1967
Beyer, Karen : "Schön wie ein Gott und männlich wie ein Held". Zur Rolle des weiblichen Geschlechtscharakters für die Konstituierung des männ- lichenAufklärungshelden in den frühen Dramen Schillers. Stuttgart 1993
Binder, Wolfgang : Friedrich Schiller. Kabale und Liebe. in : von Wiese, Das deutsche
Drama, Düsseldorf 1958 und später, Band I, 250 - 270
Bovenschen, Silvia : Die imaginierte Weiblichkeit. Exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Präsentationsformen des Weiblichen. Frankfurt / Main 1980
Butler, Judith : Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Hamburg 1998
Dahnke, Hans-Dietrich / Lutz Vogel : Die hohe Tragödie im bürgerlichen Trauerspiel :
"Kabale und Liebe". in : Schiller. Das dramatische Werk in Einzel- interpretationen. Leipzig 1982, 64-88
Duden, Barbara : Das schöne Eigentum. Zur Herausbildung des bürgerlichen Frauenbil- des an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert; in : Kursbuch 47, 1977, 125-140
Foucault, Michel : Analytik der Macht. stw. 1759, 2005
Foucault, Michel : Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit; in : Foucault, Ästhetik der Existenz. stw 1814, 2007
Frey, Hans-Jost : Der unendliche Text. Frankfurt am Main 1990
Galtung, Johan : Strukturelle Gewalt. Beiträge zur Friedens- und Konfliktforschung. Hamburg 1975
Hamburger, Käte : Schiller und Sartre. in : Jahrbuch der Deutschen Schiller-Gesellschaft Band III, 1959, 34-70
Herrmann, Hans Peter : Musikmeister Miller, die Emanzipation der Töchter und der dritte Ort der Liebenden; in : Jahrbuch der Deutschen Schiller- gesellschaft 28, 1984, 223 - 247
Herrmann, Hans Peter / Herrmann Martina : Friedrich Schiller. Kabale und Liebe, Frankfurt / Main 1987
Janz, Rolf-Peter : "Kabale und Liebe" als bürgerliches Trauerspiel. in : Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft 20, 1976, 208 - 228
Koch, Ulrike : Sprache und Gewalt in den dramatischen Texten der Wiener Gruppe. Diplomarbeit Wien 2010
Kondylis, Panajotis : Die Entstehung der Dialektik. Eine Analyse der geistigen Entwick- lung von Hölderlin, Schelling und Hegel bis 1802. Stuttgart 1979
Mollowitz, Bernd : Eigen-Sinn : Mut zu Wahr-Nehmungen. München 2011
Mollowitz, Bernd : Schiller als Philosoph in der Auseinandersetzung mit Kant. München 2008
Mollowitz, Bernd : Vagabundierendes Denken in einer schraubenförmigen Welt. München 2013
Mollowitz, Bernd : Vagabundierendes Erräumen. 2014 (unter www.philosophersonly.de)
Müller-Seidel, Walter : Das stumme Drama der Luise Millerin. in : Goethe. Neue Folge des Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft 17, Weimar, 1955, 91-103
Pfister, Manfred : Das Drama. München 1977
Pikulik, Lothar : Der Dramatiker als Psychologe. Figur und Zuschauer in Schillers
Dramen und Dramentheorie. Paderborn 2004
Rasch, Wolfdietrich : Goethes Iphigenie auf Tauris als Drama der Autonomie. München 1979
Riedel, Wolfgang : Die Anthropologie des jungen Schiller. Zur Ideengeschichte der medizinischen Schriften und der 'Philosophischen Briefe'. Würzburg 1985
Riedel, Wolfgang : Friedrich Schiller : Kabale und Liebe, oder was alles Liebe genannt wird. in : Programmheft der Ludwigsburger Schlossfestspiele 2009 (hier in der überarbeiteten Internet-Fassung)
Roßbach, Nikola : "Das Geweb ist satanisch fein". Friedrich Schillers Kabale und Liebe als Text der Gewalt. Würzburg 2001
Safranski, Rüdiger : Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus. München Wien 2004
Struck, Hans-Erich : Friedrich Schiller. Kabale und Liebe. Oldenbourg Interpratation 44, München 19982 Sutermeister, Hans-Martin : Schiller als Arzt. Ein Beitrag zur Geschichte der psycho- somatischen Forschung. Bern 1955
[...]
1 Friedell, Egon : Kulturgeschichte der Neuzeit. München 1927 f., hier 1965, 59/60
2 Blöcker, Günter : Heinrich von Kleist oder Das absolute Ich. Berlin 1960, 21
3 Zu ergänzen ist - vor allem hinsichtlich der Aufführungspraxis - der synästhetische Aspekt des Textes durch die nicht nur sprachlichen, sondern auch außer-sprachli- chen akustischen und optischen Codes; vgl. hierzu Pfister 1977, 25
4 Goethe an Schiller 19. Januar 1802
5 vgl. Frey 1990
6 Brunner / Conze / Koselleck : Geschichtliche Grundbegriffe. Stuttgart 1972 f., Band 3, 817
7 Weber, Max : Wirtschaft und Gesellschaft. 1921, hier Tübingen 1972, 21
8 Foucault : "Das Wort 'Spiel' kann Sie zu einem Irrtum führen. Wenn ich von 'Spiel' spreche, dann spreche ich von einer Gesamtheit von Regeln zur Herstellung der Wahrheit."
9 Da sich dieses Spiel innerhalb von 'Gesellschaft' vollzieht und diese eine vom Men- schen geschaffene künstliche Institution darstellt, meint "natürlich" hier eine Eigen- schaft, die der Mensch als - auch in der Gesellschaft unaufgebbar - aus seiner natür- lichen Ausstattung mitbringt.
10 vgl. Mollowitz 2011
11 Foucault 2007, 267
12 Foucault 2005, 256
13 Foucault 2005
14 Foucault 2007, 272
15 Foucault 2007, 277
16 Foucault 2005, 255 f.
17 Historisches Wörterbuch der Philosophie (Hrg. Joachim Ritter), Darmstadt 1974, Band 3, 570
18 Galtung 1975, 9
19 ebd. 115
20 ebd. 116
21 Laut Käte Hamburger werfen Schiller als der "Existentialist des Idealismus" und Sartre als der "Idealist des Existentialismus" Licht aufeinander. (vgl. hierzu Käte Hamburger 1959, 48)
22 Die Eltern waren "entschiedene Pietisten". vgl. Bergen, 1967, 41
23 Wer eine detaillierte Text-Analyse sucht, ist bei Riedel 1985 sehr gut aufgehoben; wer Schillers Gedanken in der Vorarbeit des Deutschen Idealismus einschätzen möchte, findet kurze, aber grundlegende Hinweise bei Kondylis 1979.
24 vgl. hierzu Sutermeister 1955
25 zitiert nach Riedel 1985, 12
26 vgl. die von Riedel herausgegebene Quellenedition zu Abel
27 Kondylis spricht dementsprechend von Schillers "entscheidende(r) Rolle bei der Vermittlung der neuen optimistischen Anthropologie"; Kondylis 1979, 23
28 Johann Karl Wezel (1747 - 1819) in seinem "Versuch über die Kenntniß des Menschen", hier zit. nach Riedel 1985, 15
29 Kondylis 1979, 24
30 ebd. 32
31 Schiller, Band 8, 39
32 ebd. 37
33 "Als fatale Kehrseite der Substanzentrennung, deren philosophischer Gewinn in der 'klaren und deutlichen' ontologischen Differenzierung besteht, zeigt sich auf dem Feld der Anthropologie das Unvermögen, die offenbare 'Gemeinschaft' der als ein- ander inkompatibel entworfenen Substanzen im Menschen und die als Wirkungs- zusammenhang erfahrene Korrelation von somatischen und psychischen Ereignissen zu erfassen." Riedel 1985, 63
34 ebd. 41 (Dissertation Philosophie der Psychologie)
35 ebd. 41/42
36 Diese sind 1786 erschienen, doch sind deren Teile entstehungsgeschichtlich unein- heitlich; die Theosophie beispielsweise ist ein Produkt noch der Stuttgarter Zeit. Es ist daher statthaft, sie als ein Zeugnis der Welt-Anschauung Schillers zu dieser Zeit zur Interpretation unseres Textes heranzuziehen.
37 vgl. Anmerkungen Schiller, Band 8, 1266
38 "Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, daß bei ihrem Entwurf (gemeint ist die Figur des Raphael; B.M.) die dem jungen Schiller wohlbekannte Forderung der zeitge- nössischen Medizin und Anthropologie, der Arzt müsse zugleich ein Philosoph und der Philosoph auch ein Arzt sein, Pate stand." Riedel 1985, 213
39 aus : Abel, Ausführliche Darstellung des Grundes unseres Glaubens an Unsterb- lichkeit, zit. bei Riedel 1985, 174
40 Zitate aus der Theosophie des Julius
41 )) Zitate aus den Julius-Briefen
42 zit. bei Kondylis 1979, 24 (Anmerkung)
43 Brief vom 14. April 1783, Band 11, 70 f.
44 ebd. 69
45 Safranski 2004
46 Göpfert V,502
47 Schiller, Wallensteins Lager, Prolog
48 in : "Götzen-Dämmerung, Streifzüge eines Unzeitgemäen, Aph. 1
49 vgl. hierzu Hermann / Hermann 1987
50 ebd.
51 Abel 1995, 293 f.
52 Riedel 2009
53 vgl. Pikulik 2004, 12
54 Schiller, Band 8, 185
55 ebd. 200
56 Pikulik 2004, 317
57 Schiller, Band 8, 194
58 Schiller, Band 1, 558
59 Wer sich mit diesem Aspekt ausführlicher beschäftigen will, ist bei Roßbach 2001 gut aufgehoben.
60 Koch 2010, 6
61 Roßbach 2001, 11
62 ebd. 12
63 vgl Butler 1998
64 Christa Wolf hat sich in ihren "Frankfurter Vorlesungen" mit dem Phänomen der "Objektivierung" auseinandergesetzt : "Das Objektemachen : Ist es nicht die Haupt- quelle von Gewalt ?" (3. Vorlesung, Meteln, 1. Mai 1981)
65 vgl. zu diesem Thema Mollowitz 2013
66 beide Zitate : Koch 2010, 17
67 Pikulik 2004, 97 u. 99
68 Schiller in einem Brief an Körner vom 25. Februar 1789 : Meine Ideen sind nicht klar, eh ich sie schreibe.
69 Roßbach 2001, 12/13
70 ebd. 14
71 Pikulik 2004, 31
72 Schiller, Band 8, 154
73 Pikulik 2004, 31
74 Pikulik 2004, 12
75 Pikulik 2004, 87/88 u. 93
76 vgl. hierzu Beyer 1993, 206 ff
77 vgl. Janz 1976, 217
78 vgl. Roßbach 2001, 19
79 Abel 1995, 203
80 Müller-Seidel, 1955
81 ebd., 100
82 "Stummheit (betrifft Luise - B.M. )und monologisches Sprechen (betrifft Ferdi- nand) als zwei Formen von Sprachnot" zitiert bei Roßbach 2001, 26; hier findet sich auchder Hinweis auf den Terminus "Beziehungsblindheit" bei Watzlawick
83 ebd., 102 / 103
84 Schiller, Band 2, 1413
85 Beyer 1993, 305
86 ebd. 315
87 vgl. hierzu Roßbach 2001, 21
88 Herrmann 1984, 226
89 Ich folge hierbei im Wesentlichen den Ausführungen von Beyer, 1993, Duden 1977und Bovenschen 1980.
90 Duden 1977, 243
91 vgl. hierzu : Ulrich Hommes, Brauchen wir die Utopie ? Plädoyer für einen in Mißkredit geratenen Begriff; in : Aus Politik und Zeitgeschichte (Veröffent- lichung der Bundeszentrale für politische Bildung) 1977, B 20
92 Duden a.a.O.
93 Beyer 21
94 Janz 1976, 227
95 vgl. hierzu Beyer 1993, 230 ff
96 ebd. 245
97 ebd. 240
98 Struck 1998, 17 / 18
99 Roßbach 2001, 68
100 vgl. Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie. Zwölf Radiovorträge. München, zuerst 1953
101 Dahnke 1982, 85
102 Riedel 2009
103 Struck 1998, 73
104 zitiert nach Hans Henning, Schillers 'Kabale und Liebe' in der zeitgenössischen Rezeption, Leipzig 1985, 185
105 Ernst Bloch, Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buch- handels, 1967
106 "Krieg" ist hier im umfassenden Sinne verstanden, wie es Ingeborg Bachmann in ihrem Roman "Malina" zeigt : "Malina : Warum denkst du immer noch 'Krieg und Frieden' ? / Ich : Es heißt aber so, weil eines auf das andere folgt, ist es nicht so ? / Malina : Du mußt nicht alles glauben, denk lieber selber nach. / Ich : Ich ? / Malina : Es gibt nicht Krieg und Frieden. / Ich : Wie heißt es dann ? / Malina : Krieg."
107 Martin Walser in seiner Rede"Über den Leser - soviel man in einem Festzelt darüber sagen soll" (1977)
108 Binder 1958, 270
109 Beyer 1993, 25/26
110 Brigitte Wartmann, Die Grammatik des Patriarchats. Zur 'Natur' des Weiblichen in der bürgerlichen Gesellschaft.in : Herrschaftsformen des Patriarchats. Disserta- tion Berlin 1986
111 Fichte : "Im unverdorbenen Weibe äußert sich kein Geschlechtstrieb, und wohnt kein Geschlechtstrieb, sondern nur Liebe; und diese Liebe ist der Natutrieb des Weibes, einen Mann zu befriedigen." (zit. nach Beyer, 1993, Anm. 73)
112 Beyer 193, 311 u. 307; dort findet sich auch ein Zitat aus einer Arbeit von Cornelia Klinger, das höchst anspruchsvoll formuliert daherkommt, die Sache aber nicht trifft : "Das Weibliche wird zum Objekt einer absoluten Negation, um von nun an als jungfräulicher Spiegel jeder positiven Selbst-Reflexion ... die Pro- liferation der Phantasien desjenigen (zu) garantieren, der in und durch diese Ope- ration 'männliches' Subjekt wird. Aber sie wird sich von nun an nicht mehr wie- derfinden." Wir dürfen hinzufügen : auf diese Weise wird auch das männliche Subjekt sich nicht finden, höchstens als selbstgebastelten Spiegel der Inferiotät.
113 Mein Verständnis von "Ausloten" habe ich in meiner Arbeit über das "vagabun- dierende Denken in einer schraubenförmigen Welt" ausformuliert.
114 vgl. Mollowitz 2011
115 siehe Mollowitz 2013 und 2014
116 vgl. Rasch, 1979
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Inhaltsverzeichnisses?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Kapitel und Unterkapitel der Analyse auf, darunter "Little boxes", "Zur Begrifflichkeit", "Schillers Intention", "Schillers Methode", "Interpretation Schiller, Kabale und Liebe", "Über die Rezeption" und "Epilog oder Die Autonomie der Iphigenie".
Was ist die Bedeutung des Abschnitts "Little boxes"?
Dieser Abschnitt befasst sich mit der menschlichen Neigung, die Welt in Kategorien und Schubladen einzuteilen, und der Einschränkung, die dadurch für das Verständnis entstehen kann. Es wird die Dreiteilung der fiktionalen Texte in "Epik", "Lyrik" und "Dramatik" als Beispiel genannt.
Wie definiert der Text "Macht" und "Herrschaft"?
Der Text grenzt die Begriffe "Macht" und "Herrschaft" von landläufigen Auffassungen ab. "Macht" wird im Sinne Foucaults als ein natürliches Spiel im menschlichen Zusammenleben verstanden, während "Herrschaft" als eine Blockierung dieses Spiels durch verfestigte Strukturen gesehen wird.
Was ist Schillers "Soll-Zustand" und wie hängt er mit seiner medizinischen Ausbildung zusammen?
Schillers "Soll-Zustand" bezieht sich auf seine philosophischen Ideale, die durch seine medizinische Ausbildung beeinflusst wurden. Er plädiert für eine ganzheitliche Sicht des Menschen, die Körper und Geist in Einklang bringt, und kritisiert den Dualismus von Descartes.
Welche Methode wendet Schiller in seinen Werken an?
Schiller wird oft als Idealist bezeichnet, der dem Geist den Primat einräumt. In seinen Dramen wie "Kabale und Liebe" setzt er sich kritisch mit den Widersprüchen zwischen Selbst- und Fremdbestimmung auseinander und politisiert das bürgerliche Trauerspiel.
Wie werden Ferdinand und Luise im Drama interpretiert?
Ferdinand wird als ein idealistischer Held dargestellt, der jedoch in seinen Handlungen von seinem Standesbewusstsein geprägt ist. Luise wird als eine reflektierte Persönlichkeit gezeigt, die jedoch unter dem Druck der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Erwartungen ihres Vaters leidet.
Welche Rolle spielt Miller, Luises Vater, in der Geschichte?
Miller wird als ein kleinbürgerlicher Vater dargestellt, der seine Tochter als eine Art "lebende Versicherung" betrachtet und seine patriarchale Macht durch die christliche Religion zu sichern versucht. Er ist weniger am Wohlergehen seiner Tochter interessiert als an der Sicherung seines eigenen Herrschaftsbereichs.
Wer sind die Kabalisten und welche Rolle spielen sie?
Die Kabalisten, bestehend aus dem Fürsten/Herzog, dem Präsidenten und Wurm, fungieren als Gegenspieler im Drama. Ihre Machtspiele sind von Herrschaftsansprüchen geprägt und tragen zur Beschleunigung des dramatischen Verlaufs bei.
Wie wird Lady Milford charakterisiert und welche Entwicklung durchläuft sie?
Lady Milford wird zunächst als Mätresse dargestellt, die ihr Herz frei behalten hat. Durch die Begegnung mit Luise durchläuft sie eine Wandlung und fasst den autonomen Entschluss, ihr Leben am Hof aufzugeben und ein neues Leben anzufangen.
Wie wurde "Kabale und Liebe" von Schillers Zeitgenossen aufgenommen?
Die zeitgenössische Rezeption war gemischt. Einige lobten die Vielfalt der Charaktere und die Verwicklung der Handlung, während andere die freie Satyre, die Vermischung von Komischem und Tragischem und die pathetische Sprache kritisierten.
Welche Bedeutung hat "Kabale und Liebe" für heutige Leser und Zuschauer?
Der Text kann auch heute noch relevant sein, indem er zur Reflexion über zwischenmenschliche Beziehungen, Machtspiele und die Notwendigkeit einer authentischen Kommunikation anregt. Er erinnert daran, dass Ideale allein nicht ausreichen, sondern auch eine entsprechende Wahrnehmung, Mut zur Umsetzung und Offenheit für den Dialog erforderlich sind.
Was ist der Epilog "Die Autonomie der Iphigenie"?
Der Epilog verweist auf Goethes Drama "Iphigenie auf Tauris" als ein Beispiel für gelungene symmetrische Kommunikation und autonome Entscheidungsfindung. Er betont die Bedeutung von Tugend, Humanität und der Bereitschaft, sich mit Andersdenkenden auseinanderzusetzen.
- Quote paper
- Bernd Mollowitz (Author), 2015, Foucaults Theorie der Machtspiele in der Anwendung auf das Drama am Ausgang des 18. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/299114