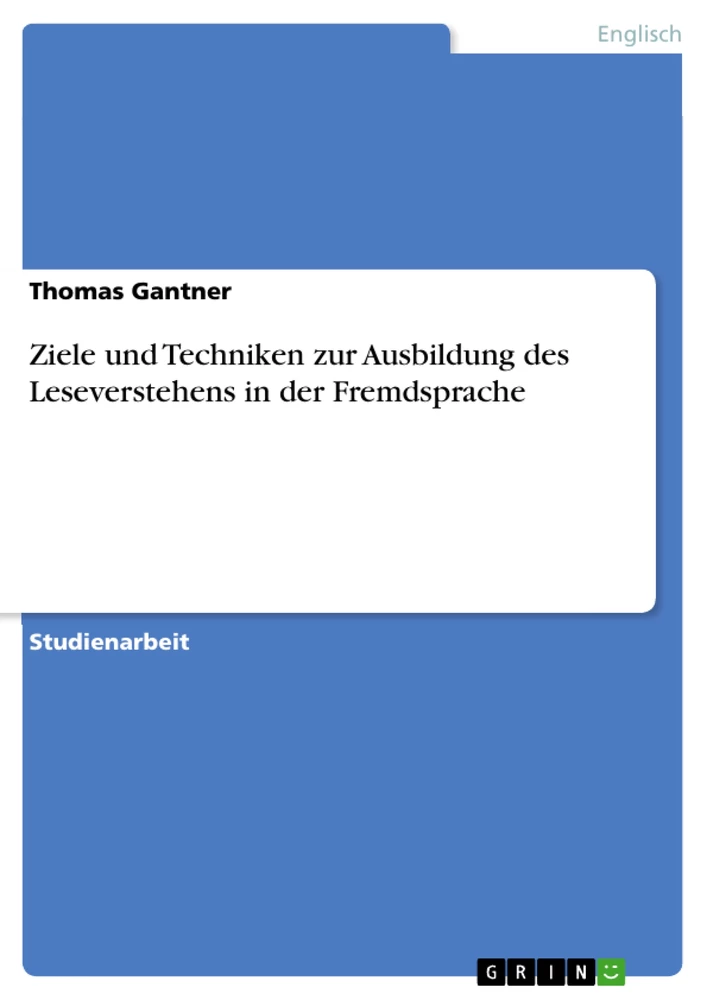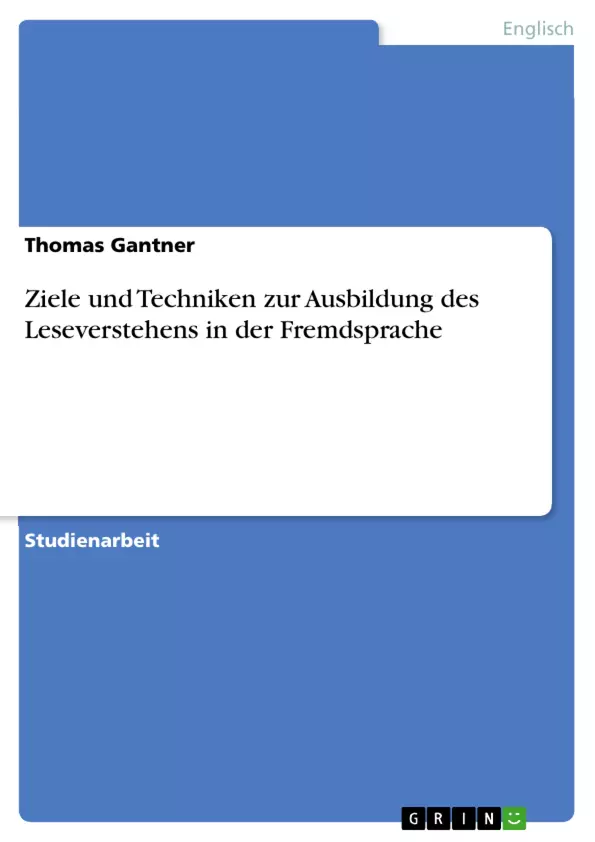In meiner folgenden Arbeit möchte ich besonders auf das Lesen im fremdsprachlichen Unterricht eingehen, da hier Kinder besonders auf die Leseerfahrung in der Muttersprache zurückgreifen. Das Lesen ist somit erschwert, da Wortstellungen ungewohnt sind und ein Großteil des Vokabulars stark von der Muttersprache abweicht.
Erfolg des Lesens in der Muttersprache, die semantisch und syntaktisch kaum von der Fremdsprache abweicht, führt im Normalfall auch zu Erfolg in der Zielsprache. Ich werde außerdem Übungen darstellen, mit denen man verschiedene Lesetechniken ausbilden kann.
Die Fertigkeit des Lesens wird im Gegensatz zum Hörverstehen bewusst erworben und muss automatisiert werden, um über den Akt des Lesens und Verstehens hinauszugehen (Interpretation, Hypothesen anstellen).
Es besteht aber wie beim Hörverstehen eine Interaktion zwischen Text und Leser, denn um einen Text zu verstehen und mit ihm arbeiten zu können, müssen Fragen gestellt und Hauptaussagen erschlossen werden. Der Leser beeinflusst sein Lesetempo selbst, während beim Hören kein Einfluss auf den Sprecher möglich ist.
Ein Text interagiert weiterhin mit dem Leser, indem die Schwierigkeit des Texts und das vorhandene Vorwissen (unbekanntes Vokabular, grammatische Formen, Satzstellung) den Leser in Bezug auf das Verständnis des Texts beeinflusst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Funktion des Lesens im fremdsprachlichen Lernen
- Ziele der Ausbildung des Leseverstehens
- Übungen zur Ausbildung von Lesetechniken
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Ausbildung des Leseverstehens im fremdsprachlichen Unterricht, insbesondere im Englischunterricht. Sie analysiert die Bedeutung des Lesens für den Spracherwerb und stellt verschiedene Übungen zur Entwicklung von Lesetechniken vor.
- Die Bedeutung des Lesens im fremdsprachlichen Lernen
- Die Herausforderungen des Lesens in der Fremdsprache
- Ziele der Ausbildung des Leseverstehens
- Verschiedene Lesetechniken und ihre Anwendung im Unterricht
- Die Rolle von stillen und lauten Lesen in der Entwicklung des Leseverstehens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Ausbildung des Leseverstehens im fremdsprachlichen Unterricht ein. Sie betont die Bedeutung des Lesens für den Spracherwerb und die Herausforderungen, die mit dem Lesen in der Fremdsprache verbunden sind.
- Funktion des Lesens im fremdsprachlichen Lernen: Dieses Kapitel untersucht die verschiedenen Funktionen des Lesens im fremdsprachlichen Unterricht. Es wird die Bedeutung des Lesens für den Erwerb von Wissen, das Verstehen von Texten und die Entwicklung von Kommunikationsfähigkeiten hervorgehoben.
- Ziele der Ausbildung des Leseverstehens: Dieses Kapitel definiert die Ziele der Ausbildung des Leseverstehens im fremdsprachlichen Unterricht. Es werden verschiedene Aspekte des Leseverstehens, wie zum Beispiel das Erkennen von Schlüsselinformationen, das Verständnis von Textstrukturen und das Interpretieren von Texten, behandelt.
- Übungen zur Ausbildung von Lesetechniken: Dieses Kapitel stellt verschiedene Übungen zur Ausbildung von Lesetechniken vor. Es werden sowohl Übungen für das stille Lesen als auch für das laute Lesen vorgestellt, die dazu beitragen, die Lesekompetenz der Schüler zu verbessern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung des Leseverstehens im fremdsprachlichen Unterricht. Dabei werden wichtige Themen wie Lesetechniken, stilles und lautes Lesen, Textverständnis und die Bedeutung von Vorwissen im Fokus der Analyse stehen. Die Arbeit greift auf verschiedene didaktische Ansätze zurück, um die Ausbildung des Leseverstehens zu fördern.
Warum ist das Lesen in einer Fremdsprache schwieriger?
Ungewohnte Wortstellungen, abweichendes Vokabular und die Interaktion zwischen unbekannter Grammatik und Textinhalt erschweren das Verständnis im Vergleich zur Muttersprache.
Welche Ziele verfolgt die Ausbildung des Leseverstehens?
Ziele sind das Erkennen von Schlüsselinformationen, das Verständnis von Textstrukturen sowie die Fähigkeit zur Interpretation und Hypothesenbildung.
Was unterscheidet Hörverstehen von Leseverstehen?
Beim Lesen kann der Leser sein Tempo selbst bestimmen und mit dem Text interagieren, während beim Hören kein Einfluss auf die Sprechgeschwindigkeit möglich ist.
Welche Rolle spielt das stille versus das laute Lesen?
Die Arbeit stellt Übungen für beide Formen vor, um unterschiedliche Lesetechniken auszubilden und die Lesekompetenz zu automatisieren.
Wie beeinflusst Vorwissen den Leseerfolg?
Erfolg in der Muttersprache und vorhandenes Wissen über syntaktische Strukturen fördern das Verständnis in der Zielsprache (z. B. Englisch).