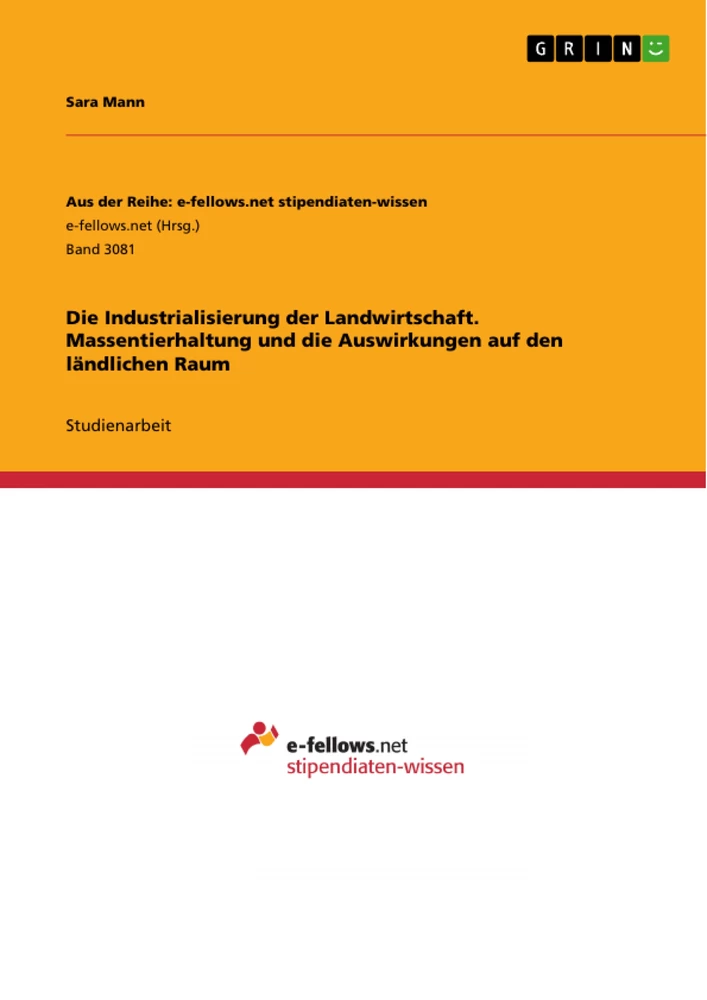In der vorliegenden Hausarbeit sollen, nach einem kurzen historischen Abriss der wichtigsten Fortschritte im Agrarbereich, vor allem die aktuellen Produktionsmethoden und ihre gegenwärtigen Auswirkungen geschildert werden.
Ein Schwerpunkt wird dabei auf Folgen für den ländlichen Raum sowie auf flächenunabhängiger Großbestandshaltung („Massentierhaltung“) liegen.
Eine weitere damit verbundene Entwicklung wird aufgrund der Brisanz der Thematik gesondert behandelt werden: Die Rolle von Großkonzernen in der Lebensmittelerzeugung.
Ergänzend dazu soll auf die Problematik eingegangen werden, dass das Idealbild des traditionellen Mischbetriebs trotz des umfassenden Wandels im Agrarsektor, einhergehend mit wachsendem Konsum von agrarischen Produkten bei gleichzeitigem Preisverfall, noch nicht aus unserer Vorstellung von Landwirtschaft verschwunden ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politisch und historisch bedeutsame Etappen für die Entwicklung der Landwirtschaft
- Neolithische Revolution
- Feudale Landwirtschaft, Agrarreformen und Bauernbefreiung
- Industrielle Revolution
- Agrarpolitik nach dem 1. Weltkrieg
- Kennzeichen und Methoden der industriellen Landwirtschaft
- Merkmale industrieller Agrarbetriebe
- Methoden industrieller Agrarbetriebe
- Massentierhaltung
- Auswirkungen der Industrialisierung der Landwirtschaft
- Umwelt
- Lebensmittelversorgung
- Einflussnahme von Agrarunternehmen
- Folgen für den ländlichen Raum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beleuchtet die Industrialisierung der Landwirtschaft und ihre Auswirkungen, insbesondere auf den ländlichen Raum und die Massentierhaltung. Im Fokus steht die Darstellung der aktuellen Produktionsmethoden sowie deren Folgen für die Umwelt, die Lebensmittelversorgung und die Rolle von Großkonzernen in der Lebensmittelproduktion.
- Historische Entwicklung der Landwirtschaft
- Kennzeichen und Methoden der industriellen Landwirtschaft
- Auswirkungen der Industrialisierung auf die Umwelt und die Lebensmittelversorgung
- Die Rolle von Agrarunternehmen
- Folgen für den ländlichen Raum
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Industrialisierung der Landwirtschaft ein und erläutert die Relevanz dieser Entwicklung für den menschlichen Lebensraum. Sie stellt die zentralen Themen der Hausarbeit dar und skizziert die Forschungsfrage.
Politisch und historisch bedeutsame Etappen für die Entwicklung der Landwirtschaft
Dieses Kapitel beleuchtet die wichtigsten historischen Etappen der landwirtschaftlichen Entwicklung, von der Neolithischen Revolution über die Feudalzeit bis hin zur Industriellen Revolution. Es werden die Veränderungen in der Produktionsweise und die Auswirkungen auf die Lebensweise der Menschen aufgezeigt.
Kennzeichen und Methoden der industriellen Landwirtschaft
Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale und Methoden der industriellen Landwirtschaft. Es befasst sich mit der Spezialisierung auf bestimmte Produktionsformen, dem Einsatz von Technik und Chemie sowie der Bedeutung von Skaleneffekten.
Auswirkungen der Industrialisierung der Landwirtschaft
Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Industrialisierung der Landwirtschaft auf verschiedene Bereiche, wie z.B. die Umwelt, die Lebensmittelversorgung, die Rolle von Agrarunternehmen und die Folgen für den ländlichen Raum.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themenbereiche der Arbeit sind: Industrialisierung der Landwirtschaft, Massentierhaltung, ländlicher Raum, Lebensmittelversorgung, Agrarunternehmen, Umweltbelastung, Nachhaltigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Auswirkungen hat die Massentierhaltung auf den ländlichen Raum?
Die Arbeit untersucht die Folgen der flächenunabhängigen Großbestandshaltung für die Umwelt, die Infrastruktur und das soziale Gefüge in ländlichen Regionen.
Welche Rolle spielen Großkonzerne in der modernen Landwirtschaft?
Aufgrund der Brisanz wird die zunehmende Einflussnahme von Agrarunternehmen auf die gesamte Lebensmittelerzeugung gesondert behandelt.
Was sind die Kennzeichen der industriellen Landwirtschaft?
Dazu gehören hohe Spezialisierung, intensiver Einsatz von Technik und Chemie sowie eine starke Orientierung an Skaleneffekten und Preisverfall.
Warum existiert das Idealbild des traditionellen Bauernhofs noch immer?
Trotz des umfassenden Wandels bleibt das Bild des Mischbetriebs in der öffentlichen Vorstellung präsent, was im Kontrast zur industriellen Realität steht.
Welche historischen Etappen waren entscheidend für die Agrarindustrie?
Die Arbeit nennt die Neolithische Revolution, die Bauernbefreiung sowie die Industrielle Revolution als zentrale Wendepunkte.
- Quote paper
- Sara Mann (Author), 2014, Die Industrialisierung der Landwirtschaft. Massentierhaltung und die Auswirkungen auf den ländlichen Raum, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300422