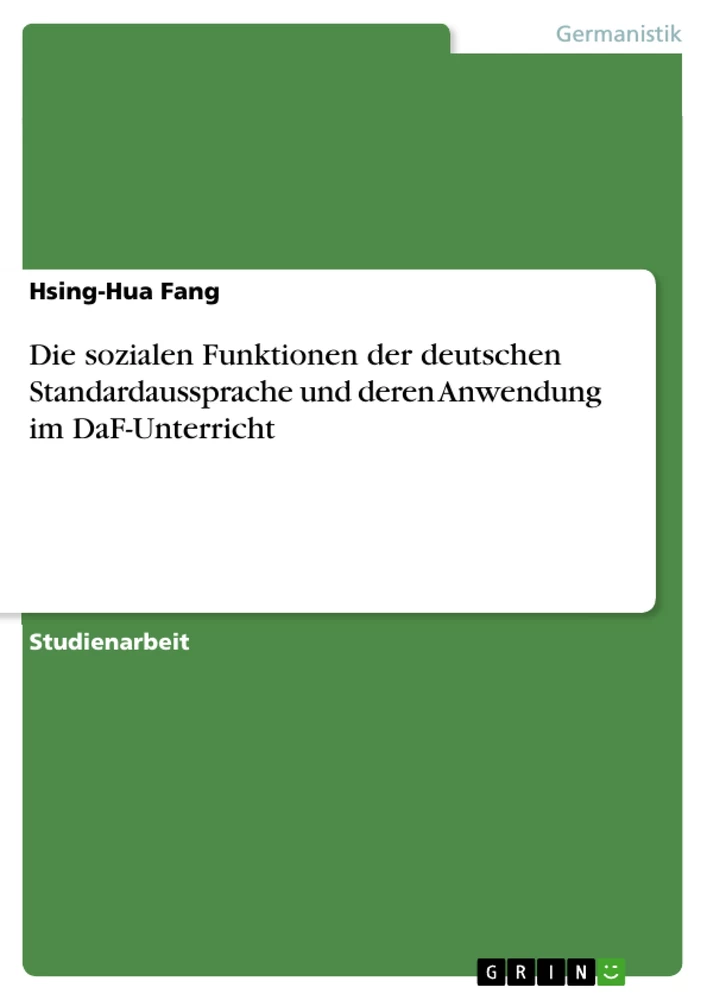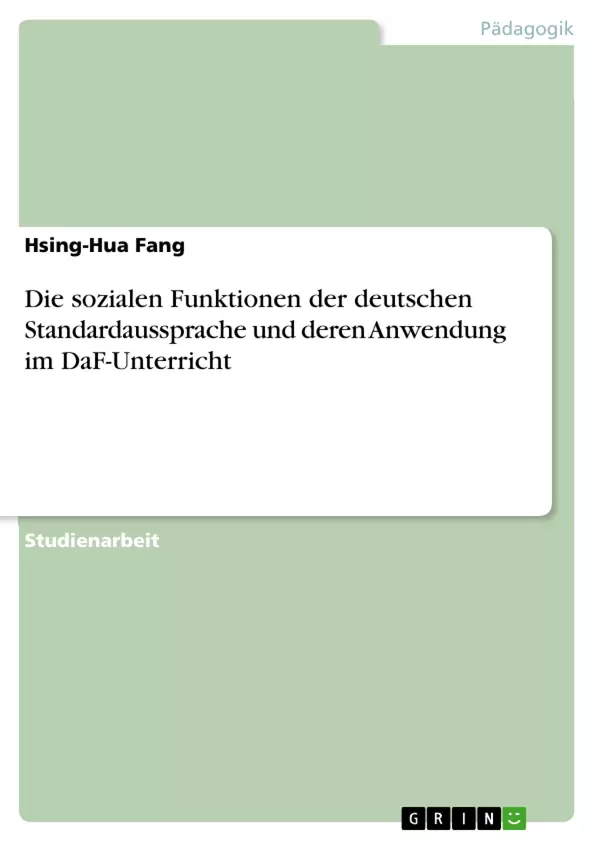Unter der Standardaussprache versteht man diejenige Ausspracheform, die kodifiziert und frei von dialektalen Einflüssen ist.
Im Gegensatz zu Dialekten, auch Mundarten genannt, gilt die Standardaussprache in vielen öffentlichen Bereichen wie z. B. im Rundfunk und Fernsehen als verbindlich und hat dabei einen breiten sozialen Geltungsbereich.
Im allgemeinen Sprachgebrauch wurde die deutsche Standardaussprache häufig mit der Bezeichnung „Hochdeutsch“ eng verbunden. Wenn wir sagen, dass jemand Hochdeutsch spricht, meinen wir, dass er eine akzentfreie Aussprache beherrscht, die den Regeln der deutschen Standardaussprache entspricht. Ursprünglich ist Hochdeutsch jedoch eine geographisch geprägte Bezeichnung für die im südlichen Deutschland gesprochen Mundarten, die sich zum heutigen Niederdeutschen im Norden abgrenzten.
Im Verlauf der Zeit entwickelten sich diese Mundarten durch Lautverschiebungen langsam zur heutigen Standardaussprache.
Die Initiative, eine überregionale einheitliche Aussprache auf dialektalem Substrat zu bilden, lag wohl in sozialökonomischen Bedürfnissen der frühen Gesellschaft. Sie soll als Instrument zur gesamtgesellschaftlichen Kommunikation dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Der Begriff der Standardaussprache
- Zur Entwicklung der deutschen Standardaussprache
- Warum Standardaussprache?
- Die richtige Aussprache im DaF-Unterricht
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text befasst sich mit der deutschen Standardaussprache und deren sozialen Funktionen. Dabei werden die Entstehung und Entwicklung der Standardaussprache beleuchtet, ihre Bedeutung als überregionales Kommunikationstool erläutert und die Relevanz für den Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht hervorgehoben.
- Soziale Funktionen der Standardaussprache
- Entwicklung der deutschen Standardaussprache
- Kodifizierung und Normierung der Aussprache
- Rolle der Standardaussprache im DaF-Unterricht
- Prestige und Akzeptanz der Standardaussprache
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Begriff der Standardaussprache
Dieses Kapitel definiert die Standardaussprache als eine kodifizierte Ausspracheform, die frei von dialektalen Einflüssen ist. Es wird die Unterscheidung zwischen Standardaussprache und Dialekten sowie die soziale Bedeutung der Standardaussprache im öffentlichen Bereich wie Rundfunk und Fernsehen beleuchtet. Außerdem wird der historische Zusammenhang zwischen Standardaussprache und "Hochdeutsch" erläutert.
2. Zur Entwicklung der deutschen Standardaussprache
Das zweite Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Standardaussprache in Deutschland, beginnend mit den ersten Ansätzen der Kodifizierung im 19. Jahrhundert durch Wilhelm Viëtor und Theodor Siebs. Es werden die verschiedenen Einflussfaktoren auf die Standardisierung der Aussprache, wie die klassische deutsche Literatur, das Theater und die Massenmedien, diskutiert. Die Kritik an der Siebsschen Kodifizierung und die Entstehung des "Großen Wörterbuchs der deutschen Aussprache" (GWDA) werden ebenfalls behandelt.
3. Warum Standardaussprache?
Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung der Aussprache als Stilelement der gesprochenen Sprache und ihre Rolle in der Kommunikation. Es wird die soziale Funktion der Aussprache als Signal für regionale und soziale Zugehörigkeit sowie als Ausdruck von Kultiviertheit und Bildungsniveau hervorgehoben. Die Standardaussprache wird als die Ausspracheform mit dem höchsten sozialen Prestige und der breitesten Akzeptanz dargestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter des Textes sind: Standardaussprache, Hochdeutsch, Dialekt, Kodifizierung, soziale Funktionen, Kommunikation, DaF-Unterricht, Prestige, Akzeptanz, Bildungsniveau.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Standardaussprache und Dialekt?
Die Standardaussprache ist kodifiziert und frei von regionalen Einflüssen, während Dialekte geographisch geprägte Mundarten sind.
Warum wird die Standardaussprache oft als "Hochdeutsch" bezeichnet?
Im allgemeinen Sprachgebrauch assoziiert man damit eine akzentfreie Aussprache, obwohl "Hochdeutsch" ursprünglich eine geographische Bezeichnung für süddeutsche Mundarten war.
Welche sozialen Funktionen erfüllt eine einheitliche Aussprache?
Sie dient als überregionales Kommunikationsinstrument, signalisiert Kultiviertheit und Bildungsniveau und besitzt ein hohes soziales Prestige.
Wer war an der Kodifizierung der deutschen Aussprache beteiligt?
Wichtige Pioniere waren Wilhelm Viëtor und Theodor Siebs im 19. Jahrhundert, deren Arbeiten die Basis für heutige Standards legten.
Welche Rolle spielt die Standardaussprache im DaF-Unterricht?
Sie ist das primäre Lehrziel, um Lernenden eine überregional akzeptierte und verständliche Kommunikation in allen öffentlichen Bereichen zu ermöglichen.
- Citar trabajo
- Hsing-Hua Fang (Autor), 2015, Die sozialen Funktionen der deutschen Standardaussprache und deren Anwendung im DaF-Unterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300549