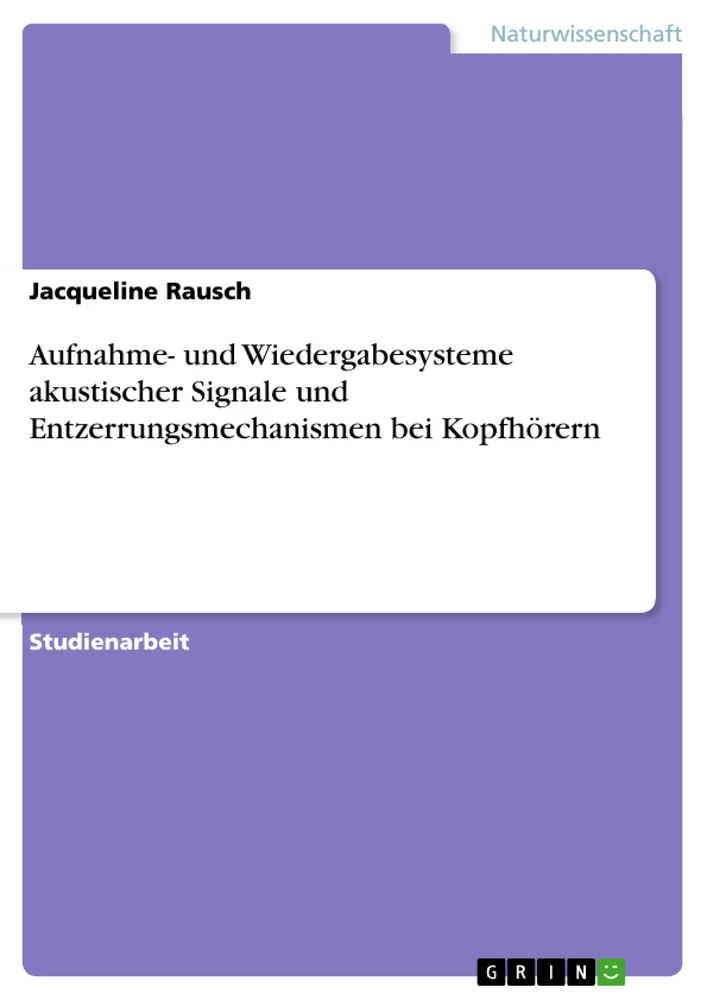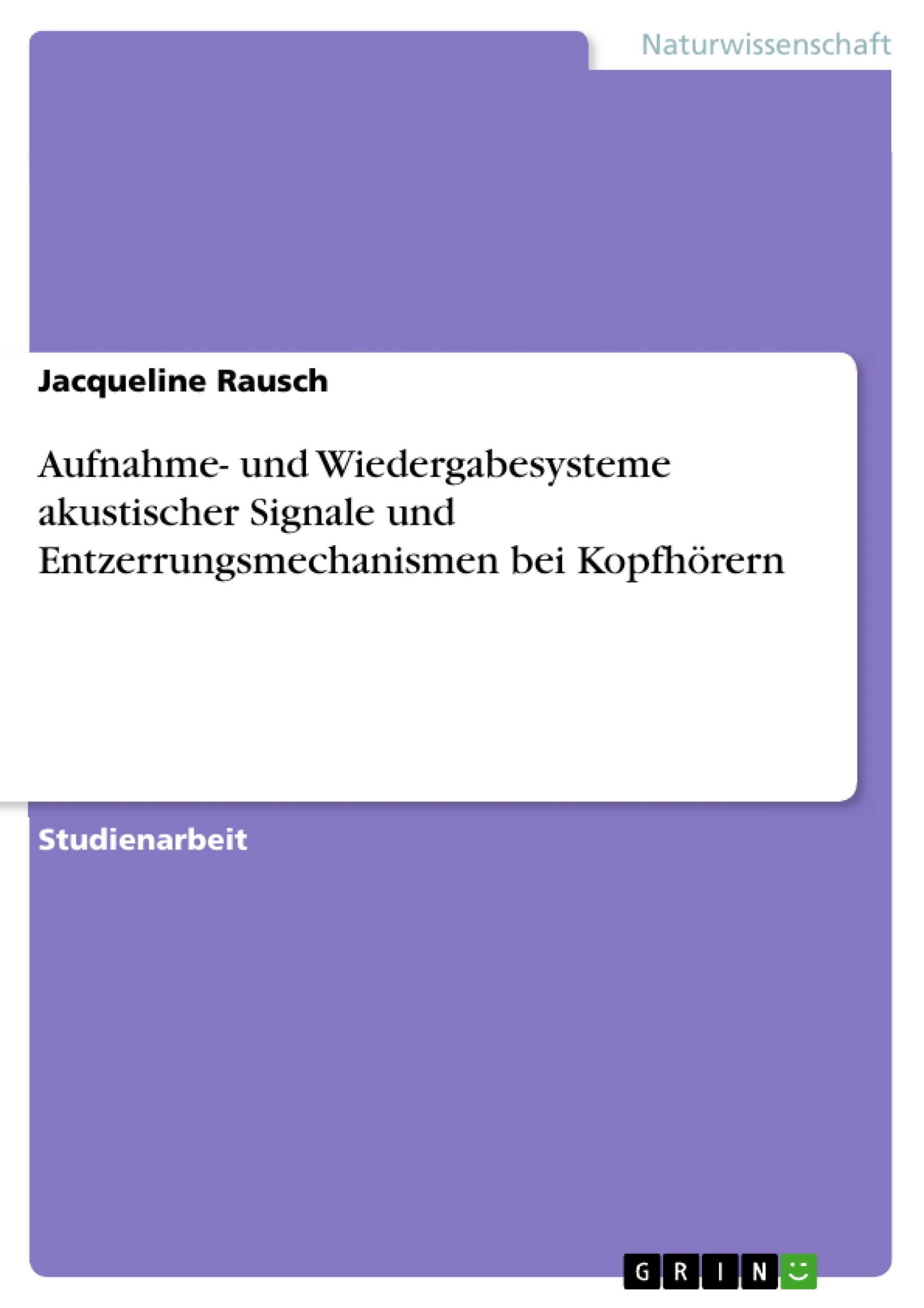Bei raumbezogenen Aufnahme- und Wiedergabesystemen handelt es sich um Stereoaufnahmen mit mehreren Mikrofonen und deren Wiedergabe über Lautsprecher. Die Anordnung der Mikrofone orientiert sich an den menschlichen Lokalisationsmechanismen der Auswertung von Laufzeit (ITD)- und Pegeldifferenzen (IID) zwischen den Ohren. Bei der Pegeldifferenzstereofonie bestimmt die Richtwirkung der verwendeten Mikrofone bzw. die Schalldruckunterschiede an den Lautsprechern die Hörereignisrichtung bei der Wiedergabe.
Liegt an allen Lautsprechern ein identisches Signal an, lokalisiert der Hörer eine zentrierte Phantomschallquelle, eine Erhöhung der Schallleistung eines Lautsprechers hingegen führt zur Lokalisation der Quelle in Richtung dieses.
Bei der Laufzeitstereofonie werden die Mikrofone von der Quelle unterschiedlich räumlich separiert, um die Lokalisation des Hörers auf Grund der positionsabhängigen Schallaufnahme zu unterschiedlichen Zeitpunkten hervorzurufen. Äquivalent zur Pegeldifferenzstereofonie erzeugt ein an an allen Lautsprechern identisches Schallsignal eine Lokalisation auf die Mitte, eine Verzögerung des Signals an einem Lautsprecher jedoch eine Bewegung der Schallquelle zum anderen Lautsprecher hin. Bei den beschriebenen Mikrofonanordnungen bzw. Mischformen dieser mit anschließender Wiedergabe der Schallsignale über Lautsprecher bleiben alle natürlichen Veränderungen des Schallfeldes auf Grund der menschlichen Geometrie der Ohrmuscheln, des Kopfes und Oberkörpers sowie der entstehenden Resonanzen im Gehörgang vollständig erhalten. Bei der Wiedergabe der Signale muss der Einfluss des Abhörraums beachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Aufnahme- und Wiedergabesysteme akustischer Signale
- 1.1 Raumbezogene Systeme
- 1.2 Kopfbezogene Systeme
- 1.3 Kompatibilität raum- und kopfbezogener Systeme
- 2 Entzerrungungsmechanismen
- 2.1 Physikalische Messmethoden
- 2.2 Freifeldentzerrung
- 2.3 Diffusfeldentzerrung
- 3 Lautheitsausgleichsbasierende Kalibrierung am Beispiel von Audiometriekopfhörern
- 3.1 Normbegriffe
- 3.2 Freifeldkalibrierung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung befasst sich mit Kopfhörerentzerrung und untersucht die Herausforderungen bei der Wiedergabe von Schallsignalen über Kopfhörer. Sie analysiert die Unterschiede zwischen raum- und kopfbezogenen Aufnahme- und Wiedergabesystemen sowie die Auswirkungen der Kopfbezogenen Übertragungsfunktion (HRTF) auf die räumliche Lokalisation und Klangqualität.
- Untersuchung der Unterschiede zwischen raum- und kopfbezogenen Systemen
- Analyse der Entzerrungungsmechanismen und deren Auswirkungen auf die Klangqualität
- Bewertung der Kompatibilität von raum- und kopfbezogenen Systemen
- Diskussion der Rolle der HRTF bei der Lokalisation und Klangwahrnehmung
- Anwendung von Lautheitsausgleichsbasierter Kalibrierung am Beispiel von Audiometriekopfhörern
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 analysiert die Unterschiede zwischen raum- und kopfbezogenen Aufnahme- und Wiedergabesystemen und erläutert die Funktionsweise von Pegeldifferenz- und Laufzeitstereofonie. Kapitel 2 behandelt verschiedene Entzerrungungsmechanismen, darunter physikalische Messmethoden, Freifeldentzerrung und Diffusfeldentzerrung. Kapitel 3 konzentriert sich auf Lautheitsausgleichsbasierte Kalibrierung am Beispiel von Audiometriekopfhörern und definiert wichtige Normbegriffe sowie die Freifeldkalibrierung.
Schlüsselwörter
Kopfhörerentzerrung, HRTF, Raumbezogene Systeme, Kopfbezogene Systeme, Entzerrungungsmechanismen, Freifeldentzerrung, Diffusfeldentzerrung, Lautheitsausgleich, Audiometriekopfhörer, Lokalisation, Klangqualität, Kompatibilität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen raum- und kopfbezogenen Audiosystemen?
Raumbezogene Systeme nutzen Lautsprecher im Raum, während kopfbezogene Systeme (Kopfhörer) den Schall direkt an die Ohren liefern, was spezielle Entzerrungen erfordert.
Was bedeutet HRTF?
Die Head-Related Transfer Function (HRTF) beschreibt, wie Kopf, Oberkörper und Ohrmuscheln den Schall filtern, was für die räumliche Lokalisation von Schallquellen entscheidend ist.
Was ist der Unterschied zwischen Freifeld- und Diffusfeldentzerrung?
Freifeldentzerrung simuliert Schall aus einer Richtung im schalltoten Raum, während Diffusfeldentzerrung einen Raum mit reflektiertem Schall aus allen Richtungen nachbildet.
Wie funktioniert die Lokalisation bei der Laufzeitstereofonie?
Sie nutzt Zeitunterschiede (ITD) zwischen den Ohren. Ein Signal, das ein Ohr früher erreicht, wird in dieser Richtung lokalisiert.
Warum müssen Audiometriekopfhörer kalibriert werden?
Die Kalibrierung (z.B. durch Lautheitsausgleich) stellt sicher, dass Hörtests präzise und normgerecht durchgeführt werden können, um Gehörschäden exakt zu diagnostizieren.
- Quote paper
- Jacqueline Rausch (Author), 2007, Aufnahme- und Wiedergabesysteme akustischer Signale und Entzerrungsmechanismen bei Kopfhörern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/300691