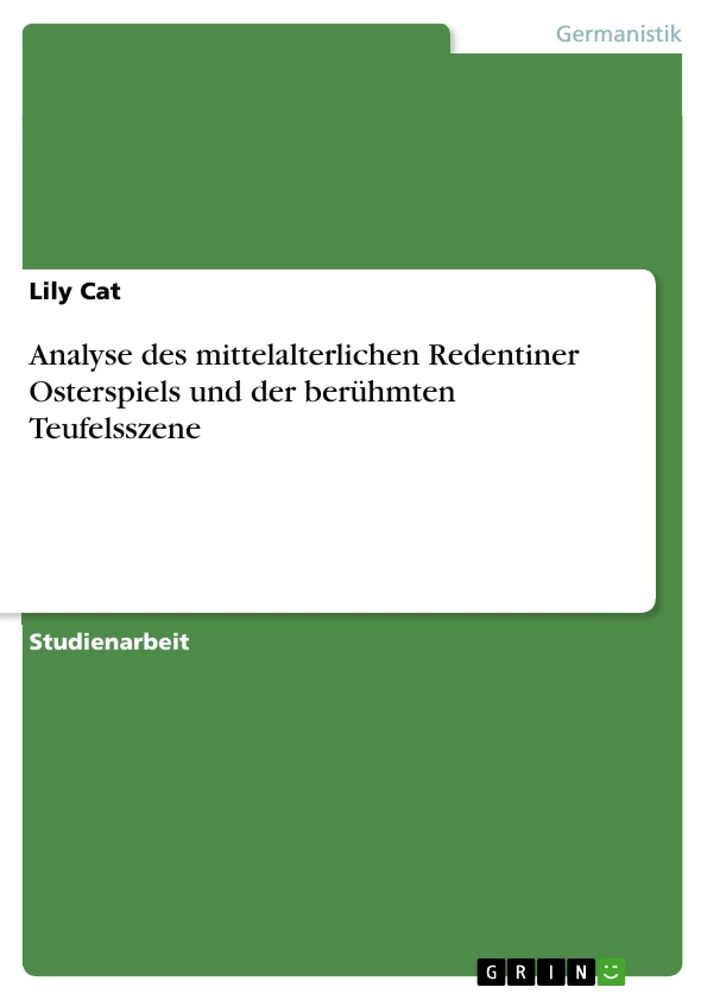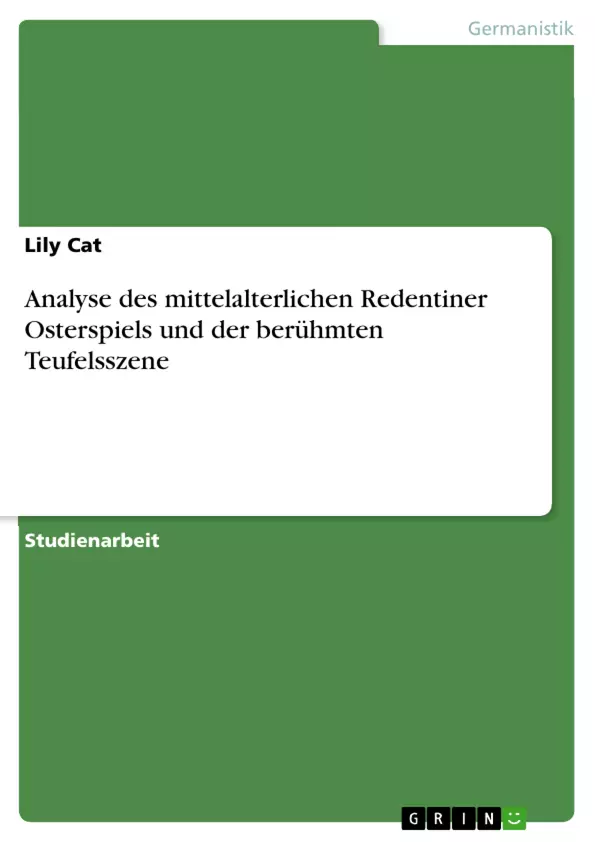In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird das Redentiner Osterspiel, welches ein Schauspiel aus dem niederdeutschen Sprachraum ist, und insbesondere die Teufelsszenen des Stücks bearbeitet. Die einzig verbliebene Handschrift stammt aus dem Jahr 1464 und liegt in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe vor.
Man kann wohl davon ausgehen, das diese Handschrift lediglich eine Abschrift ist. Der Schreiber schätzte scheinbar den Platz der Seiten falsch ein, da der Zeilenabstand zum Ende des Stücks immer kleiner wird. Der Originalverfasser sowie der Entstehungszeitpunkt und -ort sind gänzlich unbekannt. Der Autor wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Geistlicher gewesen sein, der Latein und Geistliche Literatur beherrschte. Auch die Schreibfähigkeit ist ein Indiz für diese Vermutung, da dies selbst im späten Mittelalter eine nicht weit verbreitete
Fähigkeit war. Eine Anmerkung am Schluss des Stücks deutet möglicherweise auf den Entstehungsort der Abschrift hin. Es wird auch vielfach diskutiert, ob eventuell ein anderes mittelalterliches Osterspiel als Vorlage diente, besonders die
Ähnlichkeit zum Innsbrucker Osterspiel ist hierbei anzumerken.
Es wird jedoch ausgeschlossen, dass es als direkte Vorlage diente. Das Redentiner Osterspiel ist wohl eines der komplexesten Schauspiele, die uns vom Mittelalter überliefert wurden. Als besonderes Hilfsmittel ist die übersetze und kommentierte Fassung des Redentiner Osterspiels von Brigitta Schottmann zu nennen. Es diente als Primär- und Sekundärliteratur.
Noch besonders hervorzuheben ist das Buch „Die Stellung des Redentiner Osterspiel in der Tradition des mittelalterlichen geistlichen Schauspiels“ von Lothar Humburg, auch der Aufsatz „Zu den Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels“ in „Gedenkschrift für William Foerste“, geschrieben von Ludwig Wolff, wurde genutzt. Hansjürgen Linke verfasste ebenfalls einen gesonderten Aufsatz zu den Teufelsszenen („Die Teufelsszenen des Redentiner Osterspiels), welcher im „Niederdeutschen Jahrbuch – Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung“ vorliegt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Handlung des Redentiner Osterspiels
- Teufelsszenen
- Höllenfahrtsszene
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Redentiner Osterspiel und insbesondere den Teufelsszenen des Stücks. Die Arbeit analysiert den Inhalt, die Struktur und die Bedeutung der Teufelsszenen in Bezug auf das gesamte Stück.
- Analyse der Teufelsszenen im Redentiner Osterspiel
- Interpretation der Figuren und ihrer Rollen
- Bedeutung des Redentiner Osterspiels im Kontext des mittelalterlichen geistlichen Schauspiels
- Vergleich mit anderen mittelalterlichen Osterspielen
- Analyse der sprachlichen Besonderheiten und des Stils
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Die Einleitung stellt das Redentiner Osterspiel, seine Entstehungszeit und seine Bedeutung vor. Sie bietet einen Überblick über die Forschungsliteratur und die Quellen.
- Der erste Teil der Arbeit beschreibt die Handlung des Redentiner Osterspiels. Er fasst die wichtigsten Ereignisse des Stücks zusammen und erläutert die Rolle der Teufelsszenen in der gesamten Handlung.
- Der zweite Teil der Arbeit analysiert die Teufelsszenen im Detail. Er geht auf die Figuren, ihre Beziehungen zueinander und die Themen ein, die in den Szenen behandelt werden.
- Der dritte Teil der Arbeit fokussiert sich auf die Höllenfahrtsszene. Er untersucht die Struktur und den Inhalt dieser Szene, die Rolle der Patriarchen und die Bedeutung des Dialogs zwischen Luzifer und Satan.
Schlüsselwörter (Keywords)
Redentiner Osterspiel, Teufelsszenen, mittelalterliches geistliches Schauspiel, Höllenfahrt, Luzifer, Satan, Patriarchen, Überwelt, Unterwelt, Erlösung, Sünden, Gott, Christus, Teufel, Schreibfähigkeit, Geistlicher, Literatur
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Redentiner Osterspiel?
Es ist eines der komplexesten mittelalterlichen Schauspiele aus dem niederdeutschen Sprachraum, überliefert in einer Handschrift von 1464.
Wer war vermutlich der Autor des Stücks?
Man geht davon aus, dass es ein Geistlicher war, da Lateinkenntnisse und Schreibfähigkeit im späten Mittelalter fast ausschließlich im Klerus verbreitet waren.
Warum sind die Teufelsszenen in diesem Osterspiel so bedeutend?
Die Teufelsszenen, insbesondere der Dialog zwischen Luzifer und Satan, sind zentral für die Darstellung der Unterwelt und den Kampf zwischen Gut und Böse.
Gibt es Ähnlichkeiten zu anderen mittelalterlichen Werken?
Ja, es wird oft eine Ähnlichkeit zum Innsbrucker Osterspiel diskutiert, wobei das Redentiner Spiel jedoch eine eigenständige Komplexität aufweist.
Was wird in der Höllenfahrtsszene genau thematisiert?
Die Szene untersucht die Struktur der Unterwelt, die Rolle der Patriarchen und die theologische Bedeutung der Erlösung durch Christus.
- Arbeit zitieren
- Lily Cat (Autor:in), 2013, Analyse des mittelalterlichen Redentiner Osterspiels und der berühmten Teufelsszene, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/301444