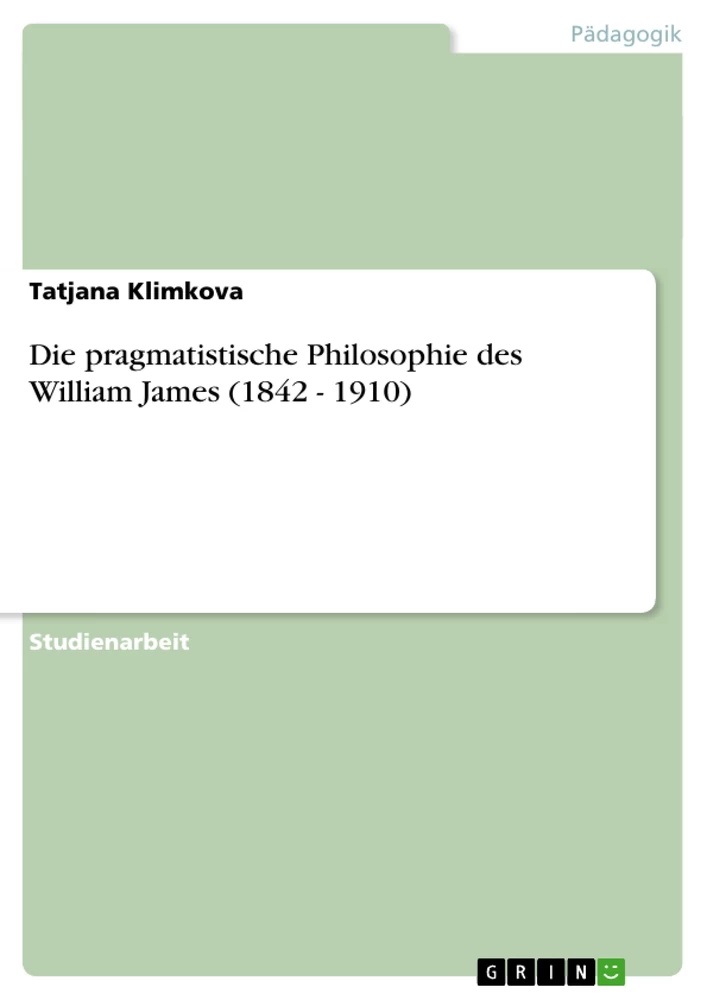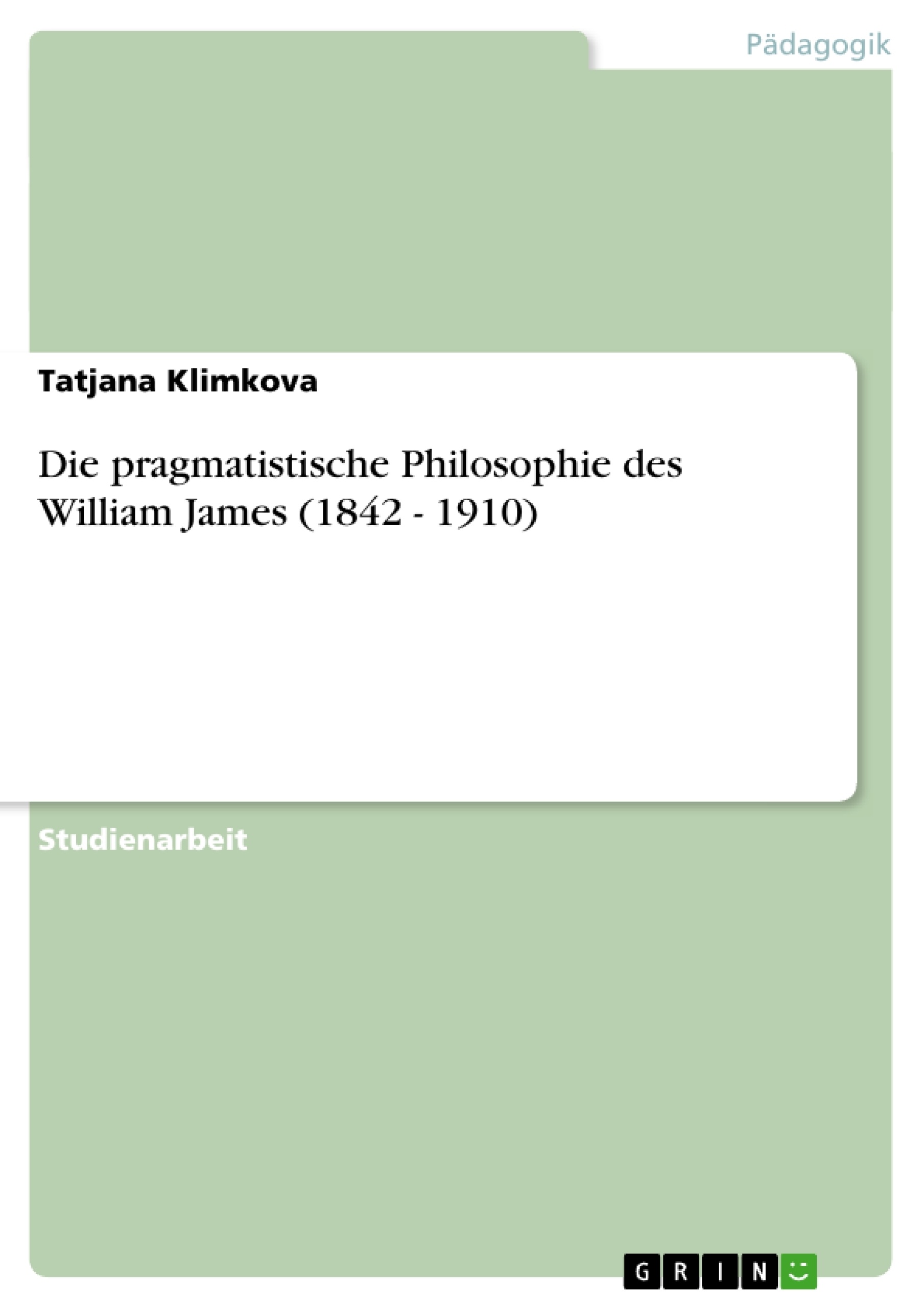Pragmatismus ist eine philosophische Richtung, die generell für einen Vorrang von Praxis vor rein theoretischen Überlegungen steht. Der Pragmatismus in der Gegenwartsphilosophie hat zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen handelt es sich um die pragmatistischen Positionen in der amerikanischen Philosophie im 19. Jahrhundert. Für Charles S. Peirce (1839-1914), William James (1842-1910) und John Dewey (1859-1952) umfasst „Pragmatismus“ in erster Linie praktische Bewährung: philosophische Positionen sind gemäß ihrer Bewährung im Handeln zu bewerten. Das hat insbesondere Auswirkungen auf das Verständnis von Wahrheit: Wahrheit wird mit langfristiger praktischer Bewährung gleichgesetzt. Die andere Anknüpfungspunkt sind Philosophische Untersuchungen von Ludwig Wittgenstein (1889- 1951). Man kann Wittgensteins Spätwerk vor allem deshalb pragmatisch verstehen, weil Wittgenstein die Semantik - die Theorie der Bedeutung sprachlicher Zeichen – von der Pragmatik - der Theorie des Gebrauchs sprachlicher Zeichen - aus konzipiert. Charakteristisch hierfür ist der Slogan, die Bedeutung eines Zeichens sei sein Gebrauch. Des heißt: Schon die Theorie, das Bildern von Begriffen und Gedanken, ist eine Art Praxis.
„Der Pragmatismus wurde von Peirce begründet und stellt die erste eigenständige amerikanische Philosophie dar. Seine zentrale Maxime fordert, Vorstellungen aller Art im Hinblick auf ihre möglichen praktischen Wirkungen zu beurteilen.“ Pragmatische Maxime von Peirce lautet: „Überlege, welches die praktischen Wirkungen sind, die unserer Meinung nach vom Objekt unserer Vorstellung erzeugt werden können. Die Vorstellung aller dieser Wirkungen ist die vollständige Vorstellung des Objektes“ Diese Maxime hat methodischen Charakter. Für Peirce diente sie der Technik der Bedeutungsanalyse von Zeichen. Auch für James ist der Pragmatismus vor allem eine Methode, "A new name for some old ways of thinking", wie der Untertitel der amerikanischen Erstausgabe seiner Pragmatismusvorlesungen (1907) lautet. Allerdings überwiegt bei ihm gegenüber der wissenschaftslogische n, semiotischen Betrachtung von Peirce die handlungstheoretische Perspektive. So bedeutet ihm die pragmatische Maxime, "daß unsere Überzeugungen tatsächlich Regeln für unser Handeln sind [...] und daß wir – um den Sinn eines Gedankens herauszufinden, nichts anderes tun müssen, als die Handlungsweise bestimmen, die diese Gedanken hervorzurufen geeignet sind. Die Handlungsweise ist für uns die ganze Bedeutung dieses Gedankens."
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Pragmatismus von William James
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Ausarbeitung analysiert die pragmatische Philosophie des amerikanischen Philosophen William James (1842-1910), insbesondere die in seinen Vorlesungen „Der Pragmatismus - Ein neuer Name für alte Denkmethoden“ (1906/1907) dargelegte Philosophie. Die Arbeit beleuchtet James’ pragmatische Maxime und die damit verbundene Methode zur Auflösung philosophischer Streitigkeiten. Darüber hinaus untersucht sie James’ genetische Wahrheitstheorie, die die Wahrheit als ein Produkt von Handlungen und Verifikationen begreift.
- Der Pragmatismus als Methode
- Die pragmatische Maxime von Peirce
- Die pragmatische Wahrheitstheorie
- Die Beziehung von Wahrheit und Nützlichkeit
- Die Verifikation als Wahrheitskriterium
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Pragmatismus wird als philosophische Richtung vorgestellt, die den Vorrang von Praxis vor theoretischen Überlegungen betont. Der Pragmatismus im 19. Jahrhundert, insbesondere bei Peirce, James und Dewey, sieht in der Bewährung im Handeln das zentrale Kriterium für die Bewertung philosophischer Positionen. Diese Sichtweise beeinflusst auch das Verständnis von Wahrheit, die mit langfristiger praktischer Bewährung gleichgesetzt wird.
- Der Pragmatismus von William James: Die Ausarbeitung konzentriert sich auf James' Vorlesungsreihe „Der Pragmatismus“, in der er das Programm des amerikanischen Pragmatismus vorstellt. James argumentiert, dass Pragmatismus eine Philosophie ist, die sowohl religiöse als auch empirische Bedürfnisse befriedigen kann. Er stellt seine pragmatische Methode vor, die Streitigkeiten durch die Untersuchung der praktischen Konsequenzen von Urteilen lösen soll.
- Das Wesen des Pragmatismus: James definiert den Pragmatismus als eine Methode und als eine genetische Wahrheitstheorie. Wahrheit wird als ein Produkt von Handlungen und Verifikationen verstanden, wobei das Nützliche oder Gute als Wahrheitskriterium fungiert.
Schlüsselwörter
Die Ausarbeitung konzentriert sich auf die pragmatische Philosophie von William James, die sich durch die pragmatische Maxime, die Methode zur Auflösung philosophischer Streitigkeiten und die genetische Wahrheitstheorie auszeichnet. Weitere Schlüsselbegriffe sind praktische Bewährung, Verifikation, Nützlichkeit und Wahrheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der pragmatistischen Philosophie?
Pragmatismus betont den Vorrang der Praxis vor der Theorie. Philosophische Positionen werden nach ihrer Bewährung im Handeln und ihren praktischen Wirkungen beurteilt.
Was besagt die pragmatische Maxime von Peirce?
Sie fordert dazu auf, den Sinn eines Objekts oder Gedankens dadurch zu bestimmen, dass man sich überlegt, welche praktischen Wirkungen es erzeugen kann.
Wie definiert William James „Wahrheit“?
Wahrheit ist für James kein statisches Merkmal, sondern ein Prozess. Ein Gedanke wird „wahr“, wenn er sich in der Praxis bewährt und uns hilft, erfolgreich mit der Welt zu interagieren.
Was ist der Unterschied zwischen Peirce und James?
Während Peirce den Pragmatismus eher als wissenschaftslogische Methode sah, rückte William James die handlungstheoretische Perspektive und den Nutzen für das Individuum in den Fokus.
Warum wird Pragmatismus als „genetische Wahrheitstheorie“ bezeichnet?
Weil Wahrheit als etwas angesehen wird, das durch menschliches Handeln und Verifikation erst „gemacht“ wird oder entsteht, statt einfach nur entdeckt zu werden.
- Quote paper
- Tatjana Klimkova (Author), 2003, Die pragmatistische Philosophie des William James (1842 - 1910), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30193