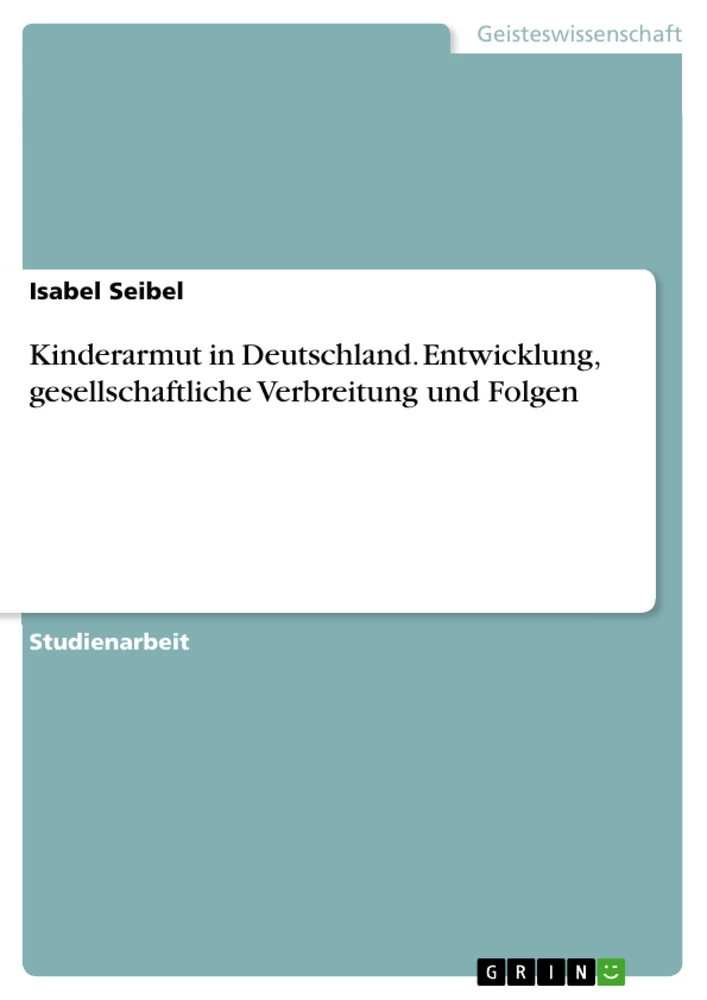Der Aspekt der Kinderarmut ist sehr präsent. Meines Erachtens nach handelt es sich hierbei um ein eklatant wichtiges politisches Thema in unserer Gesellschaft.
Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Deutschland, die in Armut aufwachsen, steigt kontinuierlich. Mittlerweile sind Kinder und Jugendliche die in Deutschland am stärksten von Armut betroffene Bevölkerungsgruppe, am Alter gemessen.
Dass es in einem „reichen Industrieland“ wie Deutschland von Armut betroffene Kinder gibt, wurde in der öffentlichen Meinung unserer Gesellschaft lange Zeit nicht thematisiert, quasi totgeschwiegen.
Aus diesem Grunde ist es mir mit dieser Hausarbeit ein besonderes Anliegen, dieses gesellschaftlich sehr aktuelle und relevante Thema näher zu beleuchten.
Das Thema Kinderarmut mit allen damit verbundenen Aspekten ist ein sehr umfangreiches Thema, welches aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Dies würde jedoch den Rahmen dieser Hausarbeit sprengen. Daher beschränke ich mich auf die Thematik in der Bundesrepublik Deutschland (auch andere Länder sind betroffen).
Des Weiteren habe ich die mir am wichtigsten erscheinenden Aspekte ausgewählt. Diese werden im Folgenden eingehend betrachtet und erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kinderarmut - Definition und Methoden bei der Einkommensmessung
- Definition
- Methoden bei der Einkommensmessung
- Armutsrisiken von Kindern und Jugendlichen in Deutschland
- Verteilung der Armutsrisikoquote nach dem Kindesalter
- Verteilung der Armutsrisikoquote nach Familientypen
- Verteilung der Armutsrisikoquote von Kindern aus Familien mit ausländischem Haushaltsvorstand
- Folgen von Kinderarmut
- Kinderarmut und Gesundheit
- Kinderarmut und Bildung
- Kinderarmut und soziale Teilhabe
- Kinderarmut und Persönlichkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema Kinderarmut in Deutschland. Ziel ist es, die Entwicklung, gesellschaftliche Verbreitung und Folgen von Kinderarmut zu analysieren. Dabei werden verschiedene Aspekte der Armutsdefinition, die Methoden der Einkommensmessung und die Verteilung der Armutsrisikoquote nach sozioökonomischen Faktoren untersucht. Des Weiteren werden die Auswirkungen von Kinderarmut auf Gesundheit, Bildung, soziale Teilhabe und Persönlichkeit beleuchtet.
- Definition von Kinderarmut und Methoden der Einkommensmessung
- Verbreitung von Kinderarmut in Deutschland anhand verschiedener sozioökonomischer Faktoren
- Folgen von Kinderarmut für die betroffenen Kinder und Jugendlichen
- Zusammenhang zwischen Kinderarmut und gesellschaftlichen Benachteiligungen
- Relevanz des Themas Kinderarmut für die Gesellschaft und die Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Kinderarmut vor und erläutert die Relevanz des Themas für die Autorin. Anschließend wird der Begriff „Armut“ definiert und die Methoden der Einkommensmessung, insbesondere die Armutsrisikoquote, näher beleuchtet. Im dritten Kapitel werden die Armutsrisiken von Kindern und Jugendlichen in Deutschland anhand verschiedener sozioökonomischer Faktoren untersucht, darunter das Alter der Kinder, der Familientyp und die Herkunft des Haushaltsvorstands. Das vierte Kapitel widmet sich den Folgen von Kinderarmut für die betroffenen Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Lebensbereichen, wie Gesundheit, Bildung, soziale Teilhabe und Persönlichkeit.
Schlüsselwörter
Kinderarmut, Armutsrisikoquote, Einkommensmessung, sozioökonomische Faktoren, Gesundheit, Bildung, soziale Teilhabe, Persönlichkeit, gesellschaftliche Benachteiligung, politische Relevanz.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Kinderarmut in Deutschland gemessen?
Armut wird primär über die Armutsrisikoquote ermittelt, die auf der Messung des Haushaltseinkommens im Vergleich zum Durchschnittseinkommen basiert.
Welche Kindergruppen sind in Deutschland am stärksten von Armut bedroht?
Besonders betroffen sind Kinder in Einelternfamilien (Alleinerziehende) sowie Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund bzw. ausländischem Haushaltsvorstand.
Welche Folgen hat Armut für die Gesundheit von Kindern?
Armut führt oft zu schlechteren Ernährungsgewohnheiten, geringerem Zugang zu sportlichen Aktivitäten und einer insgesamt höheren gesundheitlichen Belastung.
Wie wirkt sich Kinderarmut auf die Bildungschancen aus?
Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen Armut und Bildungserfolg; Kinder aus armen Familien haben oft geringere Unterstützungsmöglichkeiten und niedrigere Bildungsabschlüsse.
Was versteht man unter mangelnder sozialer Teilhabe bei Kinderarmut?
Damit ist der Ausschluss von Freizeitaktivitäten, kulturellen Angeboten oder sozialen Kontakten gemeint, die Geld kosten (z. B. Klassenfahrten, Vereine), was zur sozialen Isolation führen kann.
- Arbeit zitieren
- Isabel Seibel (Autor:in), 2011, Kinderarmut in Deutschland. Entwicklung, gesellschaftliche Verbreitung und Folgen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302028