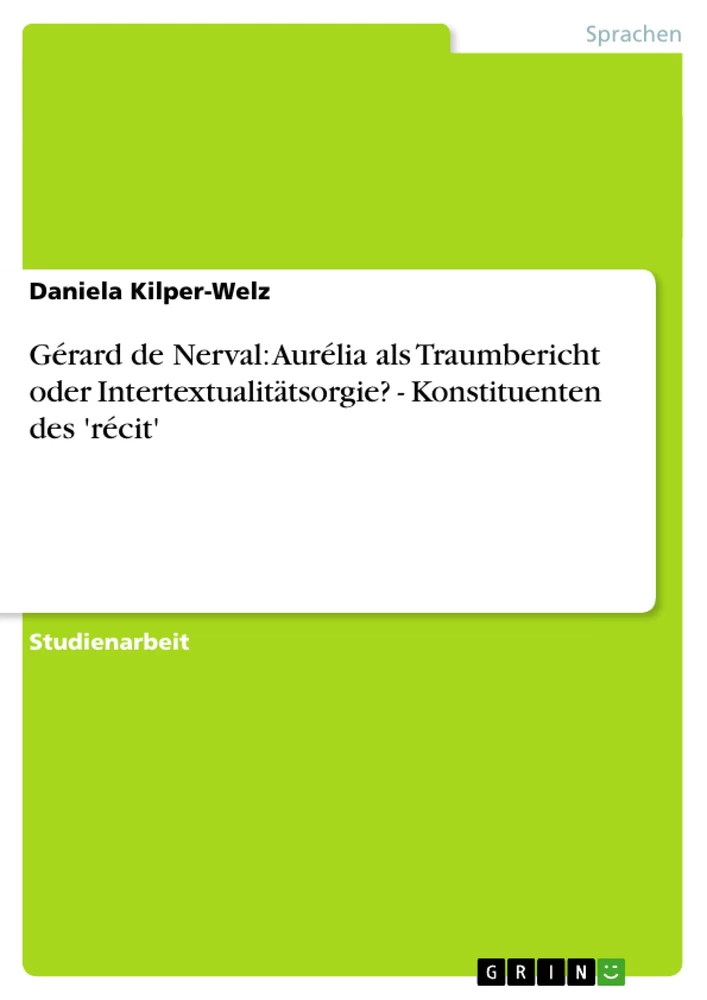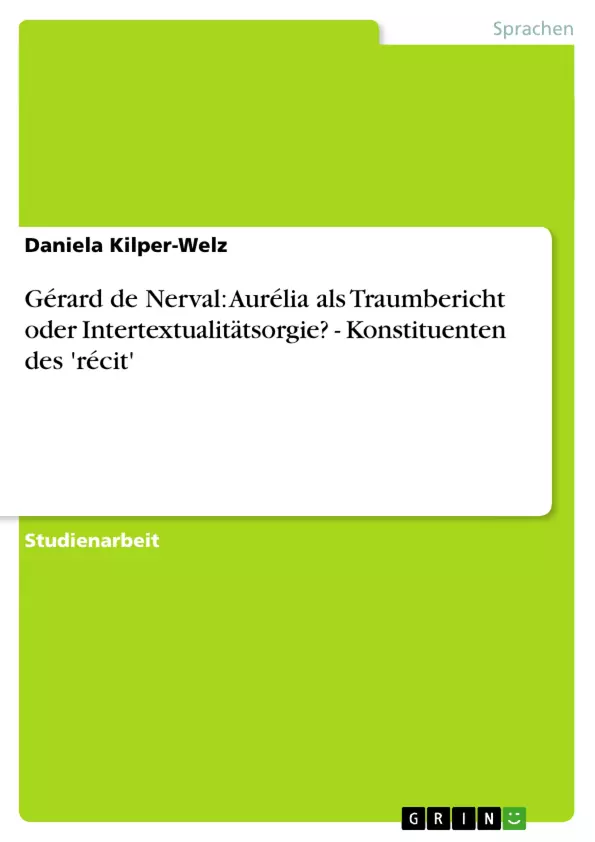Gérard de Nerval wurde am 22.Mai 1808 unter dem bürgerlichen Namen Gérard Labrunie als Sohn eines Arztes in Paris geboren. De Nerval ist folglich nur der Künstlername des Schriftstellers, den er von einem Familienbesitz in der Ile de France, der Gegend in der er aufwuchs, übernommen hat. Seine Mutter starb schon 1810 während der Napoleonischen Feldzüge in Schlesien. Der frühe Tod der Mutter im Zusammenhang mit Deutschland erklärt sein traumatisches Verhältnis zu diesem Land. 1 Als Halbwaise wuchs er bei einem Großonkel auf dem Lande in Mortefontaine auf. Die Eindrücke seiner Kindheit scheinen sehr prägend gewesen zu sein, da er sich in seinen Werken immer wieder darauf bezieht. 2 Bereits im Alter von 18 Jahren veröffentlichte er die « Elégies nationales » als erste lyrische Versuche. Zwei Jahre später übersetzte er Goethes Faust I und 1840 Faust II. Er erntete dafür das hohe Lob Goethes. 1832 bis 1834 studierte Gérard, dem Vorbild seines Vaters folgend, Medizin und half ihm während einer Choleraepidemie in Paris. 1833 bis 1838 war er mit der Schauspielerin Jenny Colon befreundet, die er sehr verehrte. Sie heiratete allerdings 1838 einen Musiker und starb bereits 1842. Jenny übte einen prägenden Einfluss auf Nervals Werk und insbesondere auf Aurélia aus. Gérard gab 1835 die kurzlebige Zeitschrift Le Monde dramatique heraus und arbeitete an den bekanntesten Pariser Zeitungen und Zeitschriften mit. Jedoch war er erst 1848 in den literarischen Zirkeln der französischen Hauptstadt als Dichter anerkannt. Er war mit Heinrich Heine befreundet und veröffentlichte 1848 die Übersetzungen größerer Abschnitte seiner Werke und eine Studie über den deutschen Dichter. Mit Aurélia stand Nerval insbesondere der deutschen Romantik am nähesten; vor allem Novalis und E.T.A. Hoffmann. 3
Nerval unternahm ab 1834 zahlreiche Reisen, die ihn wiederholt nach Italien und Deutschland führten. 1843 verbrachte er sogar fast ein ganzes Jahr im Orient, der wiederum einen prägenden Einfluss auf sein Werk hatte. 1841 jedoch bekam er erste Anfälle einer Geisteskrankheit, die ihn immer wieder befiel. Schwere Krisen hatte er insbesondere in den Jahren 1841, 1851 und 1853/54. Von diesen ist in Aurélia die Rede.
Inhaltsverzeichnis
- I. Gérard de Nerval (1808-1855)
- II. Einleitung und Hinführung zum Thema
- III. Aurélia als Traumbericht oder Intertextualitätsorgie? – Konstituenten des „récit“
- 1. Inhaltserörterung
- 1.1 Erster Teil
- 1.1.1 Erstes Kapitel
- 1.1.2 Zweites Kapitel
- 1.1.3 Drittes Kapitel
- 1.1.4 Viertes Kapitel
- 1.1.5 Fünftes Kapitel
- 1.1.6 Sechstes bis Achtes Kapitel
- 1.1.7 Neuntes Kapitel
- 1.1.8 Zehntes Kapitel
- 1.2 Zweiter Teil
- 1.3 Leitmotive
- 1.3.1 Das Todesmotiv bzw. der Abstieg in die Unterwelt
- 1.3.2 Das Motiv der Schuld und Erlösung
- 1.3.3 Das Doppelgängermotiv
- 1.1 Erster Teil
- 2. Aurélia als Traumbericht
- 3. Intertextuelle Elemente in Aurélia
- 4. Konstituenten des „récit“
- 1. Inhaltserörterung
- IV. Schlussgedanke
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Gérard de Nervals Werk „Aurélia“ und untersucht dessen Bedeutung als Traumbericht und Intertextualitätsorgie. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Nervals persönlicher Lebensweg und psychische Verfassung in seinem Werk Ausdruck finden.
- Biographische Elemente in Nervals Werk
- Analyse der intertextuellen Bezüge
- Erörterung der Leitmotive in „Aurélia“
- Untersuchung der Konstituenten des „récit“
- Die Bedeutung des Traumes als zweites Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer detaillierten Darstellung von Gérard de Nervals Leben und seiner Biographie. Im Anschluss wird eine Einleitung und Hinführung zum Thema „Aurélia“ präsentiert. Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Inhaltserörterung und Analyse von „Aurélia“, wobei insbesondere die ersten beiden Teile des Werkes betrachtet werden. Dabei werden die wichtigsten Leitmotive und intertextuellen Elemente des Textes erörtert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Gérard de Nerval, „Aurélia“, Traumbericht, Intertextualität, „récit“, biographische Elemente, Leitmotive, literarisches Testament, Seelenwanderung, Krankheit, Traum, Realität, Tod, Schuld, Erlösung, Doppelgänger, deutsche Romantik, Novalis, E.T.A. Hoffmann, Swedenbourg, Apulejus, Dante.
- Quote paper
- Daniela Kilper-Welz (Author), 2004, Gérard de Nerval: Aurélia als Traumbericht oder Intertextualitätsorgie? - Konstituenten des 'récit', Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30215