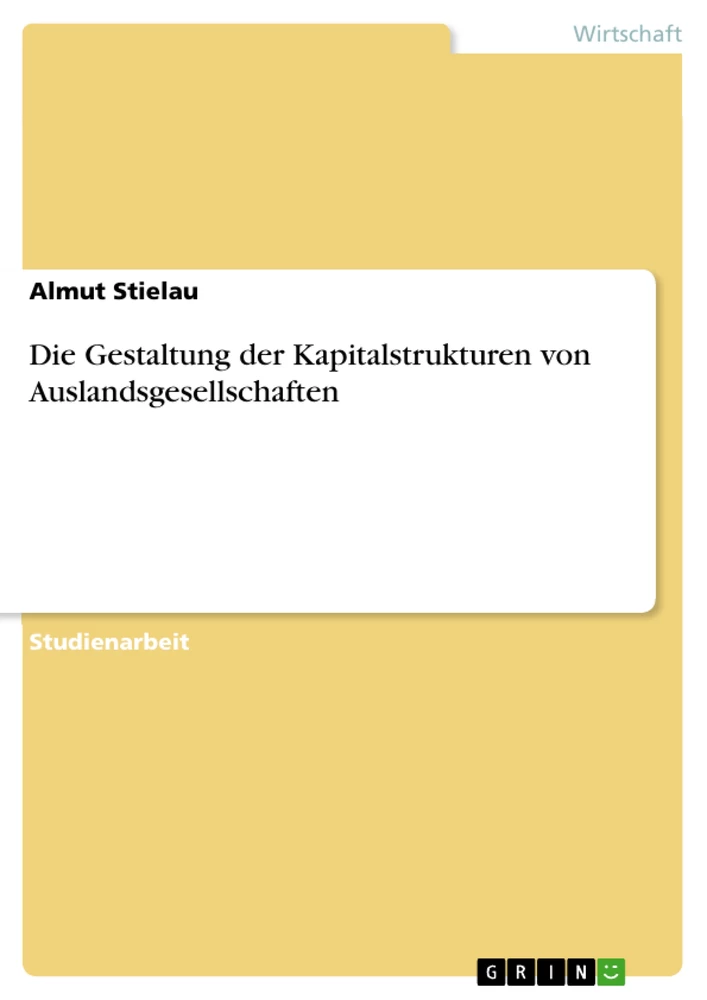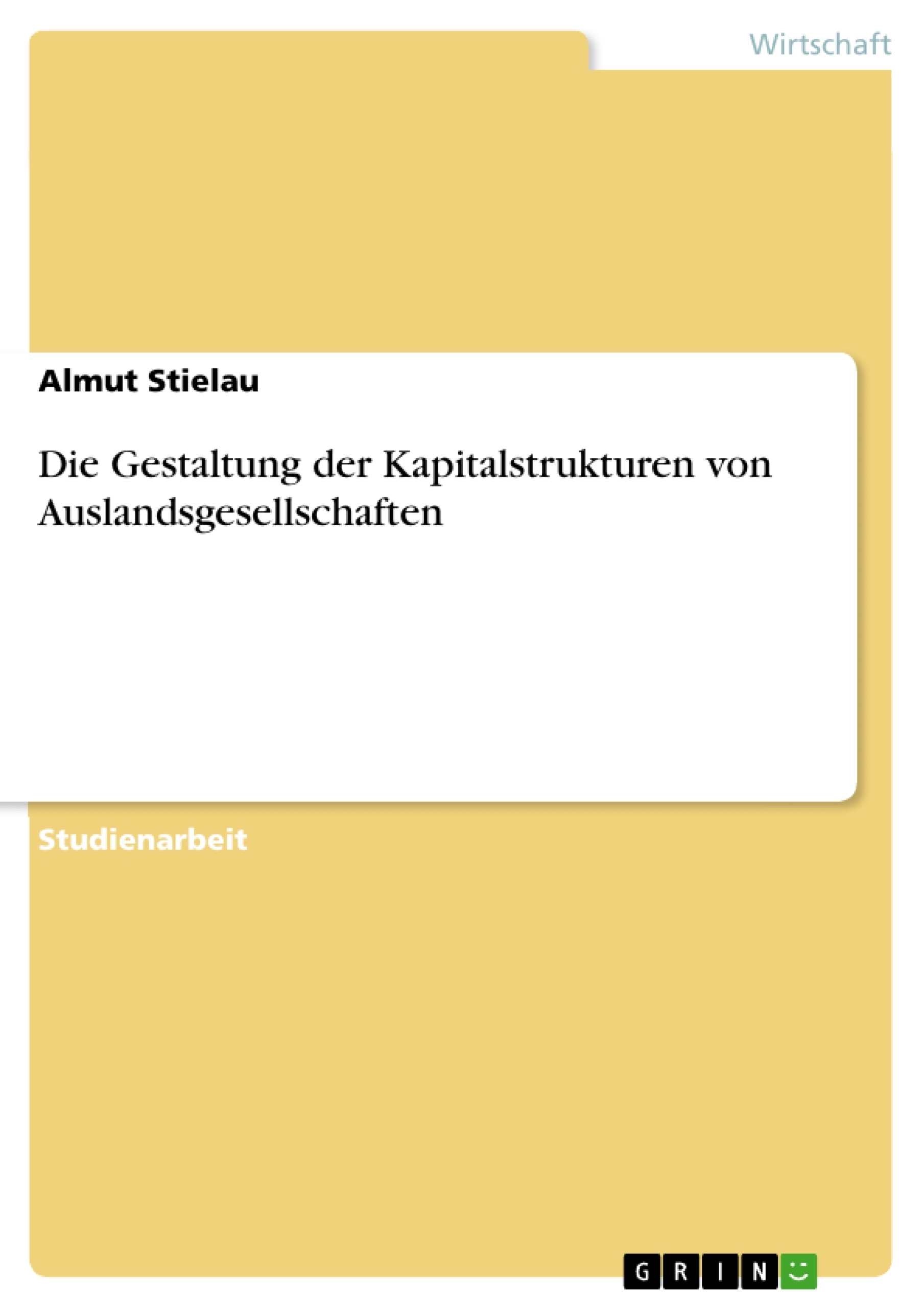Unternehmen, die ihre Auslandsaktivitäten über eigenständige Gesellschaften durchführen, sind mit komplexen Koordinationsaufgaben konfrontiert, die die vielfältigen Interdependenzen zwischen den in- und ausländischen Unternehmenseinheiten widerspiegeln. Ein wichtiges Charakteristikum dieser Koordination ist dabei das Spannungsfeld zwischen Autonomie und Zentralisierung.
Mit zunehmendem Auslandsengagement und einer wachsenden Anzahl rechtlich selbständiger Auslandsgesellschaften ist die "richtige" Koordination ein wesentlicher Erfolgsfaktor der internationalen Unternehmenstätigkeit. Der Gestaltung der Kapitalstruktur kommt dabei eine wesentliche Bedeutung zu: Welche Kriterien gilt es, zu berücksichtigen? In welchem Maße sollte eine Einbettung in die Struktur der Gesamtunternehmung erfolgen? Welche internationalen und länderspezifischen Einflussfaktoren spielen dabei eine Rolle? Und welche Gestaltungsempfehlungen können auf dieser Grundlage gegeben werden?
Zunächst wird eine kurze Einführung in die relevanten kapitaltheoretischen Überlegungen gegeben, anschließend erfolgt eine Ausweitung auf den internationalen Kontext: in Kapitel 3 bezogen auf die kostenabhängigen, in Kapitel 4 auf die kostenunabhängigen Faktoren. Zum Abschluss werden die verschiedenen Gestaltungsempfehlungen aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- THEORIE EINER OPTIMALEN KAPITALSTRUKTUR
- PERFEKTE MÄRKTE?
- STEUERN UND INSOLVENZRISIKO
- KAPITALKOSTEN IM INTERNATIONALEN KONTEXT
- IST DIE KAPITALSTRUKTUR IRRELEVANT?
- KAPITALKOSTEN BEI UNVOLLKOMMENEN MÄRKTEN
- KOSTENUNABHÄNGIGE FAKTOREN
- VERFÜGBARKEIT VON KAPITAL
- FINANZIELLES RISIKO
- LÄNDERSPEZIFISCHE SCHULDENQUOTEN
- EINFLUSSPOTENTIAL UND BETEILIGUNGSSTRUKTUR
- GESTALTUNGSEMPFEHLUNGEN
- MINIMIERUNG DER EK-QUOTE
- VEREINHEITLICHUNG FÜr alle TeilbeREICHE
- ANPASSUNG AN LANDESÜBLICHE EK-QUOTE
- PRAKTISCHE RELEVANZ DER STRATEGIEN
- ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Gestaltung der Kapitalstrukturen von Auslandsgesellschaften. Sie analysiert die relevanten kapitaltheoretischen Überlegungen und erweitert diese auf den internationalen Kontext, wobei sowohl kostenabhängige als auch kostenunabhängige Faktoren berücksichtigt werden. Die Arbeit zielt darauf ab, die wesentlichen Kriterien für die Gestaltung der Kapitalstruktur von Auslandsgesellschaften aufzuzeigen und Gestaltungsempfehlungen zu entwickeln.
- Optimale Kapitalstruktur und ihre Determinanten
- Einfluss von Steuern und Insolvenzrisiko auf die Kapitalstruktur
- Kostenabhängige und kostenunabhängige Faktoren im internationalen Kontext
- Länderspezifische Einflussfaktoren auf die Kapitalstruktur
- Gestaltungsempfehlungen für die Kapitalstruktur von Auslandsgesellschaften
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Koordination von Auslandsaktivitäten über eigenständige Gesellschaften dar und beleuchtet die Bedeutung der Kapitalstruktur in diesem Zusammenhang. Kapitel 2 bietet eine Einführung in die relevanten kapitaltheoretischen Überlegungen, wobei insbesondere die Konzepte der Marktwertmaximierung und der Minimierung der Kapitalkosten beleuchtet werden. Kapitel 3 erweitert die Analyse auf den internationalen Kontext und untersucht die Relevanz der Kapitalstruktur unter Berücksichtigung der Kostenfaktoren. Kapitel 4 analysiert die kostenunabhängigen Faktoren, die die Kapitalstruktur beeinflussen, wie z.B. die Verfügbarkeit von Kapital, das finanzielle Risiko und länderspezifische Besonderheiten. Abschließend werden in Kapitel 5 verschiedene Gestaltungsempfehlungen für die Kapitalstruktur von Auslandsgesellschaften vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Finanzwirtschaft, insbesondere mit der Kapitalstruktur von Auslandsgesellschaften. Wichtige Schlüsselwörter sind: Kapitalstruktur, Finanzierungsseite, Investitionsseite, Verschuldungsgrad, Marktwertmaximierung, Kapitalkosten, Steuern, Insolvenzrisiko, Kostenabhängige Faktoren, Kostenunabhängige Faktoren, Länderspezifische Einflussfaktoren, Gestaltungsempfehlungen, internationale Unternehmenstätigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die optimale Kapitalstruktur einer Auslandsgesellschaft bestimmt?
Sie wird durch ein Spannungsfeld aus zentraler Steuerung, lokalen Steuervorteilen, Insolvenzrisiken und länderspezifischen Finanzierungsgepflogenheiten bestimmt.
Welche Rolle spielen Steuern bei der internationalen Finanzierung?
Unternehmen versuchen oft, die Fremdkapitalquote in Ländern mit hohen Steuersätzen zu maximieren, um von der steuerlichen Absetzbarkeit der Zinsen zu profitieren.
Was sind kostenunabhängige Faktoren bei der Kapitalstrukturwahl?
Dazu gehören die politische Stabilität des Gastlandes, Währungsrisiken, die Verfügbarkeit lokaler Kapitalmärkte und das finanzielle Risiko der Gesamtgruppe.
Sollte die Kapitalstruktur weltweit vereinheitlicht werden?
Eine Vereinheitlichung vereinfacht die Koordination, kann aber dazu führen, dass lokale Vorteile (z.B. günstige Kredite im Ausland) nicht optimal genutzt werden.
Was ist das Ziel der Marktwertmaximierung in diesem Kontext?
Das Ziel ist es, die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) der gesamten Unternehmung durch eine geschickte Verteilung von Eigen- und Fremdkapital zu minimieren.
- Quote paper
- Almut Stielau (Author), 1998, Die Gestaltung der Kapitalstrukturen von Auslandsgesellschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302354