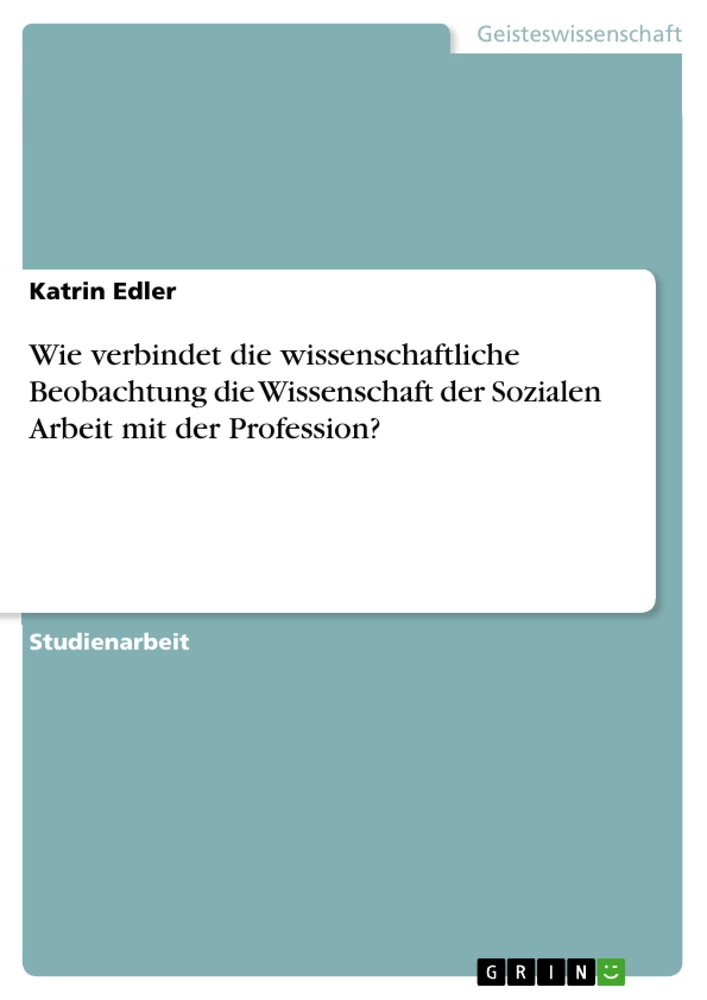Zu Beginn der Recherche drängte sich eine Unterscheidung in Disziplin und Profession auf, die als zwei Seiten einer Medaille verstanden werden können. Es lässt sich sagen, dass eine Medaille einen höheren Wert erzielt, wenn beide Seiten gut geprägt sind. Unter Beibehaltung dieser Metapher kann der bestehende Theorie-Praxiskonflikt der Sozialen Arbeit als Wertminderung angesehen werden.
Die International Federation of Social Workers hat in ihrer Neufassung der Definition Sozialer Arbeit im Sommer 2000 betont, dass sich die Profession der Sozialen Arbeit auf wissenschaftliche Erkenntnisse über menschliches Verhalten und soziale Systeme stützt. So lautet eine Antwort auf die Frage „Was ist Wissenschaft der Sozialer Arbeit?“, dass WSA als Disziplin die Aufgabe hat, empirisch begründetes, aus Forschung und Praxisevaluation gewonnenes Wissen zu sammeln und der Praxis zur Verfügung zu stellen.
Hierbei sind unterschiedliche Arten der Forschung zu berücksichtigen. Neben der anwendungsorientierten Grundlagenforschung, die in dieser Arbeit keine weitere Erwähnung findet, existieren auch unterschiedliche Methoden zur anwendungsbezogenen Forschung (vgl. ebd.). Eine dieser Methoden, die Interventionsforschung, führte zu der bearbeiteten Fragestellung „Wie verbindet die wissenschaftliche Beobachtung die WSA mit der Profession?“
Zur Klärung der Fragestellung werden zunächst die Begriffe „Wissenschaft“, „Disziplin“ und „Profession“ (2.1) sowie die wissenschaftliche Beobachtung im Allgemeinen (2.2) und die Kategorien wissenschaftlicher Beobachtungen Beobachtung im Speziellen (2.3) geklärt. Darauf folgt die allgemeine Erörterung zur erkenntnisgeleiteten Fragestellung „Wie verbindet die wissenschaftliche Beobachtung WSA mit der Profession?“ (3.). Im Anschluss an diese theoretische Darstellung wird Bezug auf die Beobachtungsmethode „Leuvener Engagiertheits-Skala“ (4.) genommen, die Anwendung in der Kindertagesstätte findet. Ein allgemeines Fazit (5.) schließt diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinition
- 2.1 Begriffserklärung Wissenschaft, Disziplin und Profession
- 2.2 Die Beobachtungsmethoden in der Wissenschaft der Sozialen Arbeit
- 2.3 Kategorien wissenschaftlicher Beobachtungsmethoden
- 3. Beobachtung als Bindeglied zwischen WSA und Profession
- 4. Wissenschaftliche Beobachtung in der Praxis
- 4.1 Kindheitsforschung
- 4.2 Die teilnehmende Beobachtung in der Kindertagesstätte
- 4.3 Beobachtungsverfahren „Leuvener Engagiertheits-Skala für Kinder“
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen wissenschaftlicher Beobachtung und der Profession der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet den Theorie-Praxis-Konflikt in der Sozialen Arbeit und die Rolle wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Professionalisierung. Die Arbeit analysiert den Begriff der wissenschaftlichen Beobachtung und ihre Anwendung in der Praxis.
- Die Abgrenzung von Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen in der Sozialen Arbeit
- Die Definition von "Wissenschaft", "Disziplin" und "Profession" im Kontext der Sozialen Arbeit
- Die Rolle der wissenschaftlichen Beobachtung als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis
- Die Anwendung wissenschaftlicher Beobachtungsmethoden in der Praxis, speziell in der Kindheitsforschung
- Die Bedeutung der Professionalisierung der Sozialen Arbeit durch wissenschaftliche Fundierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Theorie-Praxis-Konflikt in der Sozialen Arbeit dar und führt die zentrale Fragestellung ein: Wie verbindet die wissenschaftliche Beobachtung die Wissenschaft der Sozialen Arbeit (WSA) mit der Profession? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und betont die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Profession der Sozialen Arbeit, basierend auf der Definition der International Federation of Social Workers (IFSW).
2. Begriffsdefinition: Dieses Kapitel legt das theoretische Fundament der Arbeit. Es differenziert zwischen den Begriffen "Wissenschaft", "Disziplin" und "Profession", wobei die Wissenschaft als methodisch systematische Forschungsarbeit definiert wird, die Disziplin als an Universitäten lehrbares Wissen und die Profession als Spezialisierung und Verwissenschaftlichung beruflicher Handlungen. Die Debatte um die Professionalisierung in der Sozialen Arbeit wird angesprochen, mit Fokus auf das Verhältnis von wissenschaftlicher Fundierung und beruflicher Praxis.
3. Beobachtung als Bindeglied zwischen WSA und Profession: Dieses Kapitel (dessen Inhalt aus dem gegebenen Textfragment nicht vollständig ersichtlich ist) wird sich voraussichtlich mit der konkreten Rolle der wissenschaftlichen Beobachtung als Brücke zwischen theoretischem Wissen (WSA) und praktischer Anwendung in der Sozialen Arbeit befassen. Es wird vermutlich die Bedeutung von empirischen Daten und deren Einbezug in die professionelle Praxis beleuchten.
4. Wissenschaftliche Beobachtung in der Praxis: Dieses Kapitel wird vermutlich verschiedene Beispiele für wissenschaftliche Beobachtungsmethoden in der Praxis der Sozialen Arbeit vorstellen. Anhand von Beispielen wie der Kindheitsforschung und der teilnehmenden Beobachtung in Kindertagesstätten, sowie der "Leuvener Engagiertheits-Skala für Kinder", wird die Anwendung und der Nutzen wissenschaftlicher Beobachtung in konkreten Settings illustriert. Der Fokus wird auf der praktischen Anwendung und der Relevanz für die professionelle Arbeit liegen.
Schlüsselwörter
Wissenschaft der Sozialen Arbeit (WSA), Professionalisierung, wissenschaftliche Beobachtung, Disziplin, Profession, Theorie-Praxis-Konflikt, empirische Forschung, Kindheitsforschung, teilnehmende Beobachtung, Leuvener Engagiertheits-Skala.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wissenschaftliche Beobachtung in der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Verbindung zwischen wissenschaftlicher Beobachtung und der Profession der Sozialen Arbeit. Sie beleuchtet den Theorie-Praxis-Konflikt und die Rolle wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Professionalisierung. Ein zentraler Aspekt ist die Analyse des Begriffs der wissenschaftlichen Beobachtung und deren Anwendung in der Praxis, insbesondere in der Kindheitsforschung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Abgrenzung von Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen in der Sozialen Arbeit, die Definition von "Wissenschaft", "Disziplin" und "Profession" im Kontext der Sozialen Arbeit, die Rolle der wissenschaftlichen Beobachtung als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis, die Anwendung wissenschaftlicher Beobachtungsmethoden (z.B. teilnehmende Beobachtung) in der Praxis, speziell in der Kindheitsforschung, und die Bedeutung der Professionalisierung der Sozialen Arbeit durch wissenschaftliche Fundierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsdefinition (inkl. Begriffserklärung von Wissenschaft, Disziplin und Profession und Beobachtungsmethoden), Beobachtung als Bindeglied zwischen Wissenschaft der Sozialen Arbeit (WSA) und Profession, Wissenschaftliche Beobachtung in der Praxis (inkl. Beispiele aus der Kindheitsforschung und der Anwendung der Leuvener Engagiertheits-Skala für Kinder) und Fazit.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Verbindung zwischen wissenschaftlicher Beobachtung und der Profession der Sozialen Arbeit aufzuzeigen und den Theorie-Praxis-Konflikt zu beleuchten. Sie möchte die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse für die Professionalisierung der Sozialen Arbeit verdeutlichen und die Anwendung wissenschaftlicher Beobachtungsmethoden in der Praxis analysieren.
Welche Schlüsselbegriffe werden verwendet?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Wissenschaft der Sozialen Arbeit (WSA), Professionalisierung, wissenschaftliche Beobachtung, Disziplin, Profession, Theorie-Praxis-Konflikt, empirische Forschung, Kindheitsforschung, teilnehmende Beobachtung, Leuvener Engagiertheits-Skala.
Wie wird der Begriff der "wissenschaftlichen Beobachtung" definiert?
Die Arbeit definiert "Wissenschaft" als methodisch systematische Forschungsarbeit, "Disziplin" als an Universitäten lehrbares Wissen und "Profession" als Spezialisierung und Verwissenschaftlichung beruflicher Handlungen. Die wissenschaftliche Beobachtung wird als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis in der Sozialen Arbeit verstanden und ihre Anwendung in konkreten Settings wird anhand von Beispielen illustriert.
Welche Rolle spielt die Kindheitsforschung in der Arbeit?
Die Kindheitsforschung dient als Beispiel für die praktische Anwendung wissenschaftlicher Beobachtungsmethoden in der Sozialen Arbeit. Die Arbeit zeigt anhand von Beispielen wie der teilnehmenden Beobachtung in Kindertagesstätten und der "Leuvener Engagiertheits-Skala für Kinder" auf, wie wissenschaftliche Beobachtung in diesem Kontext eingesetzt und für die professionelle Arbeit nutzbar gemacht wird.
Wie wird der Theorie-Praxis-Konflikt in der Sozialen Arbeit behandelt?
Die Arbeit thematisiert den Theorie-Praxis-Konflikt als zentralen Punkt in der Sozialen Arbeit. Sie untersucht, wie die wissenschaftliche Beobachtung als Brücke zwischen Theorie und Praxis dienen kann und wie wissenschaftliche Erkenntnisse zur Professionalisierung beitragen können. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der empirischen Fundierung professionellen Handelns.
- Quote paper
- Katrin Edler (Author), 2013, Wie verbindet die wissenschaftliche Beobachtung die Wissenschaft der Sozialen Arbeit mit der Profession?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/302710