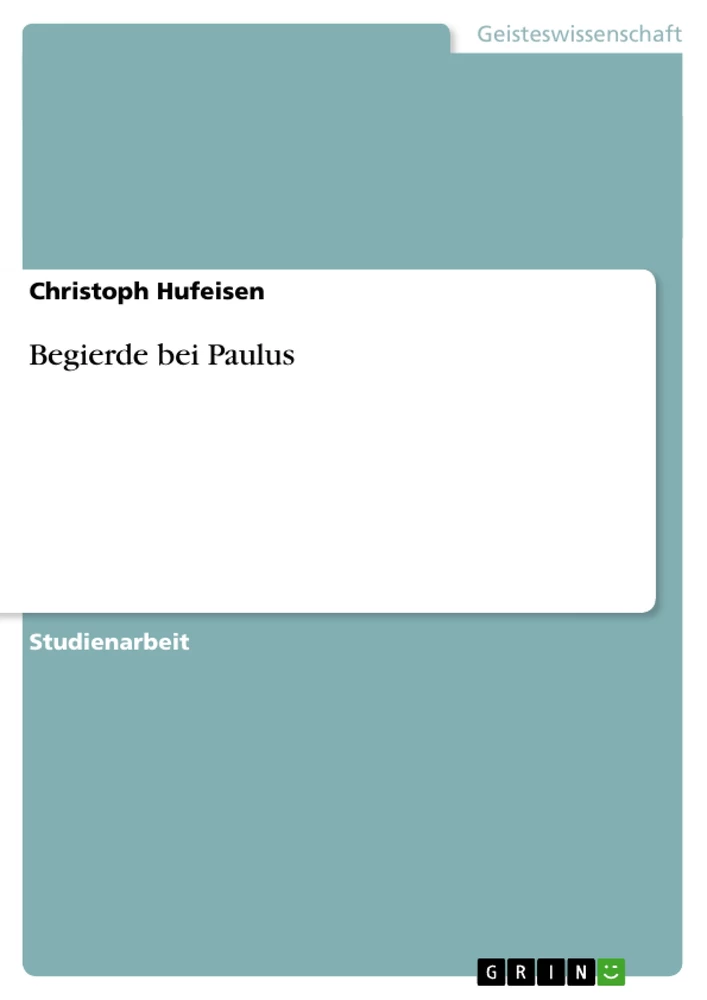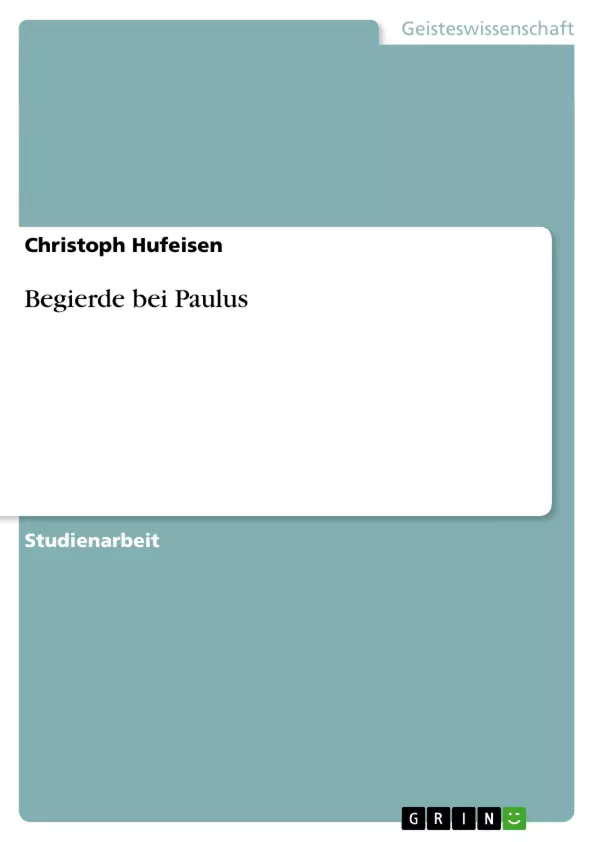Im Folgenden werde ich untersuchen, auf welche Art Paulus den Begriff
„Begehren“ verstanden hat. Mein besonderes Interesse gilt dabei dem Punkt, dass
häufig lediglich eine Verdammung der Sexualität aus den paulinischen Briefen
herausgelesen wurde, so dass eine verheerende Einstellung gegenüber der eigenen
Körperlichkeit entstand. Ich möchte prüfen ob der Begriff nicht allumfassender
gebraucht wurde und ob manches Begehren nicht auch für Paulus positive Kräfte
freisetzt. Außerdem scheint auch die Frage nach seinem Bild der Körperlichkeit
hiermit im engen Zusammenhang zu stehen.
Die Abfassungsverhältnisse der Brieftexte müssen dabei Bestandteil dieser
Untersuchung sein, denn sonst wird die Absicht des Autors nur unzureichend
ermittelt.1 Paulus vertraute seiner brieflichen Argumentation offenbar mehr als
persönlicher Anwesenheit und insgesamt lassen sich die Briefe der Gattung der
„beratenden Rede“ zuordnen. 2
Weiterhin werde ich nach einem kurzen Abschnitt zur Quellenlage die von Paulus
im Zusammenhang mit der Begierde benutzen Wörter einer Untersuchung
unterziehen. Der damalige Gebrauch mag einiges von der Intention des Paulus bei
ihrer Verwendung verraten.
Im weiteren Verlauf der Arbeit möchte ich auf die psychologischen
Anschauungen Paulus eingehen. Der Begriff „Leib“ ist zu bestimmen wenn man
sich der Begierde nähern will. Außerdem ist wichtig zu ergründen, warum Paulus
uns heutigen Lesern so emotionslos erscheint.
Das Verhältnis Trieb, Gesetz, Begierde und Sünde wird später beleuchtet, ebenso
das von Geist und Begierde.
Der Sexualität bei Paulus ist ein eigener Abschnitt gewidmet, da er sie „exklusiv
unter dem Aspekt der Begierde“3 versteht.
Interessant ist natürlich auch, ob sich das Verständnis der Begierde in seine Lehre
weiterentwickelte, oder eine festgesetzte Größe war, dazu werde ich in den
Schlussbetrachtungen Stellung nehmen.
Sofern nicht anders angegeben werde ich mit der „Revidierten Elberfelder Bibel“4
arbeiten, da diese meist nahe an den Übersetzungen der Kommentare bleibt.
1 Vgl. Conzelmann, Hans; Lindemann, Andreas: Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Tübingen,
2000, S. 42
2 Vgl. ebd. S. 224 f.
3 Berger, Klaus: Historische Psychologie des Neuen Testaments, Stuttgart, 1991, S. 283
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Quellen
- Zuordnung dieser Textstellen
- BEGEHREN
- Leib und Selbst
- Der „innere Mensch\" bei Paulus
- Gefühle bei Paulus
- Begierde
- Die Herrschaft der Begierde
- Gegen Fehldeutungen
- Psychologische und theologische Bedeutung von Begierde
- Begierde und Gesetz
- Der Heide und die Begierde
- Der Mensch von Gesetz, Begierde und Sünde befe
- SEXUALITÄT BEI PAULUS
- SCHLUSSBETRACHTUNGEN
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht, wie Paulus den Begriff „Begehren“ verstand. Der Fokus liegt auf der häufigen Interpretation paulinischer Briefe, die lediglich eine Verdammung der Sexualität hervorhebt und zu einer negativen Einstellung gegenüber der eigenen Körperlichkeit führt. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob der Begriff „Begehren“ nicht umfassender gebraucht wurde und ob manche Formen des Begehrens für Paulus nicht auch positive Kräfte freisetzen. Ebenso wird der Zusammenhang mit Paulus' Bild der Körperlichkeit betrachtet.
- Paulus' Verständnis des Begriffs „Begehren“
- Die Verbindung von „Begehren“ und der Körperlichkeit im Denken des Paulus
- Die mögliche Unterscheidung zwischen positiven und negativen Formen des Begehrens bei Paulus
- Die Bedeutung der Abfassungsverhältnisse der paulinischen Briefe für die Interpretation seiner Aussagen
- Die Rolle des „Leibes“ und der „inneren Person“ in der paulinischen Theologie
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Forschungsfrage und den Fokus der Untersuchung dar. Die Bedeutung der Abfassungsverhältnisse der Briefe für das Verständnis von Paulus' Aussagen wird hervorgehoben.
- Der Abschnitt über die Quellen befasst sich mit der Authentizität der paulinischen Briefe und identifiziert die Briefe, die als sicher von Paulus verfasst gelten. Die wichtigsten Textstellen, die für die Untersuchung des Begriffs „Begehren“ relevant sind, werden aufgelistet.
- Das Kapitel „BEGEHREN“ beleuchtet den Begriff „Leib“ und die Vorstellung des „inneren Menschen“ bei Paulus. Die Bedeutung von Gefühlen, insbesondere der Begierde, in der paulinischen Theologie wird untersucht. Die Herrschaft der Begierde, ihre möglichen Fehldeutungen sowie ihre psychologische und theologische Bedeutung werden diskutiert.
- Der Abschnitt „SEXUALITÄT BEI PAULUS“ behandelt die Rolle der Sexualität in der paulinischen Theologie. Dabei steht der Aspekt der Begierde im Vordergrund und es wird untersucht, ob Paulus die Sexualität ausschließlich negativ bewertet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der paulinischen Theologie, insbesondere mit dem Begriff „Begehren“ und seinem Zusammenhang mit der Körperlichkeit. Wichtige Konzepte sind die Unterscheidung zwischen „Leib“ und „innerer Mensch“, die Rolle von Gefühlen und die Bedeutung des Gesetzes in der paulinischen Lehre. Die Analyse der Abfassungsverhältnisse der paulinischen Briefe sowie die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Interpretationen der Begierde bilden weitere wichtige Schwerpunkte.
Häufig gestellte Fragen
Verdammte Paulus die Sexualität generell?
Die Arbeit untersucht, ob Paulus' Briefe wirklich eine totale Ablehnung der Körperlichkeit lehren oder ob der Begriff der Begierde differenzierter zu betrachten ist.
Was versteht Paulus unter dem Begriff „Leib“ (soma)?
Der Begriff „Leib“ wird im Zusammenhang mit der menschlichen Existenz und dem „inneren Menschen“ analysiert, um Paulus' Sicht auf die Körperlichkeit zu klären.
Kann Begierde laut Paulus auch positive Kräfte freisetzen?
Die Untersuchung geht der Frage nach, ob es Formen des Begehrens gibt, die nicht rein negativ (als Sünde) gewertet werden, sondern spirituell konstruktiv sein können.
Wie ist das Verhältnis von Gesetz, Begierde und Sünde?
Paulus beschreibt eine komplexe Dynamik, in der das Gesetz die Begierde oft erst bewusst macht oder verstärkt, was wiederum zur Sünde führt.
Warum wirken Paulus' Texte oft so emotionslos auf moderne Leser?
Die Arbeit beleuchtet die psychologischen Anschauungen der Antike und die spezifische Gattung der „beratenden Rede“, der seine Briefe angehören.
- Quote paper
- Christoph Hufeisen (Author), 2004, Begierde bei Paulus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30406