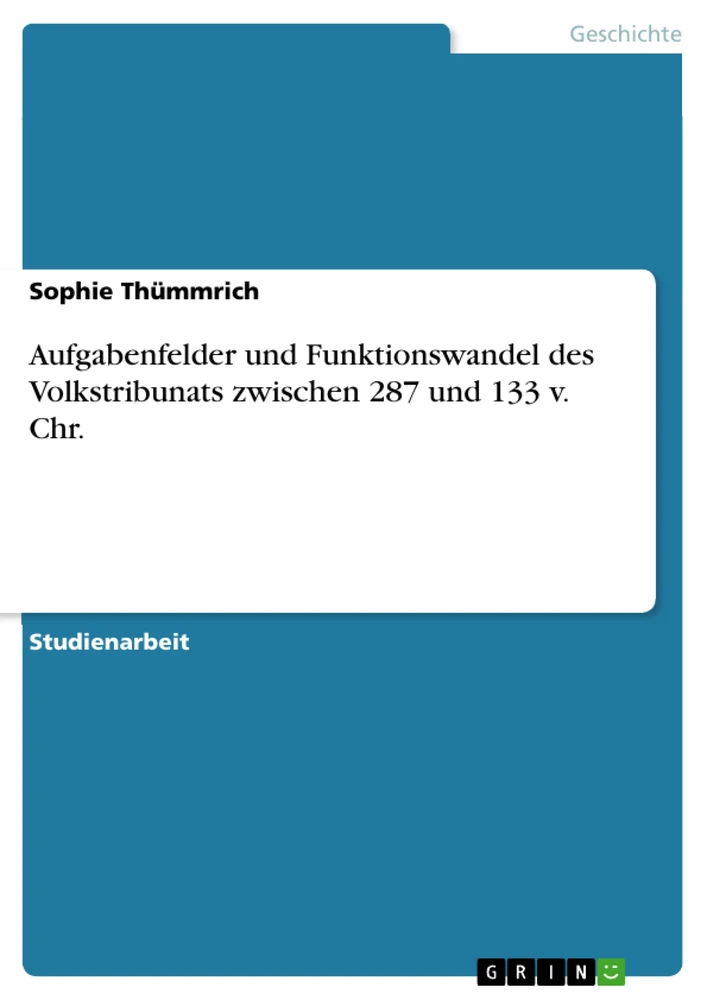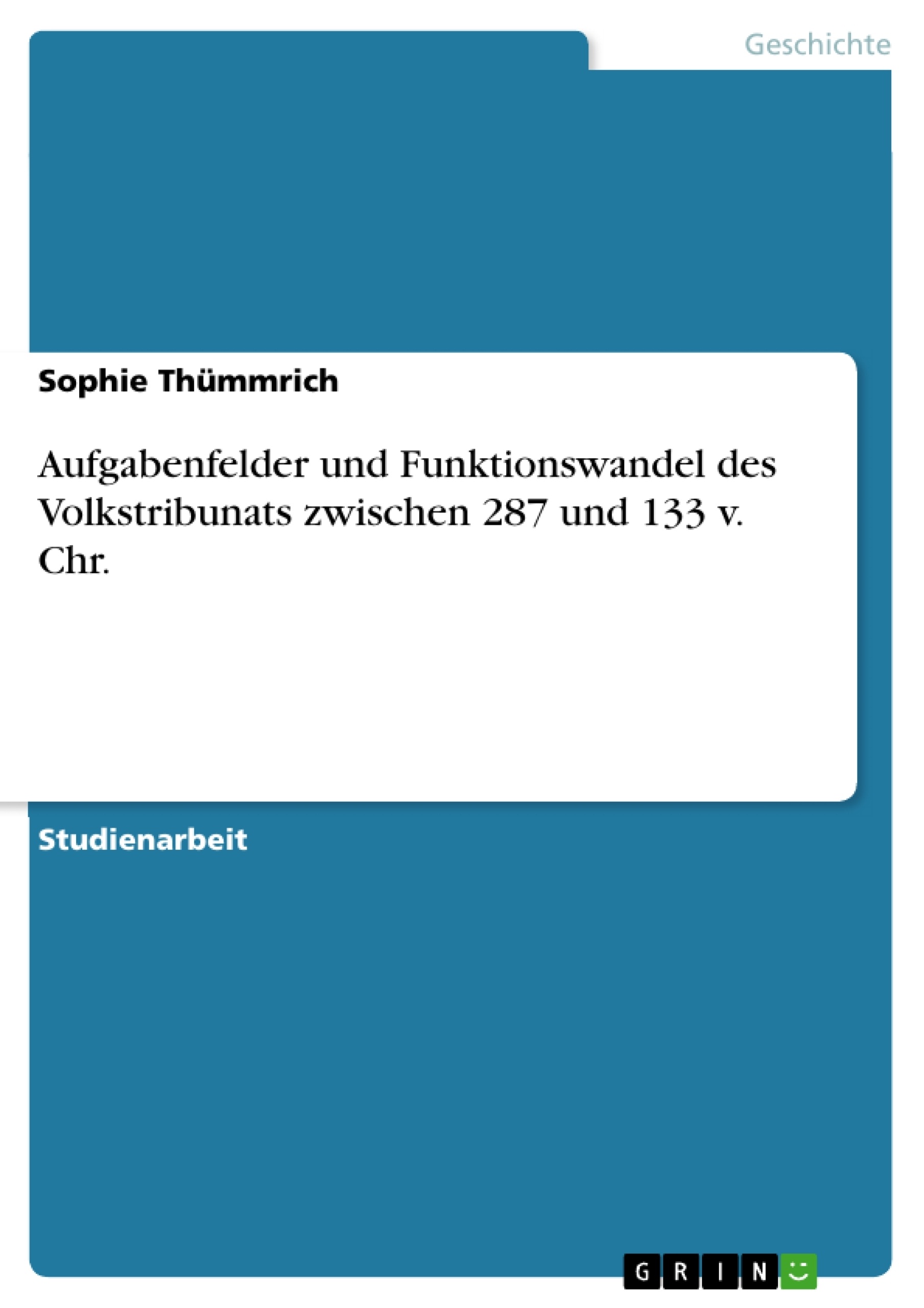Jochen Bleicken teilt in seinem Werk zum Volkstribunat in seiner Einleitung die Geschichte dieses Amtes in drei Perioden ein. In der ersten Periode beschreibt er das Volkstribunat während der Ständekämpfe als revolutionäres Amt. Im zweiten Zeitabschnitt, der sich etwa über 150 Jahre erstreckt, benennt Bleicken das Amt als legalisiertes Tribunat, das im Sinne der staatlichen Politik agierte. Im letzten Jahrhundert der Römischen Republik wird es mit Beginn der Gracchenherrschaft erneut als revolutionäres Tribunat bezeichnet.
In der vorliegenden Arbeit werden die Funktionen des Volkstribunats in dieser zweiten Periode, insbesondere der Zeitraum zwischen 287 und 133 v. Chr., genauer untersucht. Es soll ergründet werden, inwiefern sich die Aufgabenfelder des Amtes verändert haben. Daneben wird hinterfragt, ob das Amt tatsächlich der Senatspolitik folgte. Dazu wird zunächst nach der ursprünglichen Funktion des Volkstribunats gefragt, die im Zusammenhang mit seiner Entstehung steht.
Anschließend wird die Bedeutung der lex Hortensia thematisiert. Zu klären gilt, inwieweit dieses Gesetz den Funktionswandel des Volkstribunats wirklich beeinflusste. Im nächsten Unterpunkt wird die Entwicklung des Amtes analysiert. Dabei wird versucht, anhand ausgewählter Beispiele aus dem Werk des Titus Livius die Rolle der Volkstribune zu bestimmen. Folgend werden Gründe genannt, weshalb das Amt, trotz seiner umfangreichen Möglichkeiten, nicht beschnitten wurde.
Die Quellenlage zur Thematik ist eher schlecht. Man findet lediglich fragmentarisch Beschreibungen zum Volkstribunat vor. Wie oben erwähnt, bildet in dieser Arbeit Liviusʼ Werk Ab urbe condita die Quellenbasis, da hier die Überlieferung am dienlichsten ist. Theodor Mommsens „Römisches Staatsrecht“ ist Grundlagenliteratur in Bezug auf die Beschreibung des Volkstribunats als Institution. Jedoch beschreibt Mommsen eher den Aufbau des Amtes und weniger den Wandel innerhalb der Republik.
Sehr viel Forschung zum Thema wurde von dem eingangs genannten Historiker Bleicken betrieben. Die Seminararbeit stützt sich zu großen Teilen auf seine Arbeiten wie „Das Volkstribunat der klassischen Republik“, das in der zweiten Auflage 1968 erschien, oder den Aufsatz „Das römische Volkstribunat. Versuch einer Analyse seiner politischen Funktion in republikanischer Zeit“, der 1981 in der Zeitschrift Chiron veröffentlicht wurde. Außerdem wurde ein Aufsatz von Karl-J. Hölkeskamp (1988) herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursprüngliche Funktion
- Die Bedeutung der lex Hortensia
- Entwicklung bis 133 v. Chr.
- Handeln im Sinne des Senats
- Handeln gegen den Senat
- Gründe für die Beibehaltung des Amtes
- Zusammenfassende Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit befasst sich mit der Funktion des Volkstribunats in der Römischen Republik zwischen 287 und 133 v. Chr. Sie untersucht, wie sich die Aufgabenfelder des Amtes in dieser Periode verändert haben und inwieweit die Volkstribune tatsächlich der Senatspolitik folgten.
- Die ursprüngliche Funktion des Volkstribunats während der Ständekämpfe
- Der Einfluss der lex Hortensia auf die Entwicklung des Amtes
- Die Rolle der Volkstribune im Hinblick auf die Senatspolitik
- Die Gründe für die Beibehaltung des Volkstribunats trotz seiner großen Machtbefugnisse
- Die Quellenlage zur Thematik und die verwendeten wissenschaftlichen Arbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den historischen Kontext und die Forschungsfrage dar. Sie grenzt die Forschungsperiode auf das Volkstribunat zwischen 287 und 133 v. Chr. ein und beleuchtet die Bedeutung dieser Periode für die Entwicklung des Amtes.
Ursprüngliche Funktion
Dieses Kapitel untersucht die Entstehung des Volkstribunats während der Ständekämpfe und beleuchtet seine ursprüngliche Funktion als revolutionäres Amt der Plebejer. Es werden die wichtigsten Rechte und Aufgaben der Volkstribune, wie das Interzessionsrecht und das Rogationsrecht, im Detail betrachtet.
Die Bedeutung der lex Hortensia
Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung der lex Hortensia für den Funktionswandel des Volkstribunats. Es wird diskutiert, inwieweit das Gesetz die Verbindlichkeit der Plebiszite beeinflusste und den Volkstribunen eine größere politische Macht verleihen konnte.
Entwicklung bis 133 v. Chr.
Dieses Kapitel untersucht die Entwicklung des Volkstribunats zwischen 287 und 133 v. Chr. anhand von Beispielen aus dem Werk des Titus Livius. Es analysiert, wie die Volkstribune in dieser Zeit agierten und inwieweit sie den Interessen des Senats oder denen des Volkes folgten.
Gründe für die Beibehaltung des Amtes
Dieses Kapitel betrachtet die Gründe, warum das Volkstribunat trotz seiner großen Machtbefugnisse nicht beschnitten wurde. Es wird diskutiert, welche Faktoren die Beibehaltung des Amtes in der römischen Verfassung begünstigten.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind das Volkstribunat, die lex Hortensia, die Ständekämpfe, die Senatspolitik, die plebejischen Interessen, die Aufgabenfelder des Amtes, die Entwicklung des Volkstribunats, die Quellenlage zur Thematik und die wissenschaftliche Literatur zum Thema.
- Arbeit zitieren
- Sophie Thümmrich (Autor:in), 2013, Aufgabenfelder und Funktionswandel des Volkstribunats zwischen 287 und 133 v. Chr., München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304285