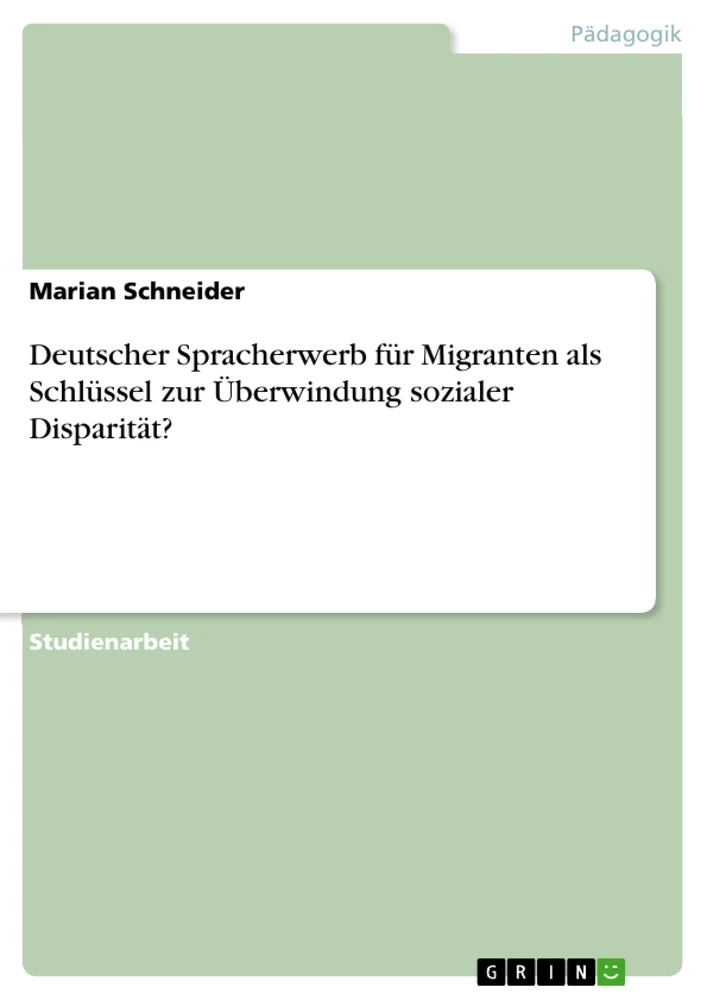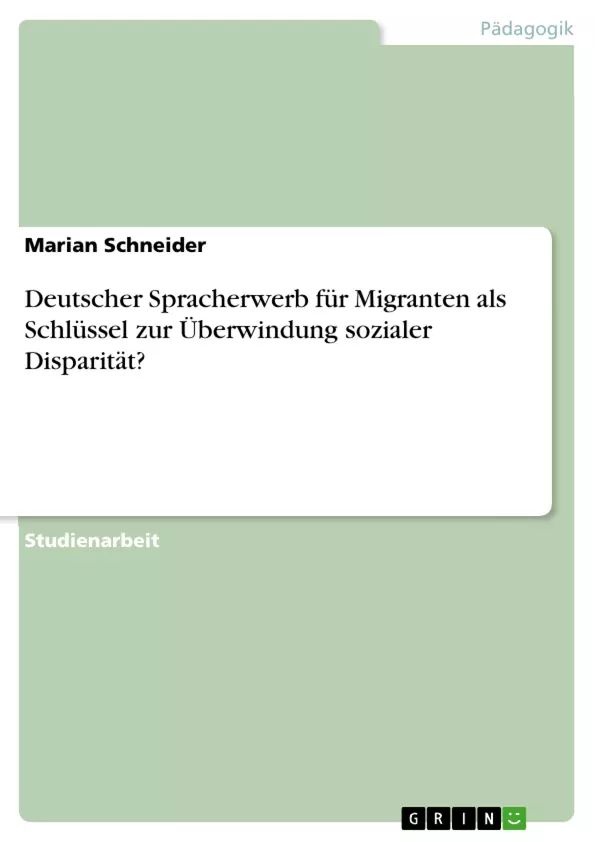Migration und Integration haben sich im Laufe des 20. Jahrhunderts zu zentralen Megatrends heutiger Industrienationen entwickelt. Aufgrund von Kriegen, Wirtschaftskrisen, demografischer Umgestaltungen und der Verpflichtung zur Aufnahme von Einwanderern als Folge der Politik internationaler Bündnissysteme, müssen Länder wie Deutschland ein integratives Bildungs- und Beschäftigungssystem bieten, das Chancengleichheit und einen sozialen Aufstieg für Migranten gleichermaßen zulässt.
In diesem Integrationsprozess kommt der Sprache eine Schlüsselfunktion zu: Der deutsche Spracherwerb ist für eine nachhaltige Integration von Migranten essentiell und eine wesentliche Voraussetzung für erfolgreiche schulische Karrieren und Bildungsabschlüsse innerhalb Deutschlands.
Diese These wird in der vorliegenden Seminararbeit näher untersucht indem die Einwanderergeneration beleuchtet wird, die die deutsche Sprache nicht beherrschen bzw. mit massiven Mängeln zu kämpfen haben. Hier sind oft berufliche Benachteiligung und Chancenungleichheit auf dem Arbeitsmarkt trotz ausreichender Qualifikationen und Bildungstitel die Folge. In diesem Kontext wird das Problem der Überwindung der sozialen Disparität fokussiert und herausgearbeitet, inwiefern sich ein Bildungs- bzw. sozialer Aufstieg bestehender und nachfolgender Generationen durch einen vollwertigen deutschen Spracherwerb und ausschließlicher Verwendung dieser im Aufnahmeland, realisieren lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung und Tragweite der sozialen Ungleichheit in der Einwanderungsgesellschaft
- Migration und Integration im historischen Rückblick Deutschlands
- Ursachen und Bedeutungen der sozialen Ungleichheit
- Fortbestehen schichttypischer Ungleichheiten
- Zusammenfassung
- Der Wert der Sprache als kulturelles Kapital (nach Bourdieu)
- Bilinguale Erziehung – Kompromiss von Identität und sprachlicher Adaption?
- These: Bildungs- und Schichtaufstieg durch sprachliche Assimilation
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Bedeutung der Sprache für den Bildungs- und sozialen Aufstieg von Migranten in Deutschland. Dabei wird die These untersucht, ob ein vollwertiger deutscher Spracherwerb und die ausschließliche Verwendung der deutschen Sprache im Aufnahmeland den sozialen Aufstieg ermöglichen.
- Soziale Ungleichheit in der Einwanderungsgesellschaft
- Migration und Integration in Deutschland
- Sprache als kulturelles Kapital (Bourdieu)
- Bilinguale Erziehung
- Sprachliche Assimilation und sozialer Aufstieg
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung der Hausarbeit dar und zeigt die Relevanz des Themas auf. Im zweiten Kapitel wird die Entstehung und Tragweite der sozialen Ungleichheit in der Einwanderungsgesellschaft beleuchtet. Hierbei wird ein historischer Rückblick auf die Migration und Integration in Deutschland gegeben, sowie die Ursachen und Auswirkungen der sozialen Ungleichheit analysiert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Wert der Sprache als kulturelles Kapital und führt in Bourdieus Kapitaltheorie ein. Im vierten Kapitel wird die bilinguale Erziehung von Kindern aus Einwandererfamilien untersucht und die Frage aufgeworfen, ob diese ein Kompromiss zwischen Identitätswahrung und sprachlicher Adaption ist. Das fünfte Kapitel widmet sich der These, dass Bildungs- und Schichtaufstieg durch sprachliche Assimilation möglich ist.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Einwanderungsgesellschaft, Migration, Integration, Sprache, kulturelles Kapital, Bourdieu, bilinguale Erziehung, sprachliche Assimilation, Bildungs- und Schichtaufstieg.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der deutsche Spracherwerb entscheidend für Migranten?
Sprache gilt als Schlüsselfunktion für nachhaltige Integration, schulischen Erfolg und den Zugang zum Arbeitsmarkt, um soziale Disparitäten zu überwinden.
Was bedeutet Sprache als „kulturelles Kapital“ nach Bourdieu?
Nach Pierre Bourdieu ist Sprache eine Ressource, die sozialen Status und Macht verleiht. Wer die dominante Sprache nicht beherrscht, verfügt über weniger kulturelles Kapital und hat geringere Aufstiegschancen.
Führt ausschließliche Nutzung der deutschen Sprache zum sozialen Aufstieg?
Die Arbeit untersucht die These der sprachlichen Assimilation. Während Deutschkenntnisse essenziell sind, wird auch diskutiert, ob die Verdrängung der Muttersprache Identitätskonflikte auslösen kann.
Ist bilinguale Erziehung ein Hindernis oder eine Chance?
Bilinguale Erziehung wird als Kompromiss zwischen Identitätswahrung und sprachlicher Adaption betrachtet. Sie kann kognitive Vorteile bieten, erfordert aber eine gezielte Förderung beider Sprachen.
Welche Folgen haben mangelnde Deutschkenntnisse auf dem Arbeitsmarkt?
Trotz vorhandener Qualifikationen führen Sprachbarrieren oft zu beruflicher Benachteiligung, Chancenungleichheit und dem Verbleib in niedrigeren sozialen Schichten.
- Quote paper
- Marian Schneider (Author), 2014, Deutscher Spracherwerb für Migranten als Schlüssel zur Überwindung sozialer Disparität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305081