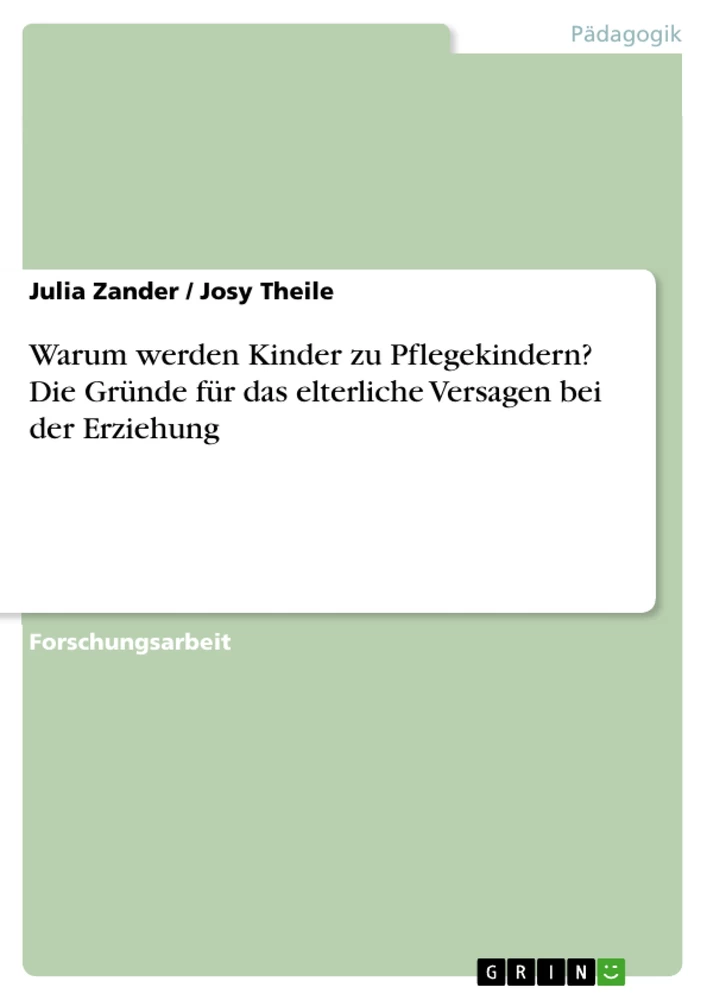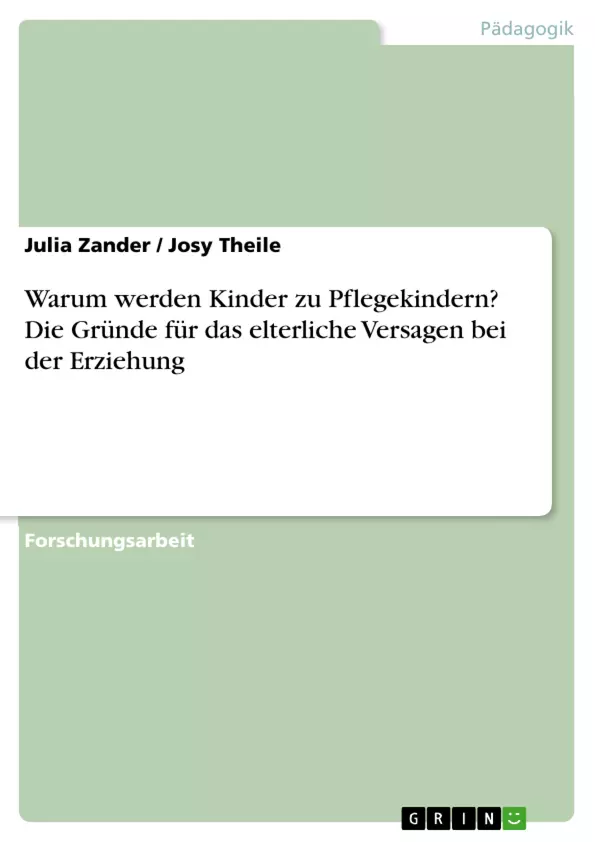Die Zahl der Pflegekinder in Deutschland steigt seit Jahren kontinuierlich an. Zum einen werden die betroffenen Kinder aus ihren gewohnten familiären Strukturen herausgerissen und zum anderen bedeuten die steigenden Zahlen der Inobhutnahmen eine enorm hohe finanzielle Mehrbelastung für den Staat.
Doch auch weitere wesentliche Faktoren spielen bei dem Thema Pflegschaft eine große Rolle, denn nicht jedes Pflegekind findet eine liebevolle Pflegefamilie. Nur wenn auch die Zahl der Pflegefamilien steigt, kann eine familiäre Unterbringung für die betroffenen Pflegekinder gewährleistet werden. Dazu kommt eine Vielzahl an Problemen, die berücksichtigt werden müssen. Es wird immer versucht, zugunsten des Kindes zu handeln und dabei unnötige „Übergangsunterbringungsmöglichkeiten“ zu vermeiden. Im günstigsten Fall soll das Kind nach der Perspektivklärung seine endgültige Unterbringung erhalten.
Pflege und Erziehung sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst obliegende Pflicht gemäß Artikel 6 GG i.V. mit § 1 SGB VIII. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Die Aufgabe des Jugendamtes ist es, den Schutz eines jeden Kindes sicherzustellen. Überdies muss es in diesem Zusammenhang seiner Kontrollfunktion nachgehen, denn nicht alle Eltern sind in der Lage ihren Kindern ein harmonisches und angemessenes Leben sowie eine altersentsprechende Entwicklung und Förderung zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1 Einleitung
- 2 Projektfindung und Forschungsstand
- 2.1 Pflegekinder in Sachsen
- 2.2 Vorstellung des Forschungsprojektes
- 3 Methodisches Vorgehen
- 3.1 Auswertungsmethode
- 3.2 Forschungsverlauf
- 3.3 ursprüngliche Vorgehensweise
- 4 Auswertung und Ergebnisse des Forschungsprojektes
- 4.1 Der Ansatz
- 4.1.1 Die Leitfragen
- 4.2 Das Pflegekind
- 4.2.1 Das Transkript
- 4.2.2 Das Interview mit Hanna Blum
- 4.3 Die Herkunftseltern
- 4.3.1 Das Transkript
- 4.3.2 Familie Müller/Lohse
- 4.3.3 Frau Grigat
- 4.3.4 Familie Liebl/Kaiser
- 4.4 zentrale Ergebnisse
- 4.5 Eindrücke des Forschungsprojektes
- 4.1 Der Ansatz
- 5 Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieses Forschungsprojekt befasst sich mit der Frage, warum Eltern in der Erziehung ihrer Kinder versagen und diese somit zu Pflegekindern werden. Ziel ist es, die Ursachen der Inobhutnahme von Kindern durch das Jugendamt zu erforschen und die Lebenssituation der Herkunftsfamilien zu beleuchten. Um die Ursachen zu ergründen, wurden Interviews mit Herkunftseltern, Pflegekindern und Mitarbeitern des Pflegekinderdienstes geführt.
- Die wachsende Zahl der Pflegekinder in Deutschland und die damit verbundenen finanziellen Belastungen für den Staat
- Die Herausforderungen der familiären Unterbringung von Pflegekindern und die Bedeutung der Suche nach geeigneten Pflegefamilien
- Die Rechtssituation von Kindern und Jugendlichen sowie die Rolle des Jugendamtes im Schutz des Kindeswohls
- Die Ursachen der Kindeswohlgefährdung und der damit verbundenen Inobhutnahmen durch das Jugendamt
- Die Notwendigkeit einer effektiven Zusammenarbeit aller Beteiligten im Umgang mit Pflegekindern
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet die steigende Zahl der Pflegekinder in Deutschland und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gesellschaft. Sie stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Betreuung und Erziehung von Kindern sowie die Aufgabe des Jugendamtes im Schutz des Kindeswohls dar.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Projektfindung und dem Forschungsstand. Es werden die Entstehung des Pflegekinderwesens in Sachsen, die Rolle des Pflegekinderdienstes sowie die Bedeutung der Zusammenarbeit aller Beteiligten im Umgang mit Pflegekindern beleuchtet.
Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen des Forschungsprojektes. Es werden die Auswertungsmethode, der Forschungsverlauf sowie die ursprüngliche Vorgehensweise des Projektes vorgestellt.
Kapitel 4 präsentiert die Auswertung und Ergebnisse des Forschungsprojektes. Es werden die Leitfragen, die Lebenssituation des Pflegekindes sowie die Situation der Herkunftseltern analysiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Pflegekinder, Kindeswohlgefährdung, Inobhutnahme, Jugendamt, Herkunftseltern, Pflegefamilien, Erziehung, Familienleben, Rechtssituation, Sozialarbeit, Forschungsprojekt, Interviews.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die häufigsten Gründe für eine Inobhutnahme durch das Jugendamt?
Häufige Gründe sind elterliches Versagen bei der Erziehung, Kindeswohlgefährdung durch Vernachlässigung, Gewalt oder die Unfähigkeit der Eltern, eine altersentsprechende Förderung zu gewährleisten.
Welche Rolle spielt das Jugendamt beim Schutz des Kindeswohls?
Das Jugendamt hat eine staatliche Kontrollfunktion. Es muss eingreifen, wenn das Wohl des Kindes in der Herkunftsfamilie nicht mehr sichergestellt ist, und eine angemessene Unterbringung organisieren.
Warum steigt die Zahl der Pflegekinder in Deutschland an?
Die Gründe sind vielfältig, liegen aber oft in zunehmenden sozialen Belastungen der Familien und einer sensibilisierten Wahrnehmung von Kindeswohlgefährdungen durch Behörden.
Was ist das Ziel einer „Perspektivklärung“?
Ziel ist es, so schnell wie möglich zu entscheiden, ob ein Kind dauerhaft in einer Pflegefamilie bleibt oder in die Herkunftsfamilie zurückkehren kann, um unnötige Übergangslösungen zu vermeiden.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Suche nach Pflegefamilien?
Es mangelt oft an geeigneten Familien, die bereit und in der Lage sind, Kinder mit traumatischen Hintergründen aufzunehmen. Nur durch eine steigende Zahl von Pflegefamilien kann eine familiäre Unterbringung garantiert werden.
- Quote paper
- Julia Zander (Author), Josy Theile (Author), 2014, Warum werden Kinder zu Pflegekindern? Die Gründe für das elterliche Versagen bei der Erziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305396