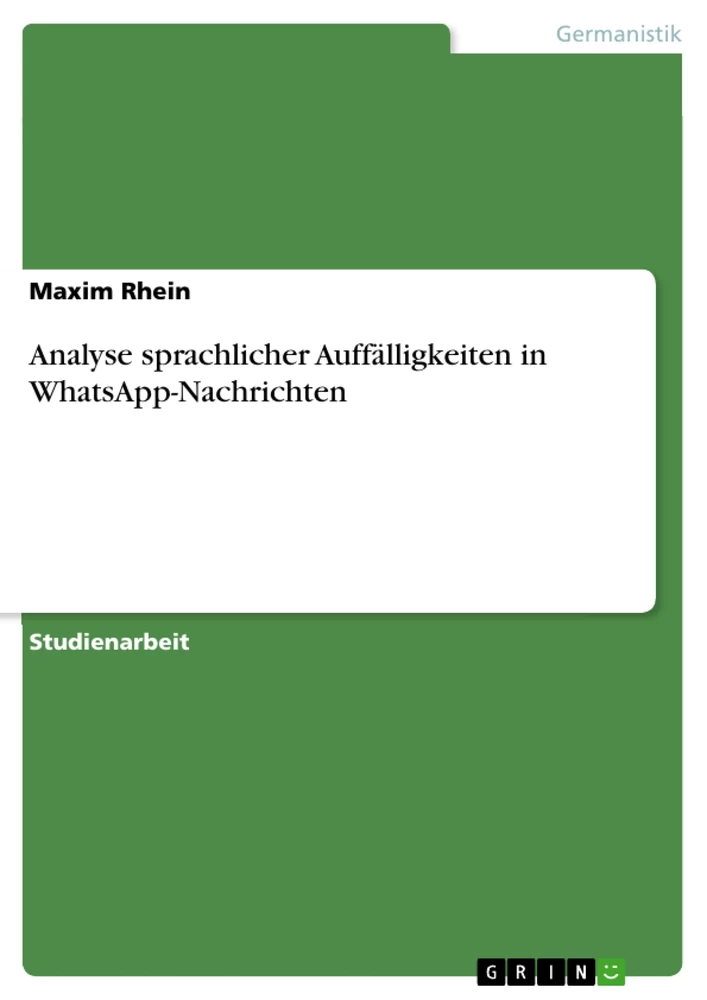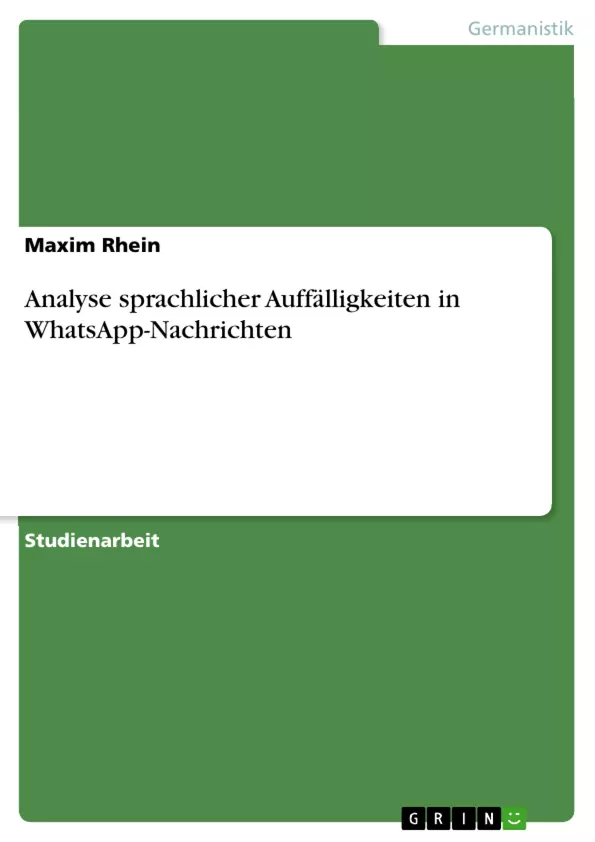Ziel dieser Hausarbeit ist es, einen Überblick über das Schreibverhalten in dem Anwendungsprogramm „WhatsApp“ zu geben. Der Autor hat zu diesem Zweck Textbeispiele aus der App gesammelt und auf ihre Auffälligkeiten hin analysiert. Bei dieser Analyse geht er auf die sprachlichen Merkmale der WhatsApp-Kommunikation ein, wobei der Begriff „konzeptionelle Mündlichkeit“ eine bedeutende Rolle spielt.
Im weiteren Verlauf geht die Hausarbeit näher auf die sprachlichen Merkmale eingegangen, sodass der Fokus auf verschiedene Tilgungen gelegt wird. Zum einen betrachtet sie die Tilgung des Subjektpronomens, der Artikel und der Präpositionen. Zu anderen geht sie auf die wortfinale und -initiale Tilgung ein. Auch die Groß- und Kleinschreibung und die Enklise nehmen in dieser Hausarbeit eine wichtige Position ein und werden in Bezug auf ihre Auffälligkeiten genauer untersucht.
Inhaltsverzeichnis (Inhaltsverzeichnis)
- Einleitung
- Definition und Erläuterung
- Was ist unter WhatsApp zu verstehen?
- Sprachliche Merkmale der WhatsApp-Kommunikation
- Konzeptionelle Mündlichkeit
- Syntaktische Kurzformen
- Tilgung des Subjektpronomens und weiteren Tilgungen
- Wortfinale und wortinitiale Tilgungen
- Enklisen
- Groß- und Kleinschreibung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit hat zum Ziel, einen Überblick über das Schreibverhalten in dem Anwendungsprogramm „WhatsApp“ zu geben. Dazu werden Textbeispiele aus dieser App analysiert, um sprachliche Auffälligkeiten zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf das Konzept der „konzeptionellen Mündlichkeit“ und dessen Einfluss auf verschiedene sprachliche Merkmale wie Tilgungen und Enklisen.
- Konzeptionelle Mündlichkeit in der WhatsApp-Kommunikation
- Analyse verschiedener Tilgungen (Subjektpronomen, Artikel, Präpositionen, wortfinale und -initiale Tilgungen)
- Die Rolle von Enklisen in der WhatsApp-Kommunikation
- Die Auswirkungen technischer Einstellungen und automatischer Korrekturen auf die Schreibweise
- Die Bedeutung von Kurzformen und umgangssprachlichen Ausdrücken in WhatsApp-Nachrichten
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel der Hausarbeit stellt die Relevanz der WhatsApp-Kommunikation in der heutigen Zeit dar und führt mit einem Beispiel den Fokus der Arbeit auf die sprachlichen Merkmale von WhatsApp-Nachrichten ein.
Im zweiten Kapitel wird das Anwendungsprogramm „WhatsApp“ näher erläutert, um einen ersten Eindruck dieser App mit ihren Funktionen und Anwendungen zu vermitteln.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den sprachlichen Merkmalen der WhatsApp-Kommunikation. Es wird zunächst das Konzept der konzeptionellen Mündlichkeit eingeführt und verschiedene Tilgungen, wie die Tilgung des Subjektpronomens, Artikel und Präpositionen, sowie wortfinale und -initiale Tilgungen, analysiert. Des Weiteren wird das Phänomen der Enklise anhand von Beispielen aus WhatsApp-Nachrichten untersucht.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Groß- und Kleinschreibung in WhatsApp-Nachrichten. Es wird gezeigt, wie technische Einstellungen und automatische Korrekturen zu Fehlern in der Schreibweise führen können.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind: WhatsApp-Kommunikation, konzeptionelle Mündlichkeit, Tilgungen, Enklisen, Groß- und Kleinschreibung, Kurzformen, Umgangssprache, technische Einstellungen, Autokorrektur, Smartphone, App, Chat, Sprachliche Merkmale, Textbeispiele, Analyse.
- Quote paper
- Maxim Rhein (Author), 2015, Analyse sprachlicher Auffälligkeiten in WhatsApp-Nachrichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305834