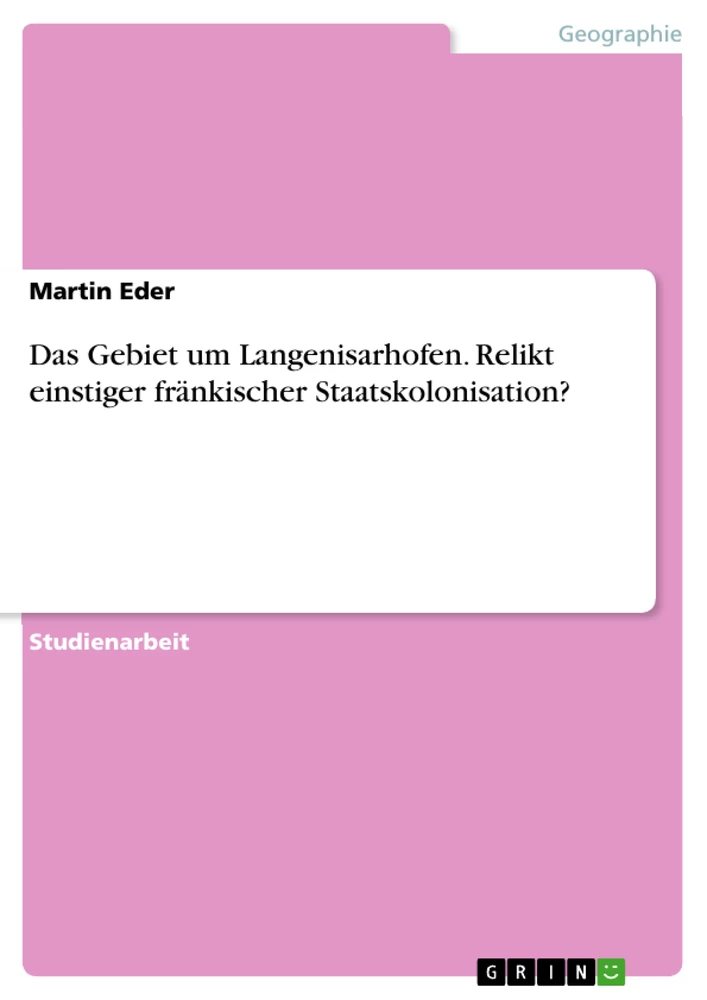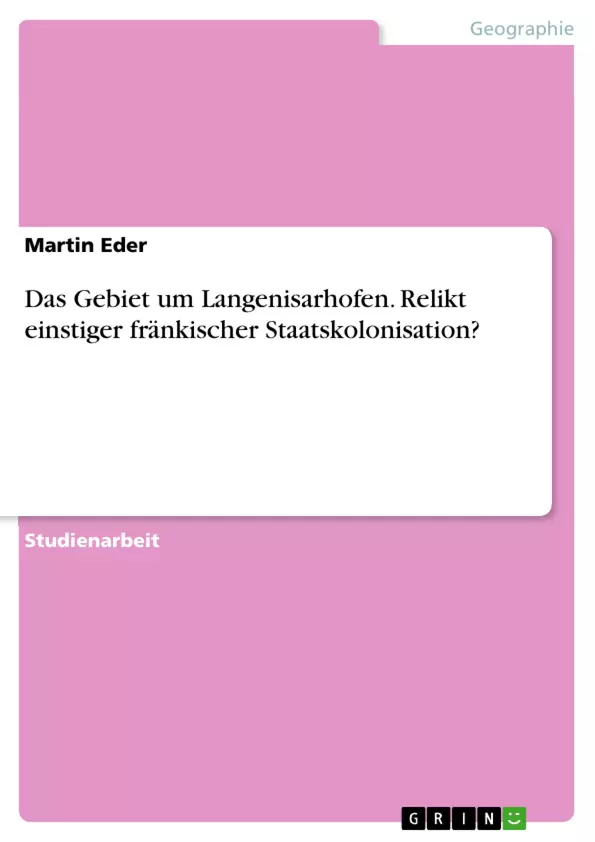Untersuchungsgegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit soll das Gebiet zwischen Langenisarhofen, Moos und Niederalteich sein, welches auf Siedlungsspuren einstiger Bewohner und Anzeichen der Fränkischen Staatskolonisation untersucht werden soll. Die grundlegende Fragestellung lautet dabei: Wurde dieses Gebiet tatsächlich durch die Fränkische Staatskolonisation geprägt und wenn ja, welche Indizien sprechen dafür?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fragestellung und Auswahl der Methoden
- Datierung und namenshistorische Gründung Langenisarhofens
- Schema- und Funktionsnamen von Siedlungen
- Vergleich einer Satellitenaufnahme mit einem Schrägluftbild
- Martinspatrozinien als besonderes Merkmal fränkischer Siedlungen
- Langstreifenmuster als weiteres Charakteristikum fränkischer Siedlungsgenese
- Die besondere Lage des Gebiets um Langenisarhofen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Gebiet um Langenisarhofen auf Spuren fränkischer Staatskolonisation. Die zentrale Frage ist, ob und inwiefern die Region durch diese Kolonisation geprägt wurde. Die Analyse stützt sich auf verschiedene Methoden, insbesondere die Interpretation von Karten, Luft- und Satellitenbildern.
- Namensgeschichtliche Analyse von Langenisarhofen
- Analyse von Siedlungsmustern und -strukturen
- Auswertung von Kartenmaterial und Luftbildern
- Die Rolle von Martinspatrozinien in fränkischen Siedlungen
- Bedeutung der Lage Langenisarhofens im Kontext des Gäubodens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht das Gebiet zwischen Langenisarhofen, Moos und Niederalteich auf Siedlungsspuren und Anzeichen fränkischer Staatskolonisation. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wurde dieses Gebiet durch die fränkische Staatskolonisation geprägt, und wenn ja, welche Indizien sprechen dafür? Die Untersuchung beschränkt sich aufgrund des Umfangs der Arbeit und der Verfügbarkeit von Quellenmaterial auf die Interpretation von jüngeren Karten, Luft- und Satellitenbildern.
Fragestellung und Auswahl der Methoden: Die Arbeit untersucht Orts- und Flurformen sowie Namen als Indikatoren historischer Entwicklungen. Die Analyse konzentriert sich auf die Erklärung der Gegenwart aus der Vergangenheit und die Rekonstruktion vergangener Siedlungsprozesse. Methodisch stützt sich die Arbeit auf die Interpretation von Karten, Luft- und Satellitenbildern aufgrund der Beschränkungen hinsichtlich des Zugangs zu älteren Kartenmaterialien.
Datierung und namenshistorische Gründung Langenisarhofens: Die Endung "-hofen" im Ortsnamen Langenisarhofen deutet auf eine Gründung im 7.-10. oder 12.-14. Jahrhundert hin. Diese Datierung korreliert mit der frühgeschichtlichen Landnahmezeit (3./4. bis 8./9. Jahrhundert). Die Lage Langenisarhofens im fruchtbaren Gäuboden und die damalige Präferenz für Einzelhof- und Kleingruppensiedlungen werden diskutiert. Die Erwähnung Isarhofens in einer Güterbeschreibung des Klosters Niederalteich vor 741 liefert zusätzliche Informationen zur frühen Besiedlung.
Schema- und Funktionsnamen von Siedlungen: Dieses Kapitel befasst sich mit der These Oskar Bethges über den Zusammenhang zwischen schematischen Ortsnamen (z.B. -heim, -hofen, -hausen, -dorf) und der fränkischen Siedlungsorganisation. Die Arbeit diskutiert die Überprüfung dieser These durch spätere Forscher und die Bedeutung von Ortsnamen im Kontext der karolingischen Großgrundherrschaft, unter Bezugnahme auf die capitulare de villis.
Schlüsselwörter
Fränkische Staatskolonisation, Langenisarhofen, Siedlungsgeschichte, Ortsnamenforschung, Karteninterpretation, Luftbildinterpretation, Satellitenbildinterpretation, Gäuboden, Siedlungsmuster, Frühmittelalter.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Gebiets um Langenisarhofen auf Spuren fränkischer Staatskolonisation
Was ist das Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Gebiet um Langenisarhofen auf Spuren fränkischer Staatskolonisation. Die zentrale Frage ist, ob und inwiefern die Region durch diese Kolonisation geprägt wurde.
Welche Methoden wurden angewendet?
Die Analyse stützt sich auf verschiedene Methoden, insbesondere die Interpretation von Karten, Luft- und Satellitenbildern, sowie die namenshistorische Analyse von Langenisarhofen und die Analyse von Siedlungsmustern und -strukturen. Aufgrund von Einschränkungen beim Zugang zu älteren Kartenmaterialien, konzentriert sich die Arbeit auf die Interpretation jüngeren Kartenmaterials und Luftbilder.
Wie wird Langenisarhofen datiert und welche Bedeutung hat der Ortsname?
Die Endung "-hofen" im Ortsnamen Langenisarhofen deutet auf eine Gründung im 7.-10. oder 12.-14. Jahrhundert hin. Diese Datierung korreliert mit der frühgeschichtlichen Landnahmezeit. Die Lage im fruchtbaren Gäuboden und die damalige Präferenz für Einzelhof- und Kleingruppensiedlungen werden diskutiert. Die Erwähnung Isarhofens vor 741 in einer Güterbeschreibung des Klosters Niederalteich liefert zusätzliche Informationen.
Welche Rolle spielen Schema- und Funktionsnamen von Siedlungen?
Dieses Kapitel befasst sich mit der These Oskar Bethges über den Zusammenhang zwischen schematischen Ortsnamen (z.B. -heim, -hofen, -hausen, -dorf) und der fränkischen Siedlungsorganisation. Die Arbeit diskutiert die Überprüfung dieser These durch spätere Forscher und die Bedeutung von Ortsnamen im Kontext der karolingischen Großgrundherrschaft, unter Bezugnahme auf die capitulare de villis.
Welche Bedeutung haben Martinspatrozinien und Langstreifenmuster?
Die Arbeit untersucht Martinspatrozinien als besonderes Merkmal fränkischer Siedlungen und Langstreifenmuster als weiteres Charakteristikum fränkischer Siedlungsgenese im Kontext des untersuchten Gebiets.
Welche Bedeutung hat die geographische Lage Langenisarhofens?
Die Arbeit diskutiert die besondere Lage des Gebiets um Langenisarhofen, insbesondere im Kontext des Gäubodens, und deren Bedeutung für die Siedlungsgeschichte.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Fränkische Staatskolonisation, Langenisarhofen, Siedlungsgeschichte, Ortsnamenforschung, Karteninterpretation, Luftbildinterpretation, Satellitenbildinterpretation, Gäuboden, Siedlungsmuster, Frühmittelalter.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zur Einleitung, Fragestellung und Methodenwahl, Datierung und Namensgeschichte Langenisarhofens, Schema- und Funktionsnamen von Siedlungen, Vergleich von Satelliten- und Schrägluftbildern, Martinspatrozinien, Langstreifenmuster, der besonderen Lage des Gebiets, einem Fazit und einem Literaturverzeichnis.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wurde das Gebiet um Langenisarhofen durch die fränkische Staatskolonisation geprägt, und wenn ja, welche Indizien sprechen dafür?
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich aufgrund des Umfangs und der Verfügbarkeit von Quellenmaterial auf die Interpretation von jüngeren Karten, Luft- und Satellitenbildern.
- Citation du texte
- Martin Eder (Auteur), 2010, Das Gebiet um Langenisarhofen. Relikt einstiger fränkischer Staatskolonisation?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306300