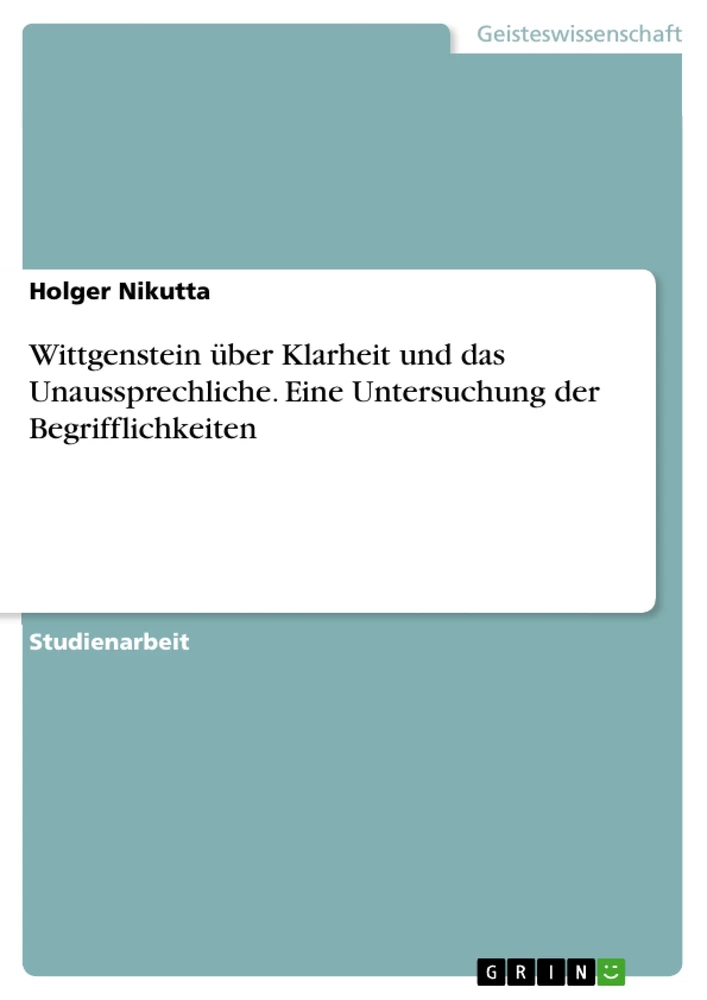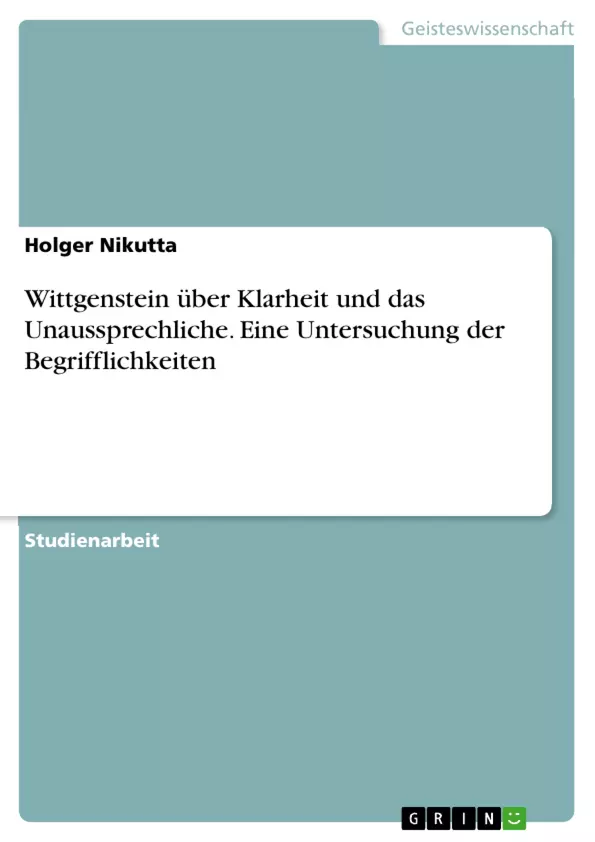In seiner Logisch-philosophischen Abhandlung bzw. dem Tractatus logico-philosophicus beschäftigt sich Wittgenstein u.a. mit den Fragen, was unsere Sprache leisten kann und welche Grenzen dieser und damit auch uns, als Subjekten der Sprache, gesetzt sind. Generell trennt er dabei formal zwischen dem klar Sagbaren und dem Unaussprechlichem.
Die Aufgabe des vorliegenden Essays ist es, zu untersuchen, inwieweit beide Pole miteinander in Einklang gebracht werden können. Die Arbeit bezieht sich lediglich auf Wittgensteins Frühwerk, namentlich den Tractatus. Der erste Teil stellt einen Erklärungsversuch dar, was genau Wittgenstein unter dem Unsagbaren und dem Sagbaren versteht, worauf dann eine Betrachtung des Verhältnisses der beiden folgt. Zuletzt Zuletzt wird eine Synthese dargestellt, indem sich dem angenähert wird, was bei Wittgenstein über die rational-logische Betrachtung der Welt hinausgeht.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Über Sagbares und Unaussprechliches
- Wie scharf ist die Trennung von Sagbarem und Unaussprechlichem?
- Sagbares und Unsagbares - eine Synthese?
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Dieser Essay befasst sich mit Wittgensteins Konzeption des Sagbaren und Unaussprechlichen im Kontext seiner Logisch-philosophischen Abhandlung. Der Fokus liegt darauf, die Grenzen der Sprache und des Denkens zu erforschen, die Wittgenstein in seinem Werk definiert, und die Beziehung zwischen dem klar Sagbaren und dem Unsagbaren zu analysieren.
- Die Definition des Sagbaren und Unaussprechlichen bei Wittgenstein
- Die Trennung zwischen dem Logisch-Wissenschaftlichen und dem Nicht-Wissenschaftlichen
- Die Rolle des Schweigegebots im Kontext von Ethik und Lebensproblemen
- Die Frage nach der Zugänglichkeit des Unaussprechlichen für die Sprache
- Die Analyse der Schärfe der Trennung zwischen Sagbarem und Unaussprechlichem
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Der Essay legt die zentrale Fragestellung dar, ob das Sagbare und Unaussprechliche miteinander in Einklang gebracht werden können. Er fokussiert auf Wittgensteins Frühwerk, den Tractatus, und skizziert die Analyse des Sagbaren und Unsagbaren.
- Über Sagbares und Unaussprechliches: Dieses Kapitel beleuchtet Wittgensteins Unterscheidung zwischen dem klar Sagbaren, das sich logisch-naturwissenschaftlich beschreiben lässt, und dem Unaussprechlichen, zu dem Dinge wie Liebe, Tod und Gott gehören. Das Schweigegebot Wittgensteins wird eingeführt, das darauf hinweist, dass über das Unsagbare nicht sinnvoll gesprochen werden kann.
- Wie scharf ist die Trennung von Sagbarem und Unaussprechlichem?: Das Spannungsverhältnis zwischen Sagbarem und Unaussprechlichem wird näher beleuchtet. Die Argumentation, dass eine Überschreitung der Grenze zwischen Sinn und Unsinn nicht möglich ist, wird anhand von Wittgensteins Aussagen über die Grenzen des Denkens und der Sprache illustriert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen dieses Essays sind Wittgenstein, Tractatus, Sagbares, Unaussprechliches, Schweigegebot, Logik, Sprache, Wissenschaft, Ethik, Lebensprobleme, Sinn, Unsinn, Trennung, Grenze, Klarheit, Präzision.
- Quote paper
- Holger Nikutta (Author), 2015, Wittgenstein über Klarheit und das Unaussprechliche. Eine Untersuchung der Begrifflichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307351