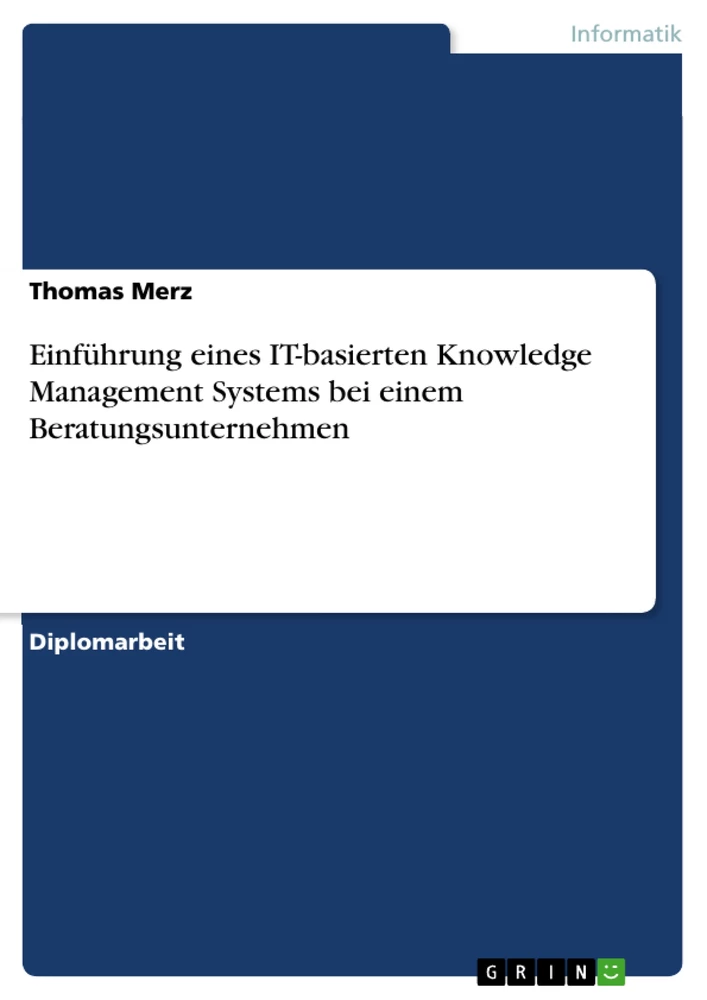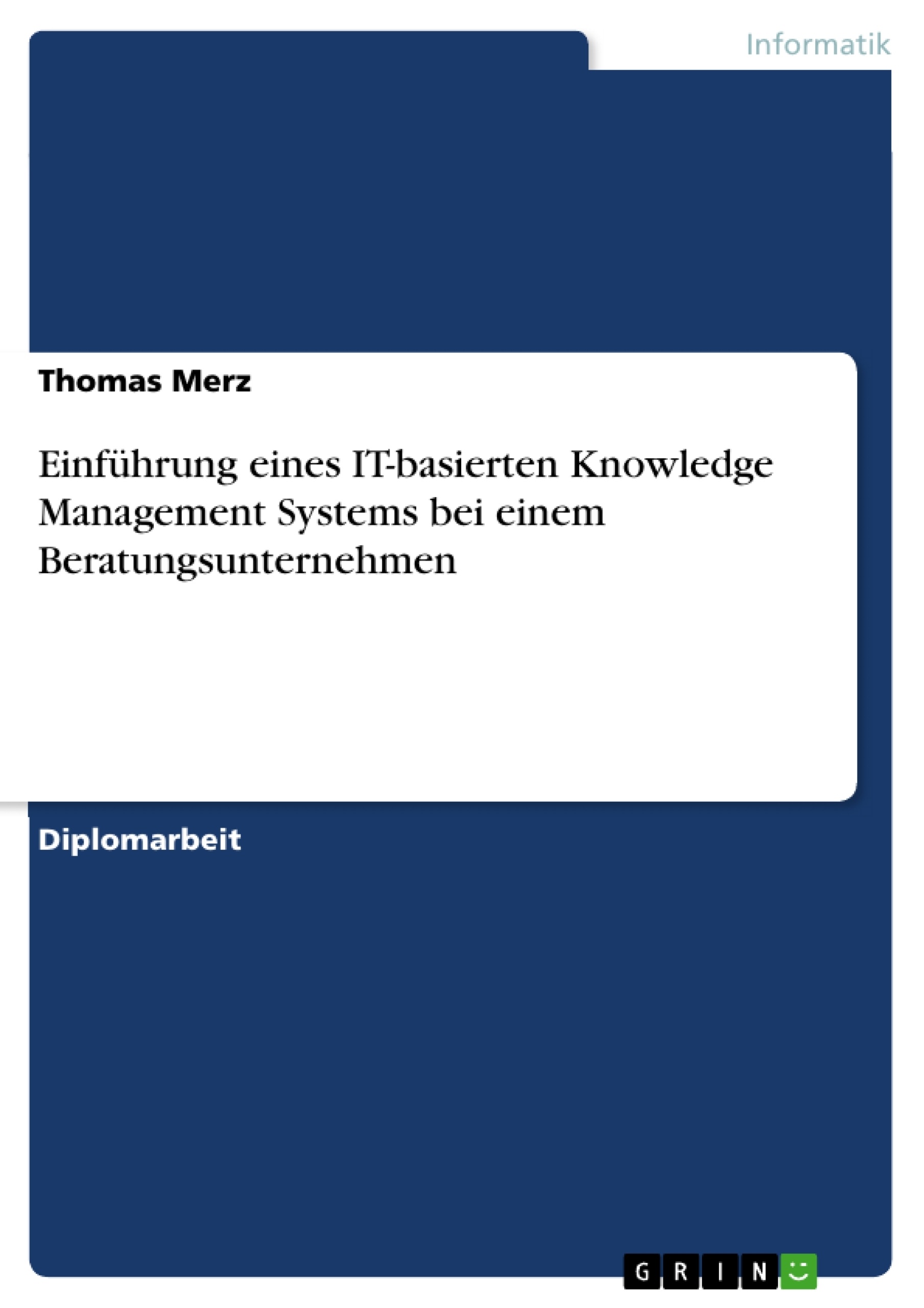Nach einer ausführlichen Einführung in die Thematik des Knowledge Management werden theoretische Aspekte, wie Ziele und Bausteine des Knowledge Management, und im besonderem solche der Wissenstransformation dargestellt. Anhand eines „Baukastensystems“ soll Managern ein praktischer Anhaltspunkt für das Planen und Steuern sogenannter „Soft Assets“ im Unternehmen gegeben werden. Es werden Instrumente für die Identifikation von Wissen vorgestellt, nämlich die Knowledge-Map und der Knowledge-Broker. Diese Instrumente ermöglichen einen optimalen Wissensschaffungsprozeß. Es wird dargestellt, wie Instrumente, Methoden, Prozesse, Vorgehensweisen und Werkzeugen zur Gesamtheit von Knowledge Management beitragen und wie die Unternehmenskultur Eingriffe und Einschnitte durch Knowledge Management erfährt. Im besonderen werden zwei Ausprägungen für optimale Aufbau- und Ablauforganisationsstrukturen vorgestellt. Als das modernste Managementkonzept überhaupt wird der Einsatz von „Organizational Memory Information Systems“ im Intranet vorgestellt. Dies wird anhand einer pragmatischen, beispielhaften Umsetzung beschrieben, in der vorhandene Datenquellen („Wissensarchive“) integriert werden. Dabei werden aktuelle Softwarewerkzeuge unter Beachtung ganzheitlicher Ansätze des Knowledge Management auf ihre Tauglichkeit für Knowledge Management in einem Beratungsunternehmen hin untersucht. Diese Untersuchung gibt einen Blick auf den aktuellen Stand der Technik und versucht einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung und Zielsetzung
- 1.1 Bedeutung von Knowledge Management
- 1.1.1 Wissen als Ressource begreifen
- 1.1.2 Notwendigkeit des Knowledge Management
- 1.2 Erwartungen und Ziele
- 1.3 Überblick
- 2 Die Theorie des Knowledge Management
- 2.1 Begriffe der Informationstheorie
- 2.2 Wissen - Information im Kontext
- 2.2.1 Implizites Wissen
- 2.2.2 Explizites Wissen
- 2.2.3 Echtes Wissen
- 2.3 Informationsmanagement vs. Knowledge Management
- 2.4 Ansätze des Knowledge Management
- 2.4.1 Der Humanorientierte Ansatz
- 2.4.2 Der Technologieorientierte Ansatz
- 2.4.3 Umfassender Knowledge Management-Ansatz
- 2.5 Ziele des Knowledge Management (Nonaka/Takeuchi)
- 2.5.1 Sozialisation
- 2.5.2 Externalisierung
- 2.5.3 Kombination
- 2.5.4 Internalisierung
- 2.5.5 Finales Überführen in Kollektivwissen
- 2.6 Bausteine des Knowledge Management (Probst, Raub, Romhardt)
- 2.6.1 Wissensziele
- 2.6.2 Wissensidentifikation
- 2.6.3 Wissenserwerb
- 2.6.4 Wissensentwicklung
- 2.6.5 Wissensverteilung
- 2.6.5.1 Zentrale Wissensverteilung
- 2.6.5.2 Dezentrale Wissensverteilung
- 2.6.6 Wissensnutzung
- 2.6.7 Wissensbewahrung
- 2.6.8 Wissensbewertung
- 2.6.9 Kritik des Modells
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Einführung eines IT-basierten Knowledge Management Systems in einem Beratungsunternehmen. Das Hauptziel ist die praktische Anwendung theoretischer Konzepte des Knowledge Management und die Evaluierung geeigneter Softwarewerkzeuge. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Wissensintegration und -verbreitung innerhalb des Unternehmens.
- Bedeutung von Wissen als Ressource in Beratungsunternehmen
- Theoretische Grundlagen und Modelle des Knowledge Management
- Analyse und Vergleich verschiedener Ansätze des Knowledge Management
- Identifikation geeigneter IT-basierter Lösungen für Knowledge Management
- Einfluss von Knowledge Management auf die Unternehmenskultur und -organisation
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung und Zielsetzung: Dieses einführende Kapitel legt die Bedeutung von Knowledge Management in Beratungsunternehmen dar und definiert die Ziele der Arbeit. Es skizziert den Umfang der Untersuchung und gibt einen Überblick über die Struktur der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Notwendigkeit, Wissen als strategische Ressource zu betrachten und die Herausforderungen bei der Implementierung eines Knowledge Management Systems zu adressieren.
2 Die Theorie des Knowledge Management: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen des Knowledge Management. Es definiert wichtige Begriffe aus der Informationstheorie, unterscheidet zwischen implizitem und explizitem Wissen und beleuchtet verschiedene Ansätze des Knowledge Management, darunter den humanorientierten und den technologieorientierten Ansatz. Die Kapitel analysiert die Ziele des Knowledge Management nach Nonaka/Takeuchi und die Bausteine nach Probst, Raub und Romhardt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Wissensverteilung, -nutzung und -bewahrung. Die kritische Auseinandersetzung mit den vorgestellten Modellen rundet das Kapitel ab.
Schlüsselwörter
Knowledge Management, Wissensmanagement, Beratungsunternehmen, IT-basierte Systeme, Wissenstransformation, Wissensverteilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung, Organizational Memory Information Systems, Wissensarchive, Softwarewerkzeuge.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Knowledge Management in Beratungsunternehmen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Diese Diplomarbeit untersucht die Einführung eines IT-basierten Knowledge Management Systems in einem Beratungsunternehmen. Das Hauptziel ist die praktische Anwendung theoretischer Konzepte des Knowledge Management und die Evaluierung geeigneter Softwarewerkzeuge. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Möglichkeiten der Wissensintegration und -verbreitung innerhalb des Unternehmens.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Bedeutung von Wissen als Ressource in Beratungsunternehmen, theoretische Grundlagen und Modelle des Knowledge Management, Analyse und Vergleich verschiedener Ansätze des Knowledge Management, Identifikation geeigneter IT-basierter Lösungen für Knowledge Management und den Einfluss von Knowledge Management auf die Unternehmenskultur und -organisation.
Welche theoretischen Konzepte des Knowledge Management werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene Ansätze des Knowledge Management, darunter den humanorientierten und den technologieorientierten Ansatz. Es werden die Ziele des Knowledge Management nach Nonaka/Takeuchi und die Bausteine nach Probst, Raub und Romhardt analysiert. Besonderes Augenmerk liegt auf der Wissensverteilung, -nutzung und -bewahrung. Die Arbeit definiert wichtige Begriffe aus der Informationstheorie und unterscheidet zwischen implizitem und explizitem Wissen.
Welche Modelle des Knowledge Management werden untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert das Modell von Nonaka/Takeuchi zu den Zielen des Knowledge Management (Sozialisation, Externalisierung, Kombination, Internalisierung, Überführung in Kollektivwissen) und das Modell von Probst, Raub und Romhardt zu den Bausteinen des Knowledge Management (Wissensziele, -identifikation, -erwerb, -entwicklung, -verteilung, -nutzung, -bewahrung, -bewertung). Die Modelle werden kritisch diskutiert.
Welche Aspekte der Wissensverteilung werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen zentraler und dezentraler Wissensverteilung im Kontext des Modells von Probst, Raub und Romhardt und analysiert die jeweiligen Vor- und Nachteile.
Welche Rolle spielt die IT im Kontext dieser Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Implementierung eines IT-basierten Knowledge Management Systems. Ein wichtiger Aspekt ist die Identifikation und Evaluierung geeigneter Softwarewerkzeuge zur Unterstützung des Wissensmanagements.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Knowledge Management, Wissensmanagement, Beratungsunternehmen, IT-basierte Systeme, Wissenstransformation, Wissensverteilung, Wissensnutzung, Wissensbewahrung, Organizational Memory Information Systems, Wissensarchive, Softwarewerkzeuge.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in ein einführendes Kapitel, ein Kapitel zur Theorie des Knowledge Management und weitere Kapitel, die die praktischen Aspekte der Implementierung eines Knowledge Management Systems behandeln (genaue Kapitelstruktur entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis der Arbeit).
- Arbeit zitieren
- Dipl.Inf.(FH) Thomas Merz (Autor:in), 1999, Einführung eines IT-basierten Knowledge Management Systems bei einem Beratungsunternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3076