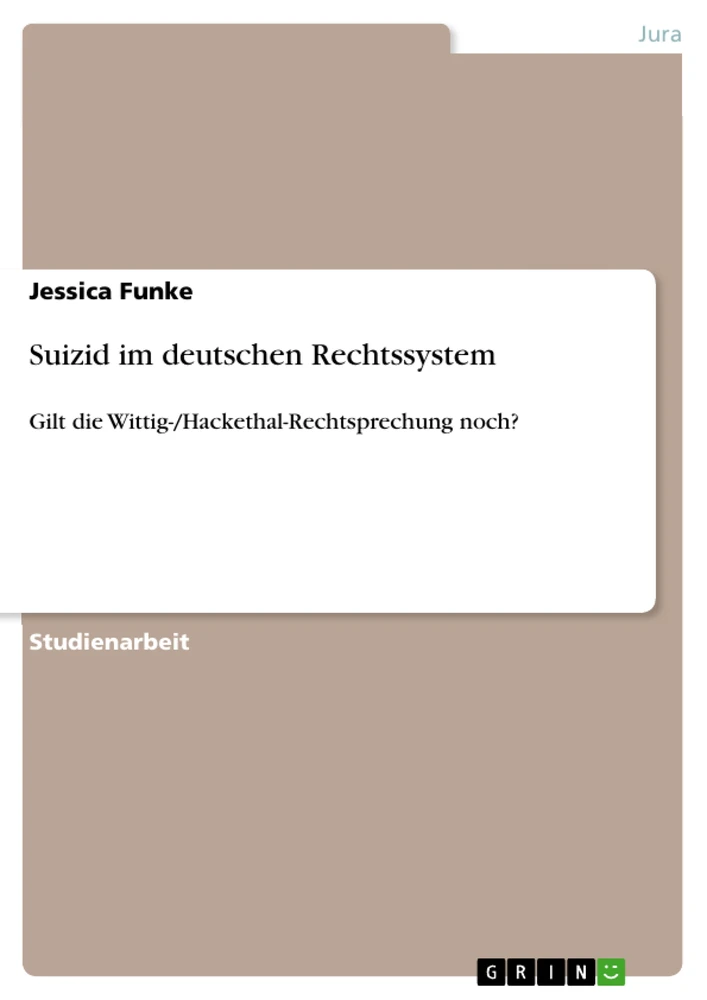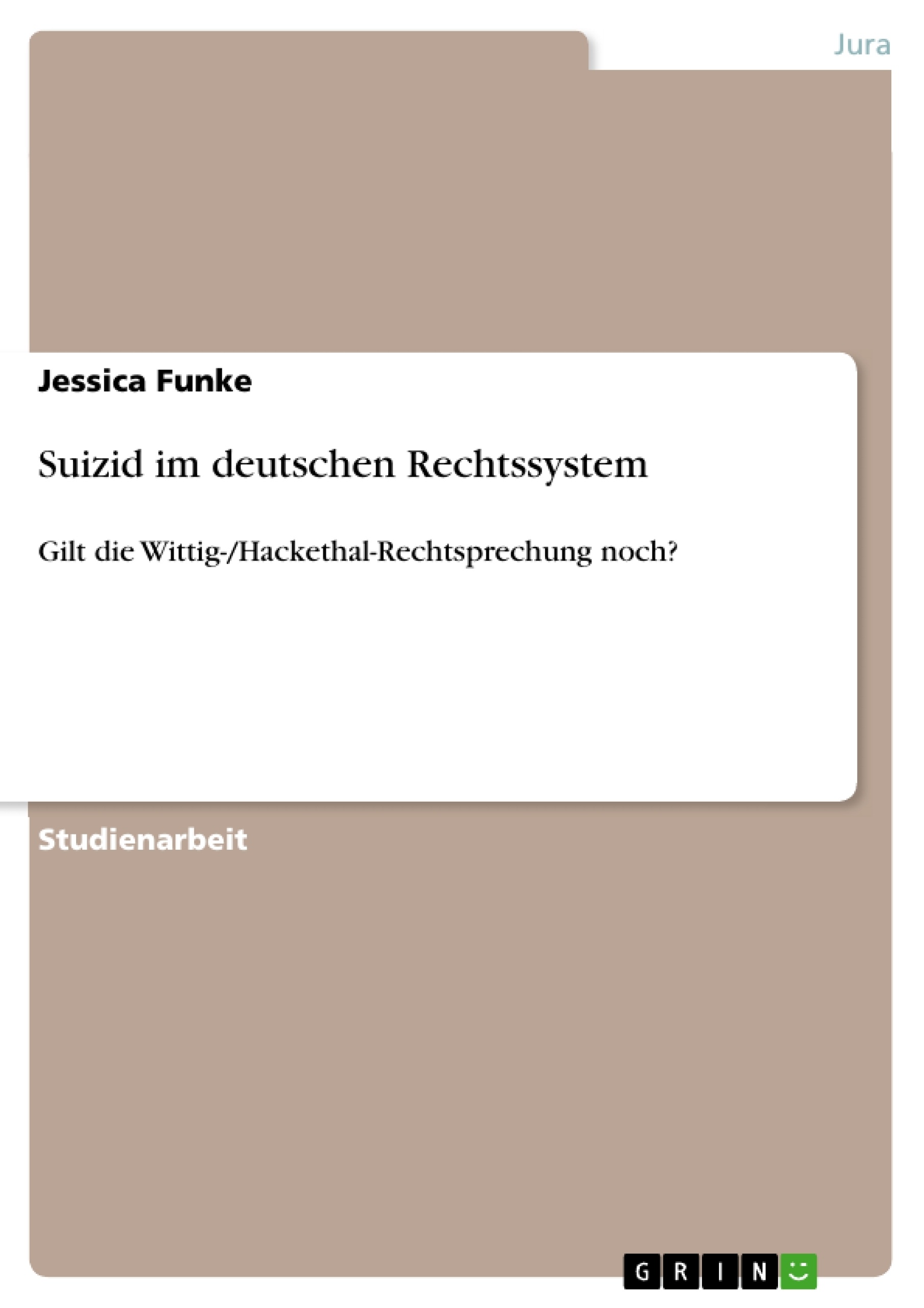Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der deutschen Rechtsprechung im Fall einer Selbsttötung und dem darin enthaltenen Pflichtenwiderstreit. So hatte auch die Rechtsprechung bei der Beurteilung unterschiedlicher Fallgruppen der aktiven und passiven Beteiligung Dritter an einer freiverantwortlichen und eigenhändig begangenen Selbsttötung zuweilen ihre Probleme.
Es lassen sich aus den vorangegangenen Entscheidungen zwei Rechtsprechungsthesen ableiten: Einerseits hat der Lebensgarant eine Erfolgsabwendungspflicht, andererseits sind aber Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit nicht gegen den Willen eines anderen Menschen vorzunehmen.
Dieser Pflichtenwiderstreit realisierte sich erstmals im Fall Wittig, als über die rechtliche Beurteilung des Verhaltens eines Arztes beim Suizid seines Patienten zu entscheiden war.
Die Gerichte, so auch das hier erstinstanzlich entscheidende LG Krefeld, hatten dem Sterbewillen des Suizidenten im Vorfeld stetig mehr Bedeutung zugesprochen. Erleichtert, in der Erwartung einer Bestätigung der Tendenzen in Rechtsprechung und Literatur und der Schaffung von Rechtssicherheit, richtete sich die Aufmerksamkeit der Jurisprudenz im Jahr 1984 nun auf den BGH, die höchste Instanz, als dieser in der Sache Wittig zu den beiden Rechtsthesen Stellung zu beziehen hatte.
Obgleich die Mitwirkung an fremdem Suizid mangels rechtswidriger Haupttat nicht strafbar ist, hat der BGH in seinem folgenden Urteil „bedenkliche Wege beschritten“, die vorsätzliche Nichthinderung einer fremden Selbsttötung zu sanktionieren. Dass dieses Präjudiz die entwickelte Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten in der Rechtsprechung um Jahrzehnte zurückwarf, sollte alsbald im Fall Hackethal Bestätigung finden.
Doch welche Auswirkungen hatte diese „mit Recht bekämpfte Rechtsprechung“ auf die weitere Entwicklung der rechtlichen Beurteilung der Mitwirkung am Suizid? Der BGH jedenfalls hat seiner Urteilssprechung bis heute nicht explizit widersprochen.
Gilt diese Rechtsprechung etwa noch?
Inhaltsverzeichnis
- A. Vorwort
- B. Rechtsprechung zum Fall „Wittig“
- I. Sachverhalt
- II. Problemstellung und Lösungsansätze
- 1. Abgrenzung von Teilnahme und Täterschaft
- 2. Rettungspflichten beim unechten Unterlassungsdelikt
- a) Existenz der Garantenstellung
- b) Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten
- c) Differenzierung zwischen Normalpatient und Suizidpatient
- d) Abwägungsermessen des Arztes
- 3. Echtes Unterlassungsdelikt, § 323c StGB
- C. Beschluss des OLG zum Fall „Hackethal“
- I. Sachverhalt
- II. Problemstellung und Lösungsansätze
- 1. Abgrenzung von Teilnahme und Täterschaft
- 2. Rettungspflichten beim unechten Unterlassungsdelikt
- 3. Echtes Unterlassungsdelikt, § 323c StGB
- D. Aktuelle Rechtsprechung
- E. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text analysiert die Rechtsprechung zum Fall „Wittig“ und dessen Folgen für die rechtliche Beurteilung der Mitwirkung am Suizid. Ziel ist es, die Abgrenzung von straffreier Beihilfe zur Selbsttötung und strafbarer Tötung durch Unterlassen zu untersuchen, sowie die Rolle der Garantenstellung und des Selbstbestimmungsrechts des Patienten in diesem Kontext zu beleuchten.
- Abgrenzung von Teilnahme und Täterschaft bei Suizidbeihilfe
- Rettungspflichten beim unechten Unterlassungsdelikt
- Selbstbestimmungsrecht des Patienten im Kontext von Suizid
- Strafbarkeit der Unterlassung lebensrettender Maßnahmen
- Entwicklung der Rechtsprechung im Bereich der Suizidbeihilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort stellt den Konflikt zwischen dem Fremdtötungsverbot und der Selbsttötungsfreiheit im Kontext der Suizidbeihilfe dar und führt in die Thematik ein. Kapitel B analysiert die Rechtsprechung zum Fall „Wittig“, in dem ein Arzt seinen Patienten nach einem Selbstmordversuch nicht rettete. Dabei werden die Sachverhalt, die Problemstellung und die Lösungsansätze des BGH im Detail beleuchtet. Insbesondere die Abgrenzung von Teilnahme und Täterschaft, die Rettungspflichten des Arztes und die Bedeutung des Selbstbestimmungsrechts des Patienten stehen im Fokus. Kapitel C befasst sich mit dem Beschluss des OLG zum Fall „Hackethal“ und untersucht die dort behandelten rechtlichen Aspekte. Die Kapitel D und E behandeln die aktuelle Rechtsprechung und das Schlusswort, diese werden in der Vorschau jedoch nicht betrachtet, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen im Bereich des Strafrechts, insbesondere im Kontext der Suizidbeihilfe. Die zentralen Schlüsselwörter sind: Selbsttötung, Beihilfe, Tötung durch Unterlassen, Garantenstellung, Selbstbestimmungsrecht, Rechtfertigungsgrund, Lebensrettungspflicht, Strafbarkeit, Rechtsprechung, Fall „Wittig“, Fall „Hackethal“.
- Arbeit zitieren
- Jessica Funke (Autor:in), 2015, Suizid im deutschen Rechtssystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308375