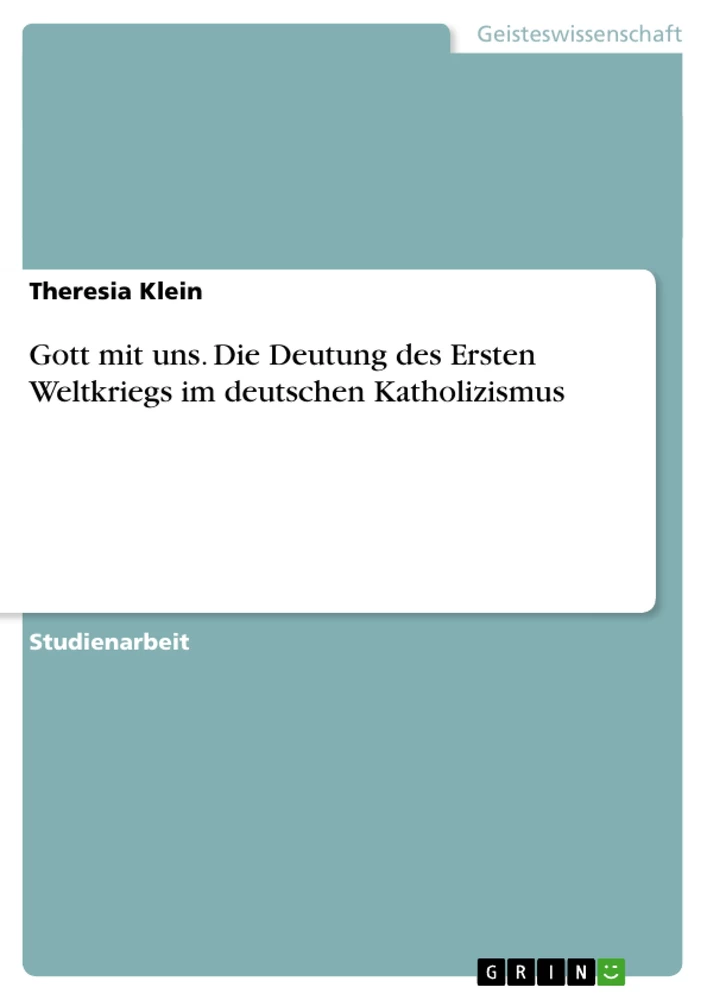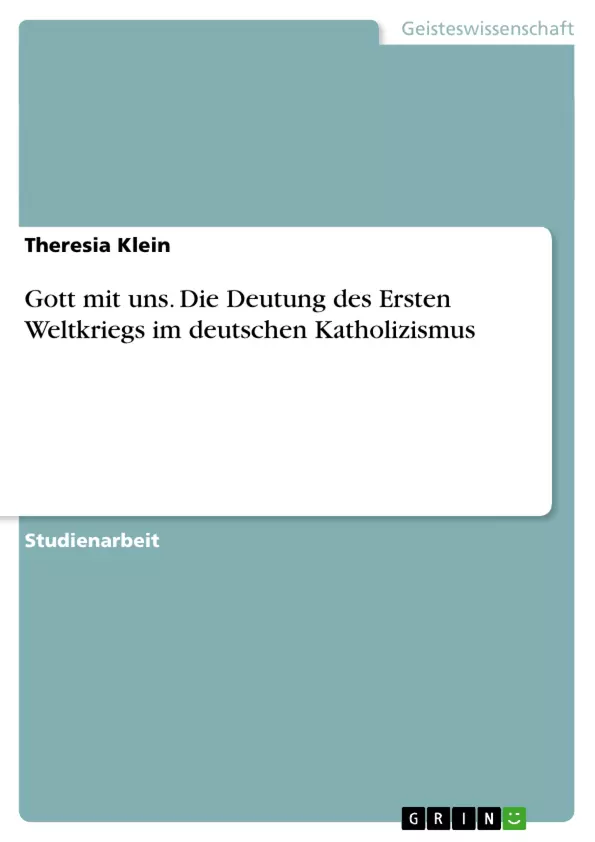Die Frage nach der inneren und äußeren Verknüpfung von Krieg und Religion(en) hat seit einigen Jahren wieder eine neue Brisanz bekommen. Der Topos vom „gerechten Krieg“, Spekulationen über die Motivation religiöser Selbstmordattentäter oder auch der Hinweis auf fundamentalistische Begründungsmuster für Kriege sind in den Medien vielfach zitiert, aber kaum begründet-begründend reflektiert. Nun ist diese Arbeit im Rahmen des Hauptseminars „Krieg und Religion. Christen zwischen göttlicher Sieghelferschaft und Friedensbewegung in Mittelalter und Neuzeit“ sicher nicht geeignet, all diese Motive zu erläutern und zu erklären. Sie wendet sich im Gegenteil von den aktuellen Fragen zum Thema ab und der Problemlage in der Vergangenheit zu, wenn sie nach der Deutung des Ersten Weltkrieges im deutschen Katholizismus fragt. Dennoch scheint mir die Beschäftigung mit religiösen Legitimationsstrukturen und Funktionalisierungen von Religion für Gewalt und Krieg in der Geschichte hilfreich zu sein, um heutige Phänomene besser beurteilen zu können, auch wenn sie selbstverständlich an Komplexität eher zu- als abgenommen haben. Die menschliche Erfahrung des Krieges und vor allem des daraus resultierenden Leides scheint jedoch gestern wie heute auf irgendeine Art von Legitimation des Krieges angewiesen zu sein, wenn der Mensch an dieser Erfahrung nicht vollkommen scheitern soll; dabei spielt die Legitimation über die Religion nach wie vor eine herausragende Rolle.
Ich werde in dieser Arbeit allerdings nicht auf so grundsätzliche Fragen wie derjenigen nach „Erfahrung an sich“ und „Erfahrung im Krieg“ und auch nicht auf die Thematik des Fundamentalismus oder Überlegungen zur Struktur von Begründungen eingehen. Vielmehr geht es mir um ein Hinweisen auf bestimmte Aspekte der Kriegsdeutung im Ersten Weltkrieg durch die katholische Kirche1 und deren theologische Implikationen, ohne damit einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben...
Inhaltsverzeichnis
- Die katholische Kirche vor 1914 und bei Kriegsausbruch
- Der Krieg und die Nation - oder: Mit welcher Nation ist Gott?
- Die theologische Deutung des Krieges
- Der Krieg als Gottesstrafe und Aufruf zur Läuterung: das Motiv der Buße
- Der Krieg und das Motiv des Opfers
- Kriegsfrömmigkeit
- Die Soldaten
- Die Zivilisten
- Neue Frömmigkeit?
- Fazit: Kriegserfahrung als religiöse Erfahrung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Deutung des Ersten Weltkrieges im deutschen Katholizismus und untersucht, wie die katholische Kirche den Krieg theologisch und sozial verstand. Sie untersucht die Reaktionen der Kirche auf den Kriegsausbruch, die Rolle der Religion in der Kriegspropaganda und die Auswirkungen des Krieges auf die individuelle Frömmigkeit.
- Die Position der katholischen Kirche vor 1914 und ihre Reaktion auf den Kriegsausbruch
- Die theologische Interpretation des Krieges und die Rolle von Gottesstrafe und Opfer
- Die Auswirkungen des Krieges auf die Frömmigkeit und die Entstehung neuer Formen der Religiosität
- Die Verknüpfung von Krieg und Nationalismus in der katholischen Kirche
- Die Bedeutung von Religion für die Legitimation von Krieg und Gewalt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 beleuchtet die Situation der katholischen Kirche in Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg und bei Kriegsbeginn. Es analysiert die Position der Kirche im Kaiserreich und ihre Integration in die deutsche Gesellschaft.
- Kapitel 2 untersucht die Frage, inwieweit der Krieg als Ausdruck des göttlichen Willens interpretiert wurde und wie die katholische Kirche die Verbindung von Krieg und Nation thematisierte.
- Kapitel 3 beleuchtet die theologischen Motive, die die Kriegsdeutung im deutschen Katholizismus prägten, insbesondere die Interpretation des Krieges als Gottesstrafe und die Bedeutung des Opfergedankens.
- Kapitel 4 analysiert die Auswirkungen des Krieges auf die Frömmigkeit von Soldaten und Zivilisten, einschließlich der Entstehung neuer Formen der Religiosität und Kriegsfrömmigkeit.
Schlüsselwörter
Erster Weltkrieg, Katholizismus, Deutschland, Kriegsdeutung, Gottesstrafe, Opfer, Frömmigkeit, Krieg und Religion, Nationalismus, Religion und Gewalt.
Wie deutete der deutsche Katholizismus den Ersten Weltkrieg?
Der Krieg wurde oft theologisch als „Gottesstrafe“ und Aufruf zur Buße sowie als notwendiges „Opfer“ für die Nation interpretiert, um eine moralische Läuterung der Gesellschaft zu erreichen.
Was bedeutete der Topos vom „gerechten Krieg“ in dieser Zeit?
Die Kirche nutzte religiöse Legitimationsstrukturen, um den Kriegseinsatz als moralisch geboten darzustellen, was die Integration der Katholiken in das nationale Gefüge des Kaiserreichs förderte.
Wie veränderte der Krieg die Frömmigkeit der Soldaten?
Die Arbeit untersucht die „Kriegsfrömmigkeit“, bei der das Erleben von Leid und Tod zu neuen Formen der Religiosität und einer verstärkten Suche nach göttlichem Beistand an der Front führte.
Welche Rolle spielte die Nation in der religiösen Deutung?
Es wurde oft die Frage gestellt: „Mit welcher Nation ist Gott?“. Der Katholizismus versuchte, den Glauben mit nationalen Interessen zu verknüpfen, um die Loyalität zum deutschen Staat zu unterstreichen.
Gibt es Parallelen zwischen historischer und heutiger religiöser Kriegslegitimation?
Die Arbeit legt nahe, dass die menschliche Erfahrung von Kriegsleid gestern wie heute oft auf religiöse Legitimation angewiesen ist, um das Erlebte zu verarbeiten, auch wenn die Muster heute komplexer sind.