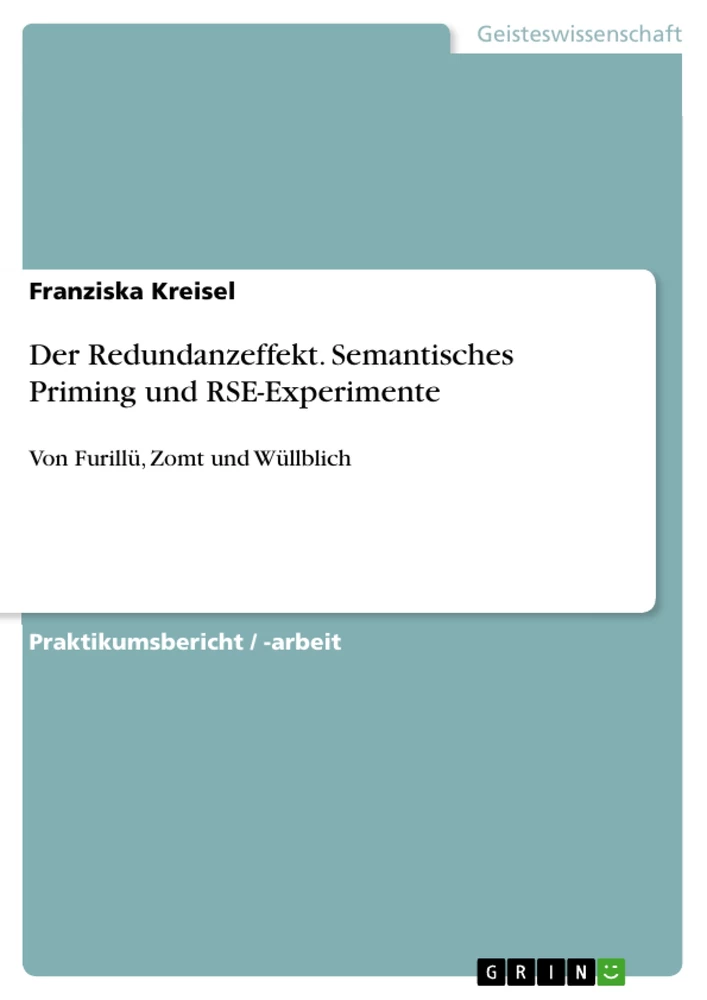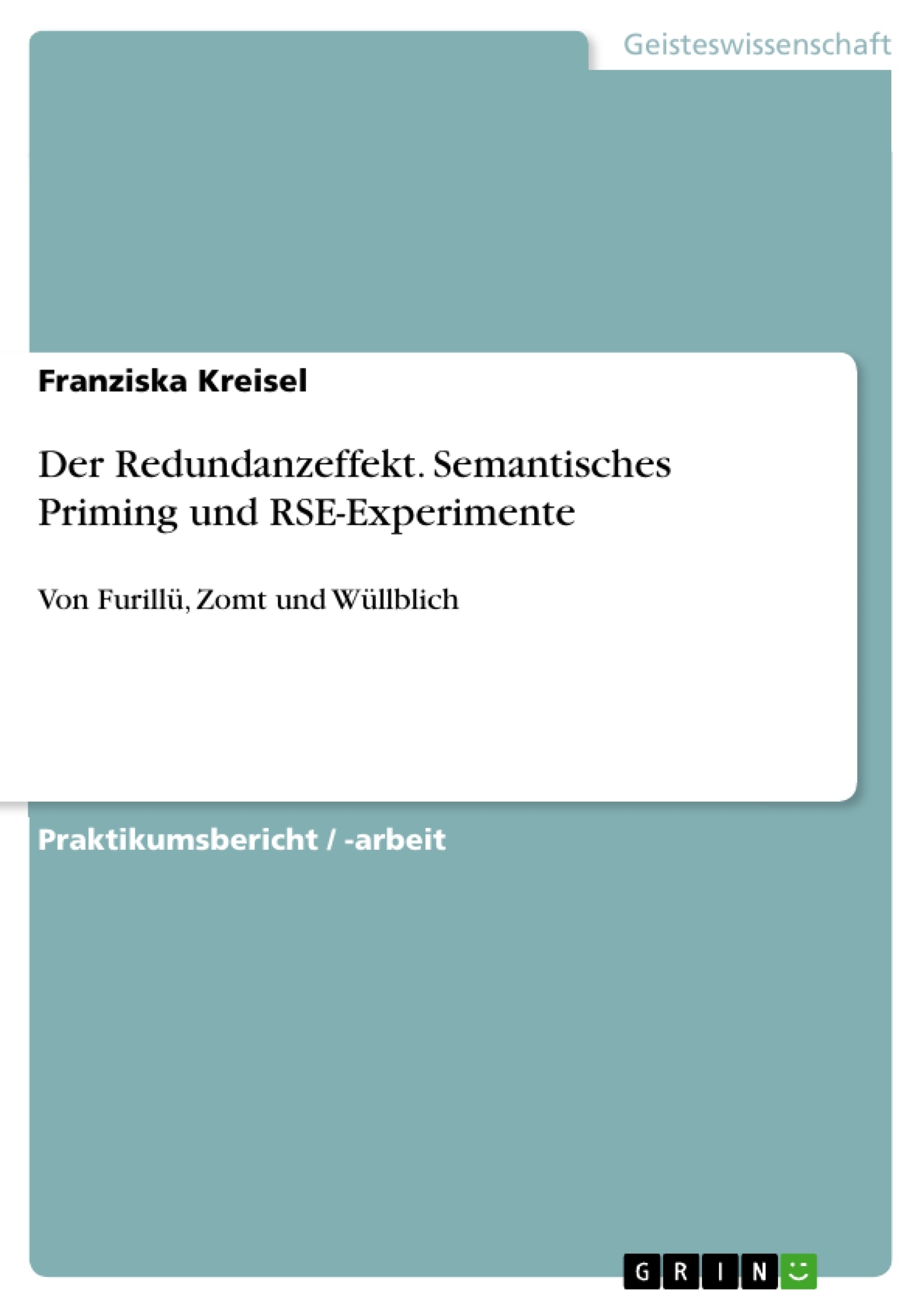Der vielfach replizierte Befund, dass Versuchspersonen (VPn) auf die Darbietung redundanter Reize schneller reagieren als auf die Darbietung eines einzelnen Reizes, wird als Redundanzeffekt („Redundant Signals Effect“, RSE) bezeichnet. Umstritten ist, ob der RSE durch die Koaktivierung eines geteilten Wahrnehmungspools oder durch einen Wettlauf zwischen den verschiedenen Wahrnehmungskanälen zu erklären ist. Als weiterer Erklärungsansatz wird das Konzept des semantischen Primings diskutiert, also ein Verarbeitungsvorteil, der durch Voraktivierung bestimmter Spuren im semantischen Gedächtnis verursacht wird.
In einem ersten Experiment konnte der von Fiedler, Schröter und Ulrich (2013) gefundene RSE für rein semantische, intrapsychische Reize repliziert werden. Verwendet wurden 60 deutsche Wörter, die sowohl einer bestimmten Kategorie (Dinge, Essen oder Tiere) als auch einer bestimmten Farbe zugeordnet werden konnten. Die VPn sollten in einem Computerexperiment entscheiden, ob die präsentierten Begriffe zu einer der vorher salient gemachten Unterkategorien passten. Wie erwartet reagierten sie dann besonders schnell, wenn die gezeigten Wörter sowohl zur Kategorie als auch zur Farbe passten - sogenannte redundante Targets.
Im zweiten Experiment, einer lexikalischen Entscheidungsaufgabe, wurden neben dem Stimulusmaterial des ersten Experiments auch noch aus diesen Wörtern generierte Nichtwörter verwendet. Gemessen wurde die Auswirkung verschiedener Arten von Primes auf die Reaktionszeit bei der Aufgabe. Es ergab sich kein experimenteller Beleg für redundantes semantisches Priming. Da die Daten die mathematischen Annahmen der Wettlaufungleichung (Miller, 1982) nicht verletzen, wird der nachgewiesene Redundanzeffekt auf eine statistische Erleichterung bei der parallelen Informationsverarbeitung der beiden Kategorien zurückgeführt.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Abstract
- Einleitung
- RSE‐Experiment
- Methoden
- Ergebnisse und Diskussion
- Priming‐Experiment
- Methoden
- Ergebnisse und Diskussion
- General Discussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die vorliegende Arbeit untersucht den Redundanzeffekt (RSE) und die Möglichkeit, dass semantisches Priming den Effekt erklären kann. Dazu wird zunächst der RSE repliziert, wobei rein semantische Reize verwendet werden. Anschließend wird in einem zweiten Experiment geprüft, ob redundantes semantisches Priming den Effekt erklären kann. Die Arbeit analysiert, ob ein Wettlaufmodell oder ein Koaktivierungsmodell den RSE besser abbildet.
- Der Redundanzeffekt (RSE) und seine Erklärung
- Semantisches Priming als potenzielle Erklärung des RSE
- Das Wettlaufmodell und das Koaktivierungsmodell im Kontext des RSE
- Die Rolle des semantischen Gedächtnisses bei der Verarbeitung von Reizen
- Experimentelle Methoden zur Untersuchung von RSE und semantischem Priming
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung beleuchtet den Redundanzeffekt und seine bisherigen Forschungsarbeiten. Es wird erläutert, wie dieser Effekt bei physikalischen und semantischen Reizen nachgewiesen wurde. Die Bedeutung des Konzepts des "Perzepts" für die Wahrnehmung von Reizen wird hervorgehoben.
Das RSE-Experiment beschreibt die Methoden und Ergebnisse der Replikation der Arbeit von Fiedler, Schröter und Ulrich (2013). Die Ergebnisse zeigen, dass ein signifikanter RSE für rein semantisches Material festgestellt werden konnte.
Das Priming-Experiment untersucht die Möglichkeit des redundanten semantischen Primings als Erklärung für den RSE. Die Ergebnisse zeigen, dass kein signifikanter Effekt gefunden wurde.
Die General Discussion diskutiert die Ergebnisse der beiden Experimente und stellt die Implikationen für die Erklärung des RSE dar. Es wird vermutet, dass redundantes semantisches Priming möglicherweise nicht möglich ist und dass die Daten eher für ein Wettlaufmodell sprechen.
Schlüsselwörter (Keywords)
Redundanzeffekt, semantisches Priming, Wettlaufmodell, Koaktivierungsmodell, semantisches Gedächtnis, lexikalische Entscheidungsaufgabe, Reaktionszeit, Proportion Correct, Falscher Alarm, Antizipation, Misses, Cognitive Load.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem Redundanzeffekt (RSE)?
Der Redundanzeffekt beschreibt das Phänomen, dass Versuchspersonen auf die Darbietung mehrerer redundanter Reize schneller reagieren als auf einen Einzelreiz.
Welche zwei Hauptmodelle erklären den RSE?
Diskutiert werden das Koaktivierungsmodell (gemeinsamer Wahrnehmungspool) und das Wettlaufmodell (parallele Verarbeitungskanäle konkurrieren).
Was wurde im ersten Experiment untersucht?
Es wurde geprüft, ob der RSE auch für rein semantische, intrapsychische Reize (Wörter mit Kategorien wie Essen/Tiere und Farben) replizierbar ist.
Konnte semantisches Priming den RSE erklären?
Nein, im zweiten Experiment ergab sich kein Beleg für redundantes semantisches Priming als Ursache für den Effekt.
Welches Modell bevorzugen die Ergebnisse dieser Studie?
Da die Daten die Wettlaufungleichung nach Miller nicht verletzen, deuten sie eher auf ein Wettlaufmodell (statistische Erleichterung) hin.
- Citar trabajo
- Franziska Kreisel (Autor), 2013, Der Redundanzeffekt. Semantisches Priming und RSE-Experimente, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/309632