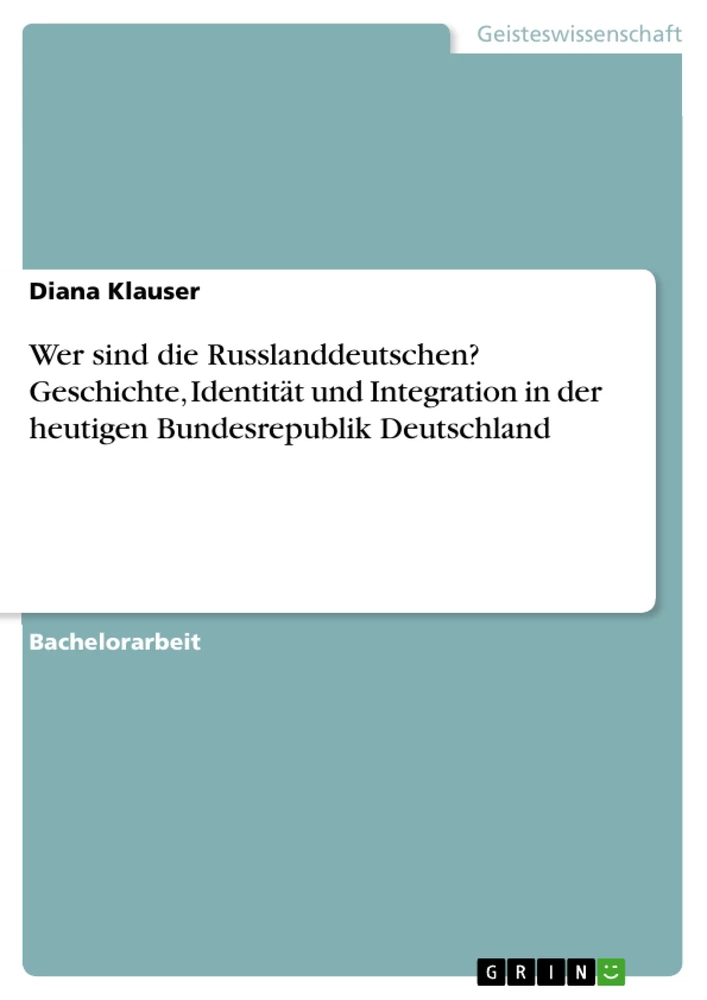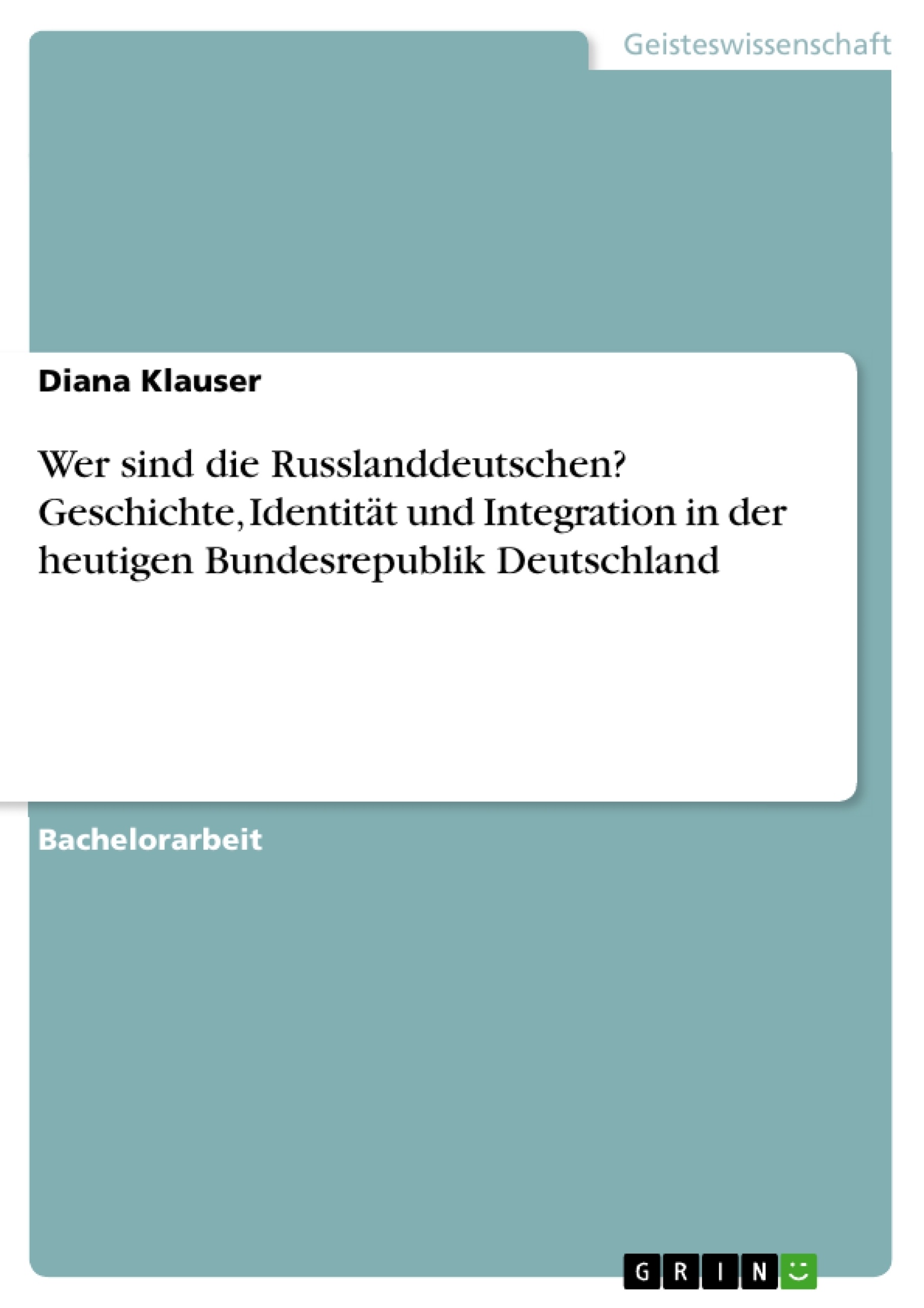Die folgende Arbeit sieht ihre Aufgabe darin, die Historie und Entwicklung der Russlanddeutschen in der ehemaligen Sowjetunion (Kapitel 2) darzulegen und im weiteren Verlauf die Ausreise nach Deutschland näher zu beleuchten. Der Prozess der Aussiedlung wird durch mehrere Aspekte, darunter auch die gesetzlichen Grundlagen, beeinflusst (Kapitel 3), wodurch eine Basis für das Hintergrundwissen zum weiteren Verlauf geschaffen wird. Von wesentlicher Bedeutung in dieser Arbeit sind ebenfalls die Identität (Kapitel 4) und die Integration und die damit einhergehenden Schwierigkeiten (Kapitel 5) der Russlanddeutschen in der heutigen Bundesrepublik Deutschland (BRD).
In Russland waren sie Deutsche, und in Deutschland gelten sie als Russen. Seit Jahrzehnten eben die Russlanddeutschen nun in Deutschland. Aber wer sind sie? Warum lebten sie einst in Russland und wie sind sie dort hingelangt? Warum beherrschen viele der Russlanddeutschen nicht die deutsche Sprache, obwohl sie Deutsche sind? Warum führt sie der Weg zurück in die ursprüngliche Heimat? Mit all diesen Fragestellungen werden die einheimischen Deutschen konfrontiert, wenn sie in Kontakt mit Russlanddeutschen kommen.
Die Russlanddeutschen sind Nachfahren der deutschen Kolonisten in der UdSSR (Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken). In der Tat gehören sie zwei Kulturen an. Es wäre falsch festzustellen, sie seien nur vollkommen Deutsche bzw. Russen. Und mit genau dieser Thematik beschäftigt sich diese Arbeit. Obwohl reichlich über die Russlanddeutschen gesprochen und berichtet wird, wissen viele gar nicht, wer sie wirklich sind und welches Schicksal sie mit sich tragen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Geschichte der Russlanddeutschen
- 2.1 Beginnende Ansiedlung
- 2.2 Ansiedlung im 18. Jahrhundert
- 2.3 Ansiedlung im 19. Jahrhundert
- 2.3.1 Wirtschaftliche Entwicklungen in den ersten Jahrzehnten
- 2.3.2 Die Entwicklung ab Mitte des 19. Jahrhunderts
- 2.4 Das 20. Jahrhundert
- 2.4.1 Die Zeit des ersten Weltkrieges
- 2.4.2 Die Zeit des zweiten Weltkrieges
- 2.4.3 Kriegsende und die Zeit ab 1950 bis 1980
- 3. Zuwanderung und Aufnahme
- 3.1 Begriffsdefinitionen
- 3.2 Die Einreise in den Jahrzehnten 1980 und 1990
- 3.3 Gesetzliche Grundlage zur Zuwanderung und Aufnahme
- 3.3.1 Eingliederung und Starthilfe
- 3.4 Zuwanderung in Zahlen
- 4. Identität der Russlanddeutschen
- 4.1 Deutsche in Russland, Russen in Deutschland
- 4.2 Migration, Ethnizität und Kultur
- 4.2.1 Migration und Ethnizität
- 4.2.2 Kultur
- 4.3 Identitätsmerkmale
- 4.4 5 Typen der Russlanddeutschen
- 4.4.1 Nicht richtig Deutsche
- 4.4.2 Deutsche mit Makel
- 4.4.3 Deutsche mit russischem Glanz
- 4.4.4 Die wahren Deutschen
- 4.4.5 Die sowjetischen Leute
- 4.5 Übergangsprozess der Russlanddeutschen
- 4.6 Identifikation mit dem Aufnahmeland und Wahrnehmungen
- 5. Integration der Russlanddeutschen
- 5.1 Theoretischer Bezug
- 5.1.1 Dimensionen von Integration
- 5.1.2 Akkulturation und Assimilation
- 5.2 Schwierigkeiten der Integration
- 5.2.1 Defizitäre Sprachkenntnisse
- 5.2.2 Siedlungsbildung und Segregation
- 5.2.3 Schule, Ausbildung und Beruf
- 5.2.4 Gewalt und Kriminalität
- 5.2.5 Alkohol- und Drogenkonsum
- 5.3 Maßnahmen
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Geschichte, Identität und Integration der Russlanddeutschen in der Bundesrepublik Deutschland. Ziel ist es, die historischen Wurzeln der Russlanddeutschen in der ehemaligen Sowjetunion aufzuzeigen, die Aussiedlung nach Deutschland zu beleuchten und die Herausforderungen der Integration in die deutsche Gesellschaft zu analysieren.
- Die Geschichte der Russlanddeutschen in der Sowjetunion
- Die Aussiedlung nach Deutschland und die rechtlichen Rahmenbedingungen
- Die Identität der Russlanddeutschen und ihre Vielfältigkeit
- Die Integration der Russlanddeutschen in die deutsche Gesellschaft
- Schwierigkeiten und Herausforderungen der Integration
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 2 beleuchtet die Geschichte der Russlanddeutschen in der Sowjetunion, beginnend mit der ersten Ansiedlung im 18. Jahrhundert bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Es werden die Gründe für die Ansiedlung, die Entwicklungen in den verschiedenen Epochen und die Auswirkungen von Kriegen und politischen Umbrüchen auf die Russlanddeutschen dargestellt.
Kapitel 3 befasst sich mit der Aussiedlung der Russlanddeutschen nach Deutschland. Es werden Begriffsdefinitionen erläutert, die Einreise in den 1980er und 1990er Jahren beschrieben und die rechtlichen Grundlagen der Zuwanderung und Aufnahme beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der Identität der Russlanddeutschen. Es werden verschiedene Identitätsmerkmale und -typen betrachtet, die von den komplexen Erfahrungen der Migration, Ethnizität und Kultur geprägt sind. Die vielfältigen Perspektiven der Russlanddeutschen auf ihre eigene Identität und ihre Zugehörigkeit werden beleuchtet.
Kapitel 5 untersucht die Integration der Russlanddeutschen in die deutsche Gesellschaft. Es werden verschiedene Dimensionen von Integration betrachtet und die Herausforderungen, denen die Russlanddeutschen bei der Integration begegnen, analysiert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Russlanddeutsche, Geschichte, Identität, Integration, Migration, Ethnizität, Kultur, Aussiedlung, Aufnahmeland, Deutschland, Sowjetunion, Integrationsschwierigkeiten, Sprachkenntnisse, Segregation, Bildung, Kriminalität, Alkoholismus.
Häufig gestellte Fragen
Wer sind die Russlanddeutschen?
Russlanddeutsche sind die Nachfahren deutscher Kolonisten, die ab dem 18. Jahrhundert in das Russische Reich auswanderten und später als Aussiedler oder Spätaussiedler nach Deutschland zurückkehrten.
Warum beherrschen viele Russlanddeutsche die deutsche Sprache nicht perfekt?
Dies liegt an der jahrzehntelangen Unterdrückung der deutschen Sprache und Kultur in der Sowjetunion, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg, was die Weitergabe der Muttersprache erschwerte.
Was bedeutet die Identität "Deutsche in Russland, Russen in Deutschland"?
Es beschreibt das Fremdheitsgefühl vieler Migranten, die in der Sowjetunion als "die Deutschen" diskriminiert wurden, in Deutschland aber oft als "die Russen" wahrgenommen werden.
Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Integration?
Herausforderungen sind defizitäre Sprachkenntnisse, die Nichtanerkennung von Berufsabschlüssen, Segregation in bestimmten Wohnvierteln und Identitätskonflikte.
Welche fünf Identitätstypen der Russlanddeutschen werden unterschieden?
Die Arbeit unterteilt sie in: Nicht richtig Deutsche, Deutsche mit Makel, Deutsche mit russischem Glanz, die wahren Deutschen und die sowjetischen Leute.
- Quote paper
- Diana Klauser (Author), 2015, Wer sind die Russlanddeutschen? Geschichte, Identität und Integration in der heutigen Bundesrepublik Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310262