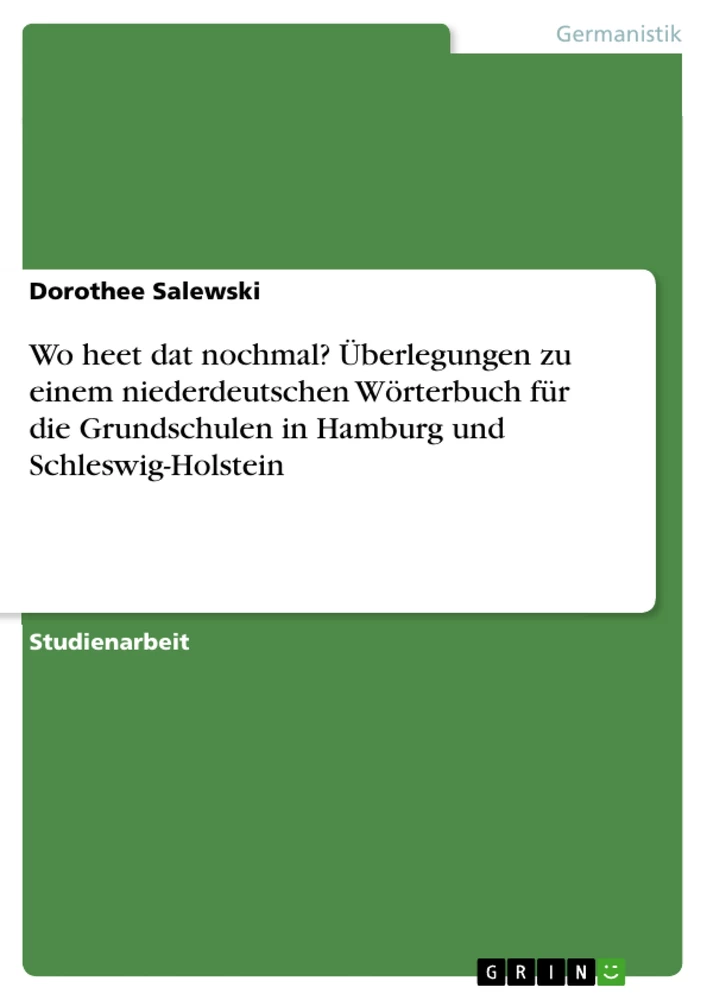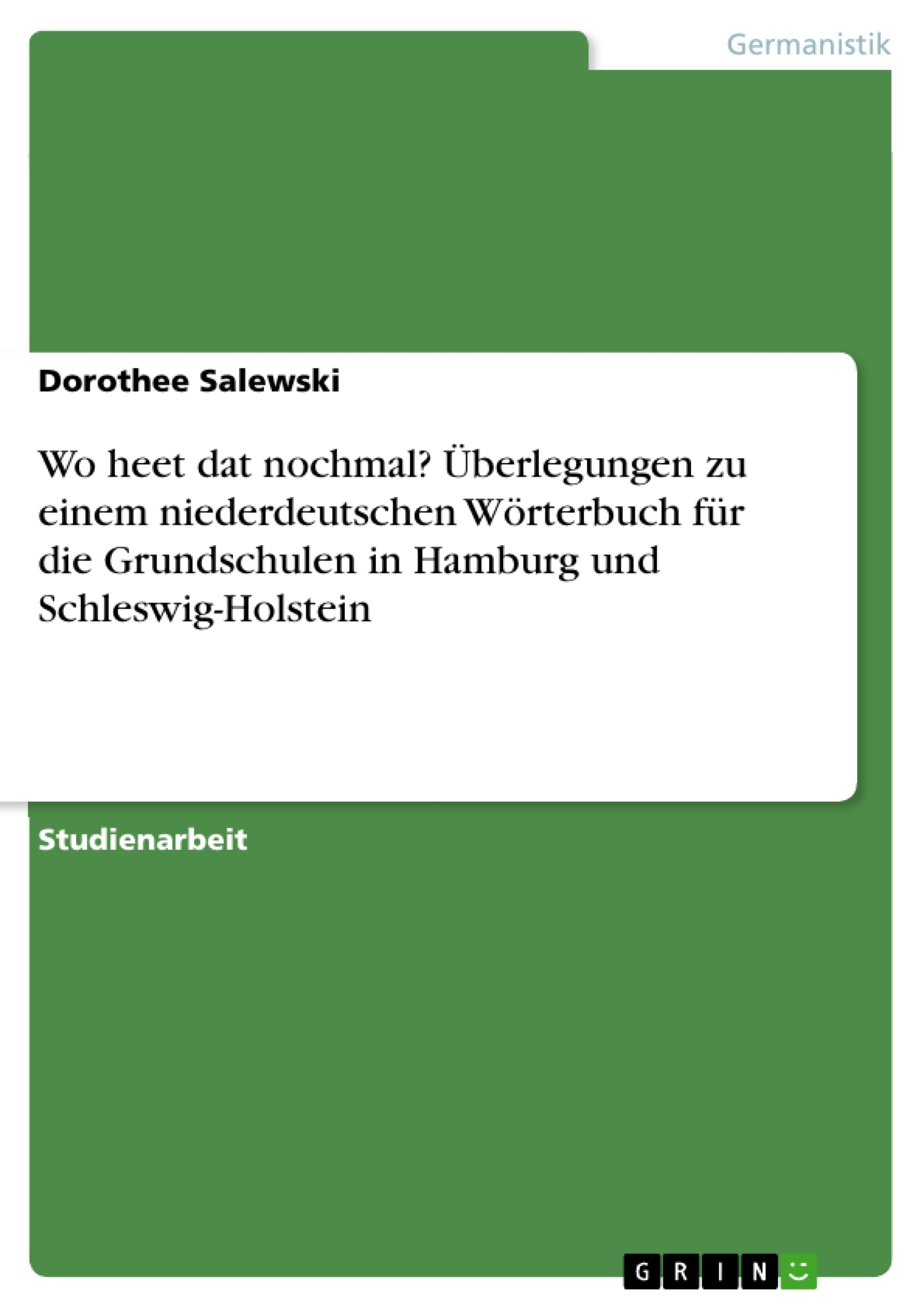Noch vor dreißig Jahren hörte man in norddeutschen Schulbussen Kinder und Jugendliche Niederdeutsch sprechen. Auch in den Klassenzimmern gehörte das Plattdeutsche, gerade in ländlichen Gebieten, zum Alltag. Doch heutzutage ist es stiller um die ehemalige Hansesprache geworden. Seit einigen Jahren wird nun versucht, der fast toten Sprache in den Schulen Norddeutschlands wieder Leben einzuhauchen.
Es stellt sich somit die Frage, ob neben anderen Lehrmaterialien ein niederdeutsches Wörterbuch für die Grundschule notwendig ist.
Diese Arbeit wird sich zunächst mit der Analyse vorhandener Wörterbücher für die Grundschule beschäftigen. Hierbei werden zunächst muttersprachliche und dann fremdsprachliche Wörterbücher unter den Aspekten Gestaltung und Inhalt untersucht. Schließlich liegt das Niederdeutsche irgendwo zwischen einer Fremd- und einer Muttersprache für die meisten Kinder.
Diesen pädagogisch-didaktischen Betrachtungen wird sich ein Vergleich mit dem populärsten niederdeutschen Alltags-Wörterbuch, dem Sass, anschließen. Welche Elemente könnten für ein niederdeutsches Kinderwörterbuch übernommen, was müsste verändert werden? Zum Abschluss sollen die Analyseergebnisse in theoretischen Überlegungen zur Erstellung eines niederdeutschen Grundschulwörterbuchs münden, bevor ein Fazit gezogen werden kann.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Niederdeutsch in den Grundschulen Schleswig-Holsteins und Hamburgs
- Analyse bereits existierender Grundschulwörterbücher
- für Hochdeutsch
- für ersten Fremdsprachenunterricht (Englisch)
- Analyse eines niederdeutschen Wörterbuchs für den Alltagsgebrauch
- Überlegungen zur Erstellung eines niederdeutschen Grundschulwörterbuchs
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob neben anderen Lehrmaterialien ein niederdeutsches Wörterbuch für die Grundschule notwendig ist. Sie analysiert vorhandene Wörterbücher für die Grundschule, sowohl muttersprachliche als auch fremdsprachliche. Anschließend wird ein Vergleich mit dem populärsten niederdeutschen Alltags-Wörterbuch, dem Sass, angestellt, um Elemente für ein niederdeutsches Kinderwörterbuch zu identifizieren. Schließlich sollen die Analyseergebnisse in theoretischen Überlegungen zur Erstellung eines niederdeutschen Grundschulwörterbuchs münden.
- Die Bedeutung von Niederdeutsch im Grundschulunterricht in Schleswig-Holstein und Hamburg
- Analyse existierender Grundschulwörterbücher (Hochdeutsch und Fremdsprachen)
- Vergleich mit einem niederdeutschen Alltags-Wörterbuch
- Überlegungen zur Erstellung eines spezifischen niederdeutschen Grundschulwörterbuchs
- Herausforderungen und Chancen für die Förderung des Niederdeutschen in der Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Das erste Kapitel beleuchtet die aktuelle Situation des Niederdeutschen in den Grundschulen Schleswig-Holsteins und Hamburgs und stellt den rechtlichen Rahmen der Förderung der Regionalsprache in Deutschland dar. Das zweite Kapitel analysiert die Gestaltung und den Inhalt existierender Grundschulwörterbücher, sowohl für Hochdeutsch als auch für den ersten Fremdsprachenunterricht. Das dritte Kapitel untersucht ein niederdeutsches Alltags-Wörterbuch und beleuchtet dessen Eignung als Vorbild für ein Grundschulwörterbuch.
Schlüsselwörter (Keywords)
Niederdeutsch, Grundschulwörterbuch, Sprachförderung, Regionalsprache, Bildungsplan, Schleswig-Holstein, Hamburg, Sass, Wörterbuchanalyse, Grundwortschatz, Pädagogik.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird über ein niederdeutsches Wörterbuch für Grundschulen nachgedacht?
Da das Niederdeutsche in Norddeutschland kaum noch im Alltag gesprochen wird, soll ein spezifisches Wörterbuch helfen, der Sprache im Unterricht wieder Leben einzuhauchen.
Welche Regionen stehen im Fokus der Untersuchung?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Grundschulen in Hamburg und Schleswig-Holstein.
Was ist der "Sass" und welche Rolle spielt er in der Arbeit?
Der Sass ist das populärste niederdeutsche Alltags-Wörterbuch. Die Arbeit prüft, welche Elemente daraus für ein Kinderwörterbuch übernommen werden können.
Wird Niederdeutsch als Mutter- oder Fremdsprache behandelt?
Die Arbeit stellt fest, dass Niederdeutsch für die meisten Kinder heutzutage eine Zwischenstellung zwischen Fremd- und Muttersprache einnimmt.
Welche Aspekte werden bei der Analyse vorhandener Wörterbücher untersucht?
Untersucht werden sowohl muttersprachliche (Deutsch) als auch fremdsprachliche (Englisch) Grundschulwörterbücher hinsichtlich ihrer Gestaltung und ihres Inhalts.
Was sind die pädagogischen Ziele eines solchen Wörterbuchs?
Es soll die Sprachförderung unterstützen, den Grundwortschatz festigen und an die Anforderungen der aktuellen Bildungspläne angepasst sein.
- Quote paper
- Dorothee Salewski (Author), 2013, Wo heet dat nochmal? Überlegungen zu einem niederdeutschen Wörterbuch für die Grundschulen in Hamburg und Schleswig-Holstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/310980