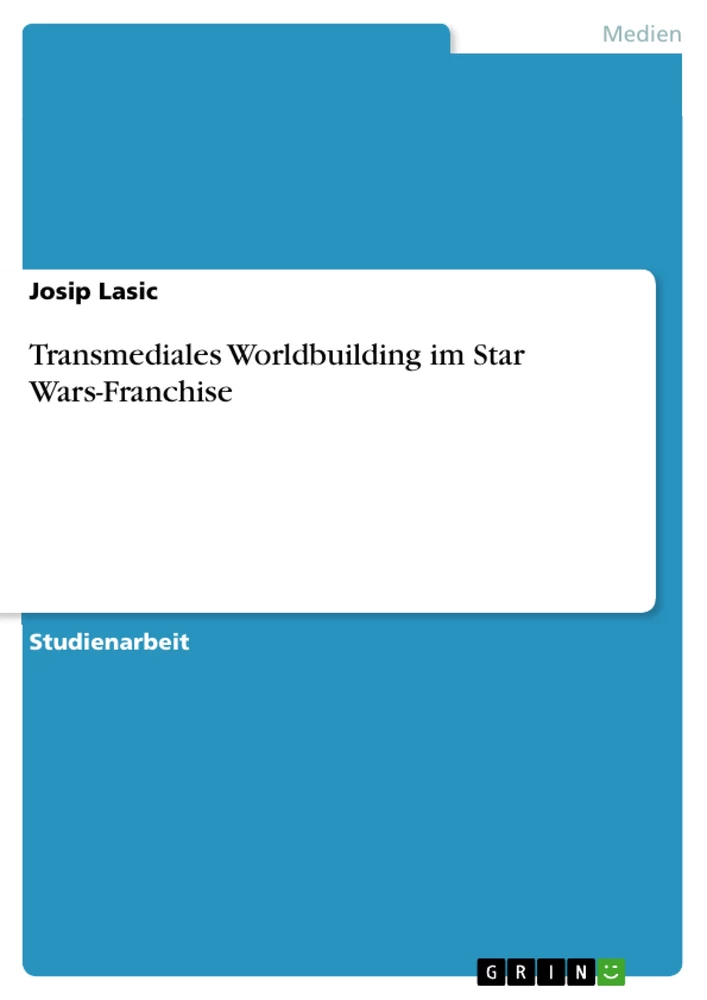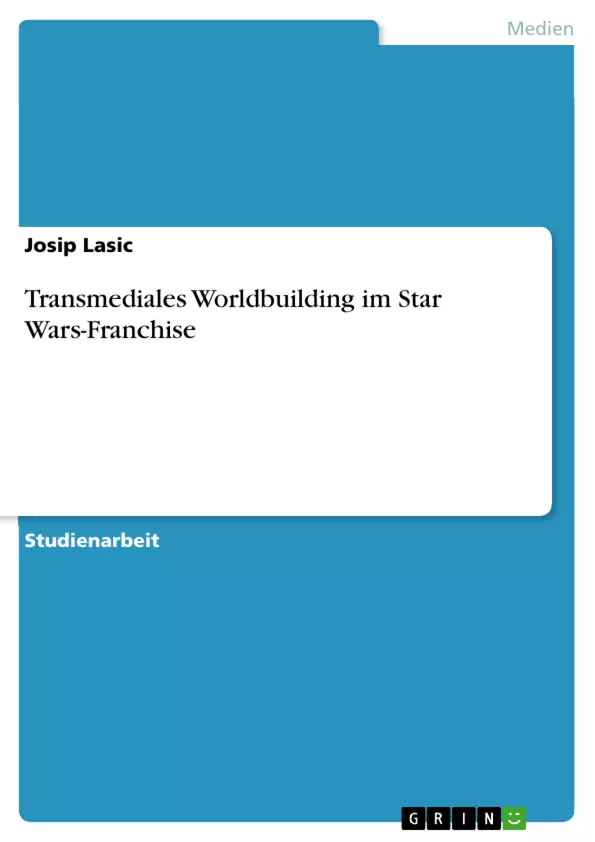Dies ist eine Arbeit, die sich mit dem "Worldbuilding" - der Konstruktion der fiktiven Welt - in den ersten sechs Star Wars Filmen und deren Ablegern in Büchern, Comics, Videospielen etc. auseinandersetzt. Neben den theoretischen Grundlagen zum Thema Worldbuilding und Transmedialität und deren Anwendung in der Star Wars-Reihe, wird auch die medienübergreifende Stringenz der konstruierten Welt betrachtet.
Bei der Arbeit wird so vorgegangen, dass im ersten Teil die wissenschaftlichen Grundlagen dargestellt und kritisch bewertet werden, während im zweiten Teil die STAR WARS-Franchise anhand des theoretischen Fundaments analysiert wird. Am Anfang steht eine theoretische Abhandlung zur Transmedialität. Dabei wird der Begriff erklärt und definiert sowie die unterschiedlichen Varianten, in denen Transmedia vorkommt, präsentiert. Danach werden einander unterschiedliche Theorien gegenübergestellt, die sich mit dem Thema World Building – den Konstruktionen fiktiver Welten – auseinandergesetzt haben. Diese Abschnitte stellen das theoretische Grundgerüst, anhand dessen in den Folgekapiteln zunächst die STAR WARS-Franchise (also die sechs Filme), transmediale Pre- und Sequels und zuletzt transmediale Spin-offs analysiert werden.
Diese Forschung soll zeigen, wie die Welt von STAR WARS transmedial verbunden ist und ob sie durch die zahlreichen Storylines, welche durch die Transmedialität entstehen, ihre Konsistenz bewahrt. Als Quellenmaterial dienen zunächst einmal die ursprünglichen sechs STAR WARS-Filme, transmediale Pre- und Sequels, welche zeitlich möglicht lange vor oder nach den ursprünglichen Filmen spielen, sowie transmediale Spin-offs wie die EWOKS-Reihe. Die Leitfrage, welche durch die Arbeit führen lautet: Wie wird die konstruierte Welt in der STAR WARS-Franchise durch die Transmedialität erweitert und gehen diese Ergänzungen unter Umständen so weit, dass ganz neue Welten entstehen? Wird durch die Transmedialität die Welt von STAR WARS vervollständigt, oder entstehen unter Umständen zusätzliche Lücken im Gebilde?
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- EINLEITUNG.
- THEORETISCHE GRUNDLAGEN.
- TRANSMEDIALITÄT.
- TRANSMEDIALE WELT, MYTHOS, TOPOS UND ETHOS..
- FIKTIONALE UND NARRATIVE WELTEN.
- KLEINE WELTEN & WELTSTRUKTUREN.
- DAS WORLD BUILDING IN DEN STAR WARS FILMEN
- EPISODE IV-A NEW HOPE
- EPISODE V – THE EMPIRE STRIKES BACK
- EPISODE VI – RETURN OF THE JEDI
- EPISODE I – THE PHANTOM MENACE.
- EPISODE II - ATTACK OF THE CLONES
- EPISODE III - REVENGE OF THE SITH
- DAS WORLD BUILDING IN DEN TRANSMEDIALEN PRE- UND SEQUELS VON STAR WARS..
- THE CLONE WARS.
- VIDEOSPIELE..
- COMIC: THE GOLDEN AGE OF THE SITH.
- ROMAN: BETRAYAL
- DAS WORLD BUILDING IN DEN TRANSMEDIALEN SPIN-OFFS VON STAR WARS..............
- EWOK ADVENTURES: CARAVAN OF COURAGE & THE BATTLE FOR ENDOR.
- EWOKS: CARTOON UND COMIC.
- VERGLEICHENDE ANALYSE.
- SCHLUSSWORT..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Untersuchung des World Building in der STAR WARS-Franchise und deren transmedialen Ablegern. Das Ziel ist es, zu analysieren, wie die Welt von STAR WARS transmedial verbunden ist und ob sie durch die zahlreichen Storylines, welche durch die Transmedialität entstehen, ihre Konsistenz bewahrt.
- Definition und Analyse des Begriffs Transmedialität
- Theorien zum World Building und fiktiven Welten
- Analyse des World Building in den sechs STAR WARS-Filmen
- Untersuchung des World Building in transmedialen Pre- und Sequels
- Bewertung des World Building in transmedialen Spin-offs
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung stellt das Thema und die Zielsetzung der Forschungsarbeit vor und erläutert die Bedeutung von STAR WARS als transmediale Franchise. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen, wobei der Begriff Transmedialität definiert und verschiedene Theorien zum World Building vorgestellt werden. Kapitel 3 analysiert das World Building in den sechs STAR WARS-Filmen, wobei die Entstehung und Entwicklung der Welt von STAR WARS beleuchtet wird. Kapitel 4 befasst sich mit den transmedialen Pre- und Sequels und untersucht, wie die Welt von STAR WARS durch diese Erweiterungen erweitert wird. Kapitel 5 untersucht das World Building in den transmedialen Spin-offs, wie zum Beispiel die EWOKS-Reihe. Das Kapitel 6 bietet eine vergleichende Analyse, die die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammenfasst und die Auswirkungen von Transmedialität auf das World Building in der STAR WARS-Franchise beleuchtet.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die Forschungsarbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Transmedialität, World Building, STAR WARS-Franchise, fiktive Welten, transmediales Erzählen, Storytelling, und Medienkonvergenz. Die Untersuchung analysiert, wie die Welt von STAR WARS durch die Transmedialität erweitert und vervollständigt wird, sowie die Auswirkungen dieser Erweiterungen auf die Konsistenz der Welt von STAR WARS.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Worldbuilding bei Star Wars?
Es bezeichnet die detaillierte Konstruktion der fiktiven Welt, ihrer Geschichte, Kulturen und physikalischen Gesetze über alle Medien hinweg.
Was ist transmediales Erzählen?
Dabei wird eine Geschichte nicht nur in einem Medium erzählt, sondern über Filme, Bücher, Comics und Spiele hinweg erweitert und ergänzt.
Bleibt die Welt von Star Wars trotz vieler Storylines konsistent?
Die Arbeit untersucht genau diese Stringenz und analysiert, ob durch die vielen Erweiterungen Widersprüche oder neue Lücken im Universum entstehen.
Welche Rolle spielen Spin-offs wie die „Ewoks“-Reihe?
Spin-offs erweitern die Welt an Rändern, die in den Hauptfilmen nur kurz angerissen werden, und vertiefen so den Mythos des Universums.
Was sind transmediale Pre- und Sequels?
Dies sind Werke (wie „The Clone Wars“ oder bestimmte Romane), die zeitlich vor oder nach den Filmen spielen und die Vorgeschichte oder Zukunft der Welt ausbauen.
- Citar trabajo
- Josip Lasic (Autor), 2013, Transmediales Worldbuilding im Star Wars-Franchise, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313082