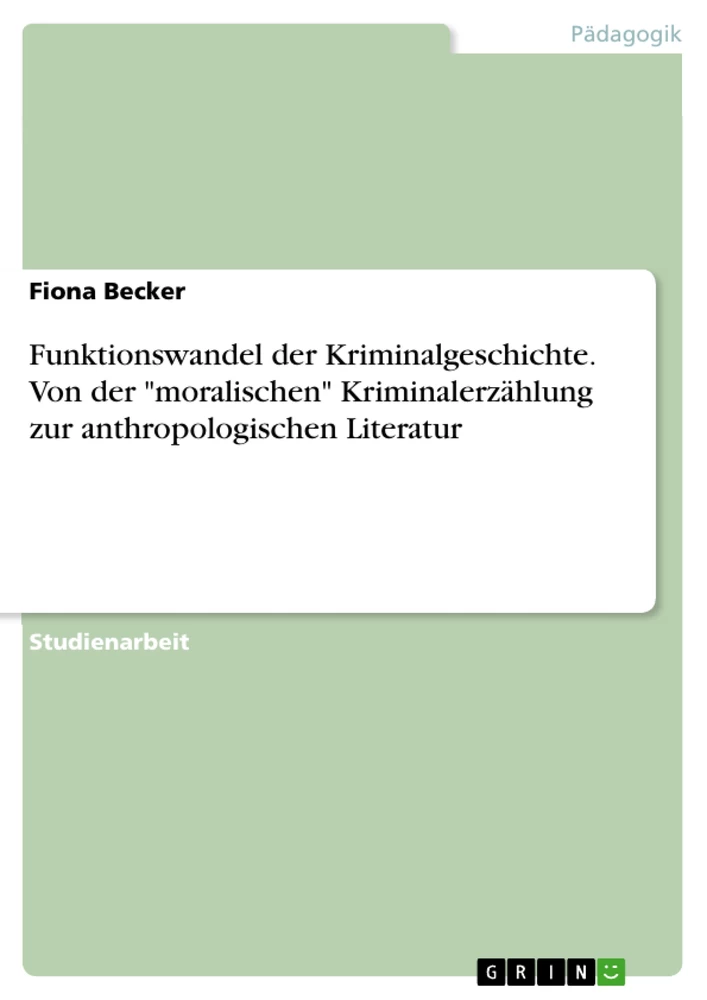Geschichten über Kriminalfälle erfreuen sich seit der Spätaufklärung besonderer Beliebtheit. Begonnen hat diese Tradition im Frankreich des 18. Jahrhunderts mit der Veröffentlichung von François Gayot de Pitavals Sammlung von Rechtsfällen im Jahre 1734. Das besondere hieran war die Darstellungsform der einzelnen Fälle. Pitaval versuchte, sowohl für den Juristen als auch für den interessierten Laien zu schreiben. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war das insgesamt 60 Bände fassende Werk ein richtiger Bestseller. Doch besonders die doppelte Zielsetzung des Pitavals führte vermehrt zur Kritik. Bei Joachim Lindert heißt es dazu, dass die Fälle für Laien zu schwer zu verstehen seinen, zudem wäre die Verwendung der vielen Fachtermini für den Lesefluss hinderlich und wenig fesselnd.
Als Prototyp der Gattung zählt heute Schillers „Verbrecher aus Verlorener Ehre“. In diesem Text geht es um das Leben des Sonnenwirths Christian Wolf, der durch seine körperlichen und finanziellen Unzulänglichkeiten und aus Liebe zu einer Frau in die Kriminalität abrutscht. Durch Ausgrenzung und Ächtung seiner Bemühungen durch die Gesellschaft, sowie die harte Bestrafung seiner Taten, entgleitet ihm sein rechtschaffendes Leben immer mehr, bis er schließlich zum Mörder wird.
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung der Kriminalerzählung im 18. und 19. Jahrhundert und analysiert die Geschichte von Friedrich Schillers "Verbrecher aus verlorener Ehre".
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- 1. Einleitung
- 2. Der Beginn des Genres, Kriminalgeschichte
- 2.1 Der Pitaval- Beginn einer Faszination
- 2.2 Meißners Skizzen zwischen Wahrheit und Fiktion- Die aufgeklärte Fallgeschichte
- 3. Friedrich Schiller. Verbrecher aus verlorener Ehre
- 3.1 Schlüsselszenen und Erzähltechnik
- 3.2 Schillers Rechtskritik
- 3.3 Der Sonnenwirth als Quelle der Menschenkenntnis
- 4. Kriminalliteratur zu Beginn des 19. Jahrhunderts
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung des Genres der Kriminalgeschichte von der "moralischen Kriminalitätserzählung" zur "anthropologischen Literatur". Sie analysiert, wie die Fallgeschichte im Kontext der Aufklärung entstand und welche Veränderungen sie im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts durchmachte. Dabei wird insbesondere der Wandel von der bloßen Darstellung von Verbrechen zu einer anthropologischen Betrachtungsweise beleuchtet.
- Die Entstehung der Kriminalgeschichte im 18. Jahrhundert
- Der Pitaval als Ausgangspunkt des Genres und seine Bedeutung
- Die Rolle von Friedrich Schiller und seiner "Verbrecher aus verlorener Ehre" in der Entwicklung der anthropologischen Literatur
- Die Verfestigung des Genres der Kriminalgeschichte im 19. Jahrhundert
- Der Einfluss von Autoren wie Heinrich von Kleist und E.T.A. Hoffmann
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Kapitel 1 stellt die Leitfrage der Arbeit vor und führt in die historische Entwicklung des Genres der Kriminalgeschichte ein. Kapitel 2 beleuchtet den Beginn des Genres mit der Veröffentlichung des Pitavals im 18. Jahrhundert. Hier wird der Pitaval als "Bestseller" seiner Zeit vorgestellt und seine Bedeutung im Kontext der Kriminalerzählung analysiert. Kapitel 3 widmet sich Friedrich Schillers "Verbrecher aus verlorener Ehre" und untersucht die Entwicklung von der Fallgeschichte zur anthropologischen Literatur. Kapitel 4 betrachtet die weitere Entwicklung der Kriminalliteratur im 19. Jahrhundert.
Schlüsselwörter (Keywords)
Kriminalgeschichte, Anthropologische Literatur, Aufklärung, Pitaval, Friedrich Schiller, "Verbrecher aus verlorener Ehre", Fallgeschichte, Rechtskritik, Menschenkenntnis, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert
Häufig gestellte Fragen
Wer begründete das Genre der Kriminalgeschichte im 18. Jahrhundert?
Als wichtiger Ausgangspunkt gilt François Gayot de Pitaval, der ab 1734 eine berühmte Sammlung von Rechtsfällen veröffentlichte, die sowohl Juristen als auch Laien faszinierte.
Warum gilt Schillers „Verbrecher aus verlorener Ehre“ als anthropologische Literatur?
Schiller stellt nicht nur die Tat in den Vordergrund, sondern untersucht die psychologischen und sozialen Ursachen, die einen Menschen zum Verbrecher machen, und fordert damit „Menschenkenntnis“ ein.
Was thematisiert Schillers Rechtskritik in diesem Werk?
Schiller kritisiert die unerbittliche Härte des Gesetzes und die gesellschaftliche Ausgrenzung, die den Protagonisten Christian Wolf erst recht in die Kriminalität treiben.
Wie wandelte sich die Kriminalerzählung im 19. Jahrhundert?
Das Genre entwickelte sich weg von der rein moralischen Belehrung hin zu einer tieferen psychologischen Analyse des Täters, beeinflusst durch Autoren wie Kleist und E.T.A. Hoffmann.
Was war die Kritik an Pitavals Werk?
Kritiker bemängelten, dass die Verwendung von Fachtermini den Lesefluss störte und die Fälle für Laien oft zu schwer verständlich waren.
- Citar trabajo
- Fiona Becker (Autor), 2013, Funktionswandel der Kriminalgeschichte. Von der "moralischen" Kriminalerzählung zur anthropologischen Literatur, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313584