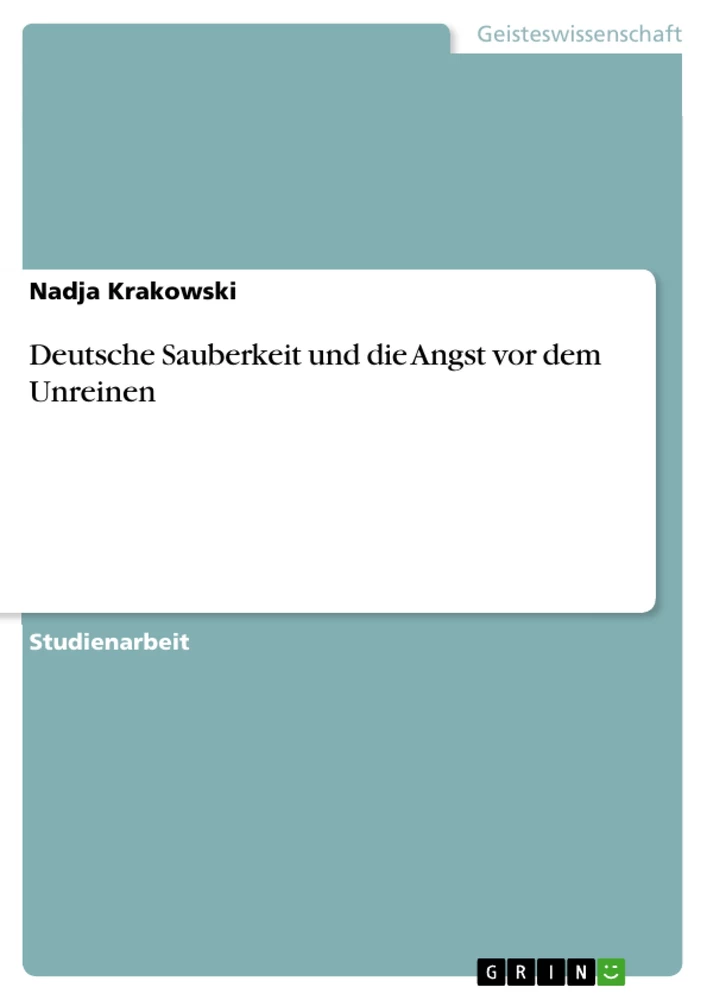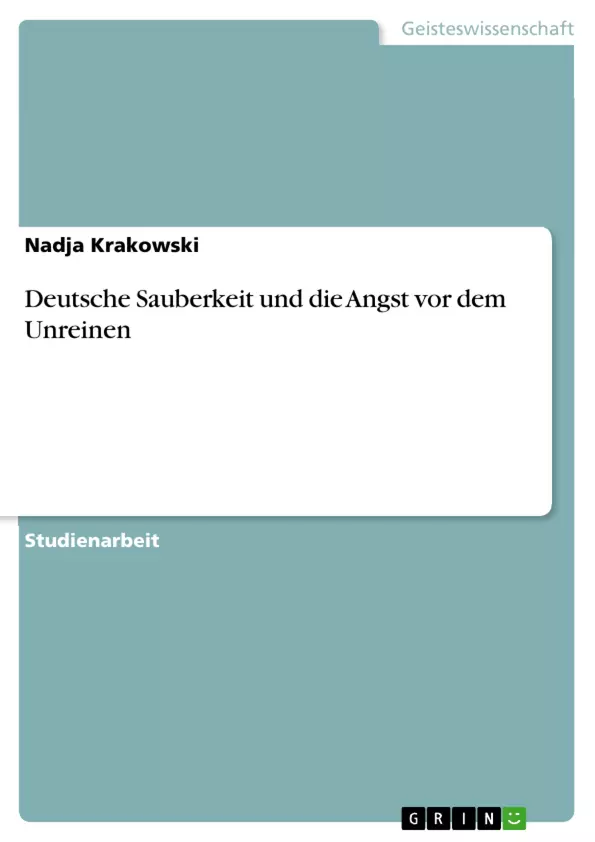Durchforsten wir Zeitschriften, Zeitungsartikel oder das Internet zum Thema „typisch deutsch“, begegnen wir immer wieder dem Wort „Sauberkeit“. In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, weshalb heute andere Nationalitäten, wenn sie nach charakteristischen nationalen Eigenschaften gefragt werden, den Deutschen so bereitwillig „Sauberkeit“ attestieren. Außerdem soll geklärt werden, was der Begriff bedeutet und ob und inwiefern die Deutschen „sauber“ sind.
Wenn man sich die Begrifflichkeit, die mit den Kategorien der Sauberkeit operiert anschaut, begegnen einem im Deutschen sehr häufig Ausdrücke und Redewendungen wie „Abfall der Menschheit“, „reines Gewissen“, „weiße Weste“, „Dreck am Stecken haben“, usw. In unserer Kindheit werden uns schon früh die Regeln „vor dem Essen Händewaschen“ und „nach dem Essen Zähneputzen nicht vergessen“ beigebracht. In der Waschmittelreklame reicht das Wort „sauber“ nicht mehr aus und wird zu „rein“ gesteigert. Auch wenn andere Nationen möglicherweise ähnliche Sauberkeitsvorstellungen haben, die „Sauberkeit“ rangiert im deutschen Wertekanon ganz oben . Das seit 500 Jahren bestehende deutsche Reinheitsgebot für Bier könnte noch als ein eher zufälliges kulturelles Phänomen gedeutet werden, aber sobald man sich anschaut, wie die Deutschen zur Reinhaltung ihrer Rasse bekehrt wurden, liegt der Verdacht nahe, dass es sich hierbei womöglich um einen tiefer sitzenden Komplex handeln könnte.
Die Vorstellungen von Sauberkeit und Reinheit, sowie die Angst vor „Unreinem“, die Bedrohung durch Fremdes, scheinen umfassender in der deutschen Sprache und in deutscher Kultur verankert zu sein.
In meiner Hausarbeit werde ich mich mit diesen Begrifflichkeiten beschäftigen. Dabei beziehe ich mich auf die deutsche Geschichte der letzten hundert Jahre. Deshalb sei darauf hingewiesen, dass es mir im Umfang meiner Hausarbeit lediglich gelingen wird, einen kleinen Teil der Reinlichkeitsfrage, die viel weiter in die deutsche Geschichte zurückreicht, zu beantworten. Das Kernthema ist hierbei der Umgang mit Schmutz und Unsauberem und weniger die Entwicklungsphasen von Hygienevorstellungen oder Putzanleitungen.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Geschichte hygienischer Entwicklungen
- Der reinliche Bürger
- Hygiene als öffentliche Aufgabe
- Nach dem zweiten Weltkrieg
- „Sauberkeit“ und „Reinlichkeit“
- Die Etymologie der Begriffe
- Reinheit zur Erzeugung von Ordnung
- Der Schmutz der Welt
- Juden
- Einwanderer
- Frauen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Sauberkeit und Reinheit in der deutschen Kultur und Geschichte. Sie beleuchtet die Entwicklung des Begriffs "Sauberkeit" im Laufe der Zeit und analysiert die verschiedenen Vorstellungen von Schmutz und Unsauberkeit, die in der deutschen Sprache und Kultur verankert sind.
- Die Entwicklung von Hygienevorstellungen in Deutschland
- Der Zusammenhang zwischen Sauberkeit und gesellschaftlicher Ordnung
- Die Rolle von Schmutz und Unsauberkeit als Symbol für Fremdes und Bedrohliches
- Die Verbindung von Sauberkeit und Nationalismus
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt die Relevanz des Themas "Sauberkeit" in der deutschen Kultur heraus und führt die zentrale Forschungsfrage ein. Es werden verschiedene Beispiele für die Verwendung des Begriffs "Sauberkeit" in der deutschen Gesellschaft aufgezeigt.
- Geschichte hygienischer Entwicklungen: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung von Hygienevorstellungen in Deutschland von der Frühen Neuzeit bis zur Nachkriegszeit. Es beleuchtet die Rolle des bürgerlichen Selbstverständnisses, die Bedeutung der Hygiene für die öffentliche Ordnung und die Herausforderungen der Müllbeseitigung im 20. Jahrhundert.
- „Sauberkeit“ und „Reinlichkeit“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Etymologie der Begriffe "Sauberkeit" und "Reinlichkeit" und untersucht die Bedeutung von Reinheit für die Herstellung von Ordnung und Kontrolle.
- Der Schmutz der Welt: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Arten von Schmutz und Unsauberkeit, die in der deutschen Kultur als bedrohlich und unerwünscht wahrgenommen wurden. Es geht insbesondere auf die Verwendung von Schmutz als Symbol für Juden, Einwanderer und Frauen ein.
Schlüsselwörter (Keywords)
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Sauberkeit, Reinlichkeit, Hygiene, Schmutz, Unsauberkeit, Ordnung, Kontrolle, Deutschland, Geschichte, Kultur, Nationalismus, Fremdes, Bedrohung, Juden, Einwanderer, Frauen.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Sauberkeit als typisch deutsche Eigenschaft?
Ja, international wird Deutschen oft eine besondere Affinität zur Sauberkeit attestiert, was tief im deutschen Wertekanon und der Geschichte verankert ist.
Wie hängen Sauberkeit und gesellschaftliche Ordnung zusammen?
Reinheit dient oft der Erzeugung von Ordnung; Begriffe wie "reines Gewissen" oder "weiße Weste" zeigen die moralische Dimension von Sauberkeit.
Wann wurde Hygiene in Deutschland zur öffentlichen Aufgabe?
Mit der Entwicklung des modernen Staates und dem bürgerlichen Selbstverständnis wurde Hygiene zunehmend reguliert und als öffentliche Aufgabe wahrgenommen.
Welche Rolle spielte der Begriff "Unreinheit" in der Diskriminierung?
Die Angst vor dem "Unreinen" wurde historisch instrumentalisiert, um Gruppen wie Juden, Einwanderer oder Frauen als bedrohlich oder minderwertig zu markieren.
Was ist das deutsche Reinheitsgebot für Bier?
Es ist ein seit über 500 Jahren bestehendes kulturelles Phänomen, das die Reinheit von Lebensmitteln als wichtigen Wert in der deutschen Kultur unterstreicht.
- Citar trabajo
- Nadja Krakowski (Autor), 2011, Deutsche Sauberkeit und die Angst vor dem Unreinen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314466