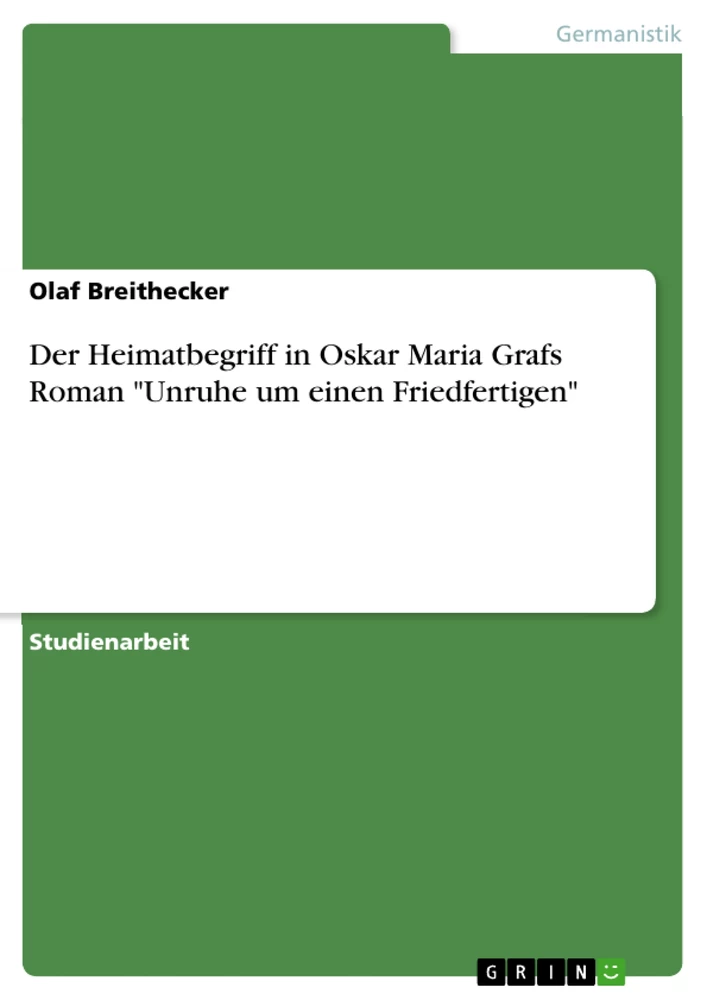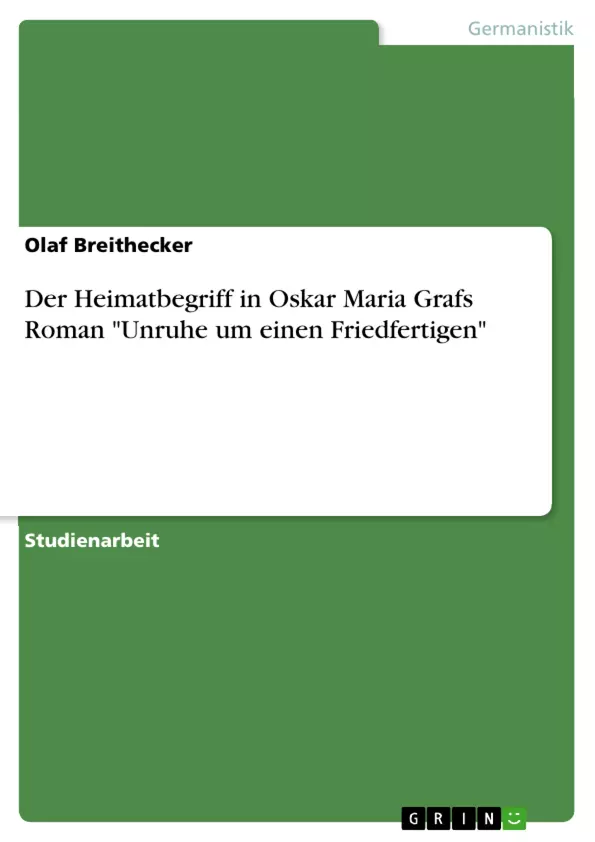In meiner Hausarbeit über „Unruhe um einen Friedfertigen" möchte ich zunächst kurz das Stilideal Oskar Maria Grafs herausarbeiten. Indem er sich für sehr realistische Darstellungsformen bemüht, unterscheidet er sich von einer Volkstümelei, die gerade in der 1920 und 1930er Jahren sehr beliebt war. Da sich unser Hauptseminar mit Heimatliteratur befasst hat, möchte ich die Besonderheiten des Heimatkonzepts bei Oskar Maria Graf vorstellen. Die Besonderheit der Heimat soll einmal für die Darstellung der Heimat im Allgemeinen und später am Beispiel des Schusterhauses untersucht werden.
Im nächsten Schritt möchte ich zeigen, wie sehr sich die Heimat in „Unruhe um einen Friedfertigen“ wandelt. Dabei möchte ich vor allem auf die historischen Krisensituationen Erster Weltkrieg, Inflation und die Infiltration des Dorfes durch die Nationalsozialisten eingehen. Dabei soll ebenfalls ausgezeigt werden, wie sehr die Staatsmacht, das „A-bopa“, in die Lebenswelt der Landbewohner eingreift und wie eng sie mit der Stadt konnotiert ist.
Im weiteren Verlauf der Hausarbeit möchte ich den Gegensatz zwischen den Revolutionären und den Nationalsozialisten an den Personen von Ludwig Allberger, Peter Lochner und Silvan Lochner beleuchten. In diesen Kontext möchte ich die jüdische Vergangenheit des Schusters Kraus als Teil der deutschen Geschichte interpretieren. Des Weiteren soll das Besondere an Oskar Maria Grafs Erzähltechnik und die Parallelen von „Unruhe um einen Friedfertigen“ und dem Leben des Autors behandelt werden. Dabei sollen u.A. das Exil und die Figur des Schusters als typisches Kennzeichen für Grafs Erzählmethode untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- Einleitung
- Die Beschreibung der Heimat – Heimat als Teil der Exilliteratur
- Das Schusterhaus als Heimat und Rückzugsort
- Das Dorf als natürlicher Mikrokosmos und das „A-bopa“ als Gegenspieler
- Der Krieg als Teil des „A-bopa“
- Die Beschreibung der Stadt und das Problem der Kriegsheimkehrer
- Die Darstellung der Revolution
- Die Darstellung der Revolutionäre Ludwig Allberger und Peter Lochner
- Die Bedrohung der Idylle durch die Nationalsozialisten
- Die jüdischen Wurzeln des Schusters Kraus und die Bedrohung durch die Nazis
- Die besondere Erzähltechnik von Oskar Maria Graf
- Die Unzuverlässigkeit der Idylle
- Das Beispiel des Schusters als Teil der deutschen Geschichte
- Parallelen mit Grafs Leben
- Unruhe um einen Friedfertigen als Teil der Exilliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Hausarbeit befasst sich mit Oskar Maria Grafs Roman „Unruhe um einen Friedfertigen“ und analysiert die Darstellung von Heimat im Kontext der Exilliteratur. Die Arbeit beleuchtet die besondere Erzähltechnik Grafs und wie diese das Leben der Menschen im Dorf, insbesondere des jüdischen Schusters Kraus, im Angesicht von Krieg, Revolution und nationalsozialistischer Bedrohung widerspiegelt.
- Die Bedeutung von Heimat als Konzept und seine Darstellung in der deutschen Nachkriegsliteratur
- Die Darstellung des Dorfes als Mikrokosmos und die Konfrontation mit dem „A-bopa“ (der Staatsmacht)
- Die Rolle der jüdischen Identität des Schusters Kraus im Kontext der deutschen Geschichte
- Die besondere Erzähltechnik von Oskar Maria Graf, die Realismus und Kritik verbindet
- Der Bezug von Grafs Werk zu seinem eigenen Leben und den Erfahrungen des Exils
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
Die Einleitung analysiert Grafs Stil und zeigt seine Abgrenzung von der populären Heimatliteratur der 1920er und 1930er Jahre. Die Arbeit betrachtet die Heimat im Allgemeinen und speziell am Beispiel des Schusterhauses in „Unruhe um einen Friedfertigen“.
Das erste Kapitel beleuchtet die Darstellung von Heimat in der deutschen Nachkriegsliteratur, vor allem im Hinblick auf die emotionalen Aufladungen und Idealisierungen des ländlichen Lebens. Graf hingegen präsentiert eine realistische Darstellung des Dorfes und seiner Bewohner, die auch negative Aspekte des bäuerlichen Lebens aufzeigt.
Das zweite Kapitel betrachtet das Schusterhaus als Rückzugsort für den jüdischen Schuster Kraus und seine Schwierigkeiten, sich in der Dorfgemeinschaft zugehörig zu fühlen. Sein Haus wird zum Ort der Sicherheit und der Heimat, die ihm das Dorf nicht bieten kann.
Das dritte Kapitel beschreibt das Dorf als Mikrokosmos, der durch die politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts verändert und beeinflusst wird. Die Arbeit untersucht die Rolle des „A-bopa“ (der Staatsmacht), die in die Lebenswelt der Dorfbewohner eingreift.
Das vierte Kapitel widmet sich der besonderen Erzähltechnik von Oskar Maria Graf, die durch Realismus, Kritik und eine stark an seinem eigenen Leben orientierte Darstellung geprägt ist.
Schlüsselwörter (Keywords)
Heimatliteratur, Exilliteratur, Oskar Maria Graf, „Unruhe um einen Friedfertigen“, Heimat, Idylle, Dorf, „A-bopa“, Staatsmacht, Revolution, Nationalsozialismus, Judentum, Schuster Kraus, Erzähltechnik, Realismus, Kritik, Exil.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Oskar Maria Graf den Begriff „Heimat“ in seinem Roman?
Graf nutzt eine realistische Darstellungsform, die sich von der damals populären „Volkstümelei“ abgrenzt und Heimat als einen durch politische Krisen gefährdeten Mikrokosmos zeigt.
Welche Rolle spielt der Schuster Kraus in der Erzählung?
Der jüdische Schuster Kraus symbolisiert die Bedrohung der dörflichen Idylle durch den Nationalsozialismus und die Schwierigkeiten der Zugehörigkeit in der deutschen Geschichte.
Was versteht Graf unter dem Begriff „A-bopa“?
„A-bopa“ steht für die anonyme Staatsmacht, die in die Lebenswelt der Landbewohner eingreift und oft mit der städtischen Welt negativ konnotiert ist.
Welche historischen Krisen werden im Roman thematisiert?
Der Roman behandelt den Ersten Weltkrieg, die Inflation und die Infiltration des Dorfes durch die Nationalsozialisten als Faktoren, die die Heimat wandeln.
Inwiefern ist das Werk Teil der Exilliteratur?
Das Werk reflektiert Grafs eigene Erfahrungen im Exil und seine kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte aus der Distanz.
- Quote paper
- Olaf Breithecker (Author), 2010, Der Heimatbegriff in Oskar Maria Grafs Roman "Unruhe um einen Friedfertigen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314472