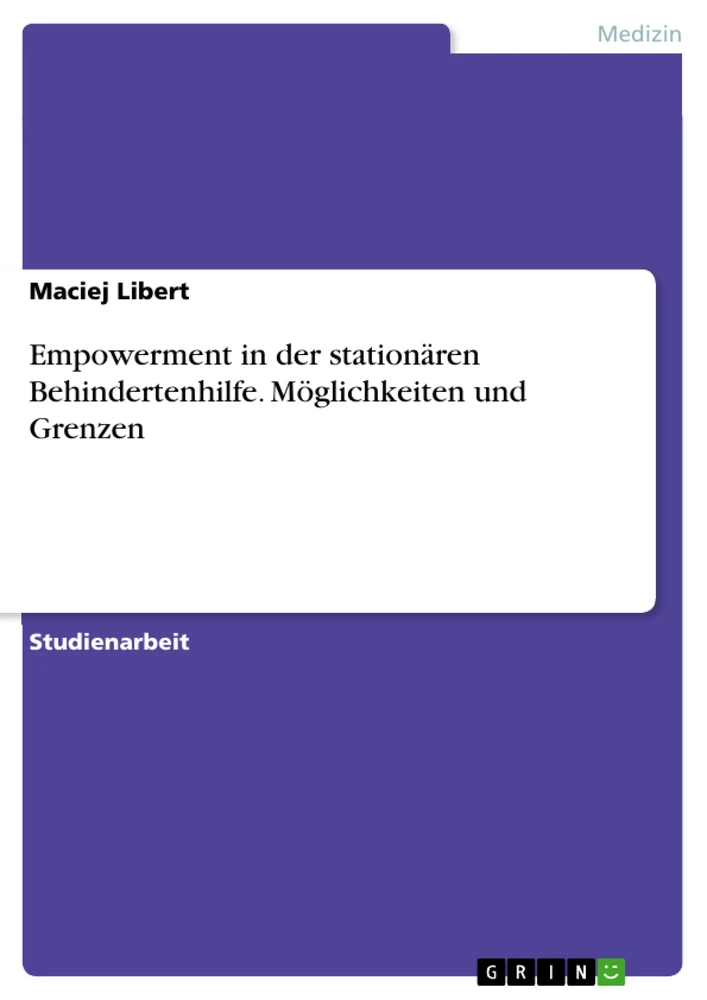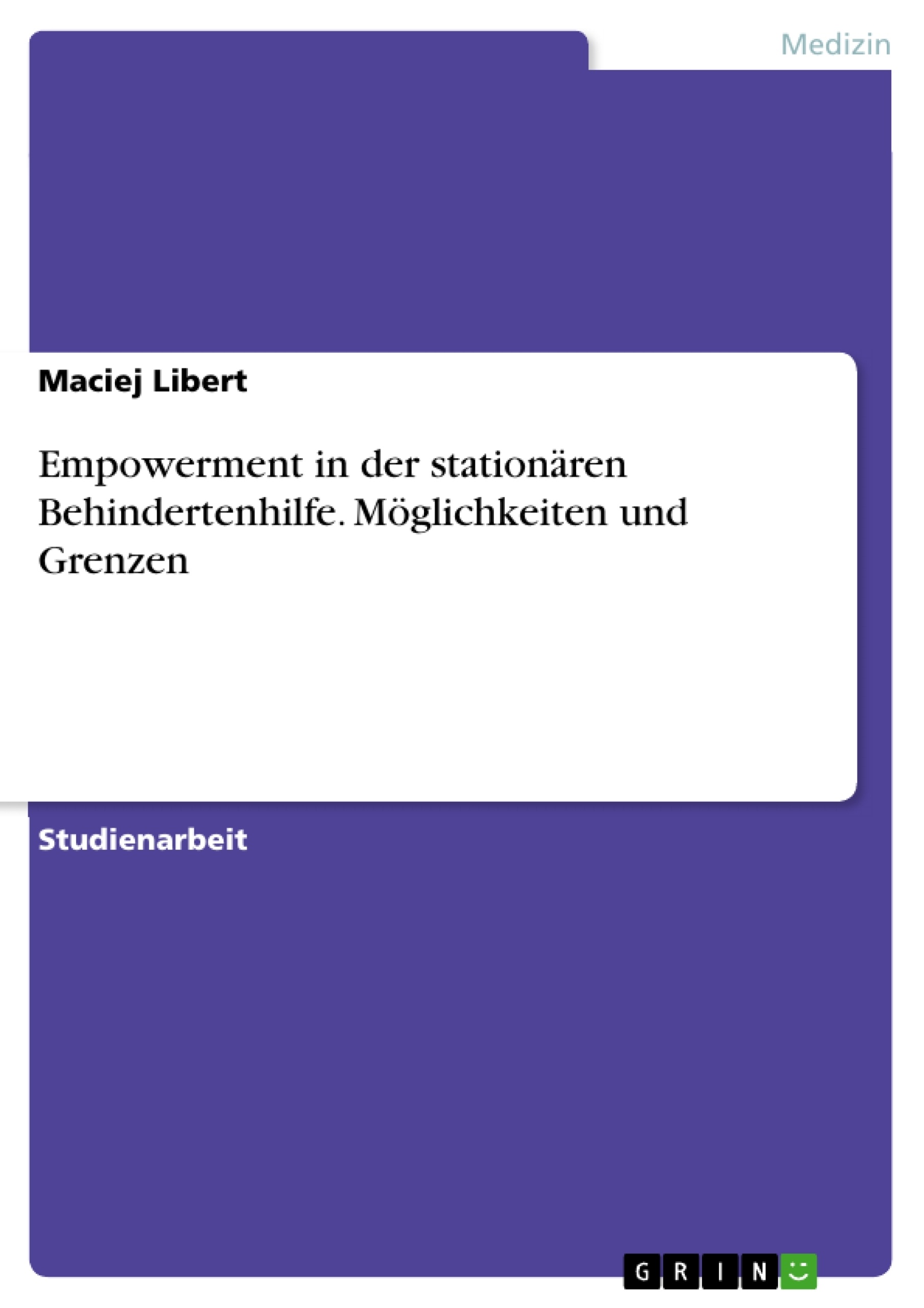Das Leben selbst in die Hand nehmen, Herausforderungen und Krisen meistern, Veränderungen selbstbestimmt gestalten, eigene Möglichkeiten ausschöpfen - so oder so ähnlich würde sicher die Mehrheit der Menschen in der modernen Welt heute die eigenverantwortliche Gestaltung ihres Lebens beschreiben.
Und um genau dieses Phänomen von Macht und Einflussnahme auf die Umstände des eigenen Lebens geht es beim Thema Empowerment. Empowerment ist ein Ansatz der Sozialen Arbeit, der darauf abzielt, die Potenziale und Ressourcen eines Menschen im Sinne einer „Selbstbemächtigung“ zur Lösung von Problemen einzusetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1. Begriffsbestimmung
- 2. Geschichte des Empowerments
- 2.1 Ursprünge in den USA...
- 2.2 Implementierung von Empowerment als Prinzip Sozialer Arbeit
- 3. Grundprinzipien des Empowermentkonzeptes
- 3.1 Das, empowerte' Menschenbild
- 3.2 Partizipation und Ressourcenaktivierung
- 3.3 Ebenen der Empowermentpraxis
- 4. Empowerment konkret: stationäre Behindertenhilfe
- 4.1 Ressourcen und Selbstkonzept geistig behinderter Menschen
- 4.2 Bedingungen und Strukturen der Lebenswelt behinderter Menschen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen von Empowerment am Beispiel der stationären Behindertenhilfe. Sie beleuchtet den Empowermentaansatz als Prinzip der Sozialen Arbeit, das die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fördert. Dabei wird die Bedeutung der Ressourcenaktivierung und der „Hilfe zur Selbsthilfe“ hervorgehoben.
- Begriffsbestimmung von Empowerment und seine historischen Wurzeln
- Grundprinzipien des Empowermentkonzeptes: Menschenbild, Partizipation und Ressourcenaktivierung
- Empowerment in der stationären Behindertenhilfe: Möglichkeiten und Herausforderungen
- Ressourcen und Selbstkonzept von Menschen mit geistigen Behinderungen
- Bedingungen und Strukturen der Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition von Empowerment und setzt diesen Ansatz in einen historischen Kontext. Dabei wird die Entwicklung des Empowerments von seinen Ursprüngen in den Bürgerrechtsbewegungen der USA bis zu seiner Implementierung in der Sozialen Arbeit betrachtet. Im Anschluss werden die Grundprinzipien des Empowermentkonzeptes vorgestellt, einschließlich des „empowerten“ Menschenbildes, der Bedeutung von Partizipation und Ressourcenaktivierung sowie der verschiedenen Ebenen der Empowermentpraxis. Das vierte Kapitel untersucht Empowerment im Kontext der stationären Behindertenhilfe. Hier wird die Anwendung des Empowermentaansatzes auf Menschen mit geistigen Behinderungen beleuchtet, wobei die individuellen Voraussetzungen und die strukturellen Bedingungen ihrer Lebenswelt berücksichtigt werden.
Schlüsselwörter
Empowerment, Behindertenhilfe, Selbstbestimmung, Teilhabe, Ressourcenaktivierung, Menschenbild, Partizipation, soziale Arbeit, stationäre Einrichtungen, geistige Behinderung, Lebenswelt.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Empowerment in der Sozialen Arbeit?
Empowerment zielt auf die „Selbstbemächtigung“ ab, indem Potenziale und Ressourcen von Menschen aktiviert werden, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten.
Wie wird Empowerment in der Behindertenhilfe umgesetzt?
Durch Ressourcenaktivierung und Partizipation werden Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt, Herausforderungen eigenständig zu meistern und Teilhabe zu erleben.
Wo liegen die Ursprünge des Empowerment-Konzepts?
Der Ansatz hat seine Wurzeln in den Bürgerrechtsbewegungen der USA und wurde später als zentrales Prinzip in die Soziale Arbeit implementiert.
Welche Rolle spielt das „empowerte“ Menschenbild?
Es betrachtet den Menschen nicht als Defizitwesen, sondern als Träger von Stärken und Ressourcen, die zur Problemlösung genutzt werden können.
Was sind die Grenzen von Empowerment in stationären Einrichtungen?
Grenzen können durch starre institutionelle Strukturen, rechtliche Rahmenbedingungen oder die individuelle Schwere der Beeinträchtigung gesetzt sein.
- Quote paper
- Maciej Libert (Author), 2015, Empowerment in der stationären Behindertenhilfe. Möglichkeiten und Grenzen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314601