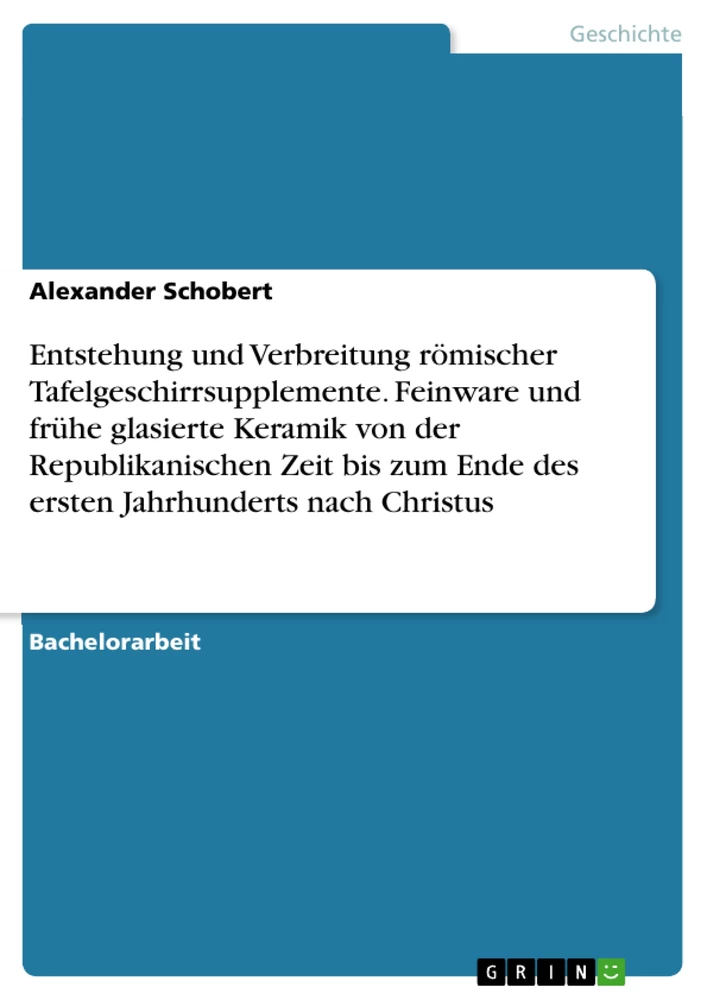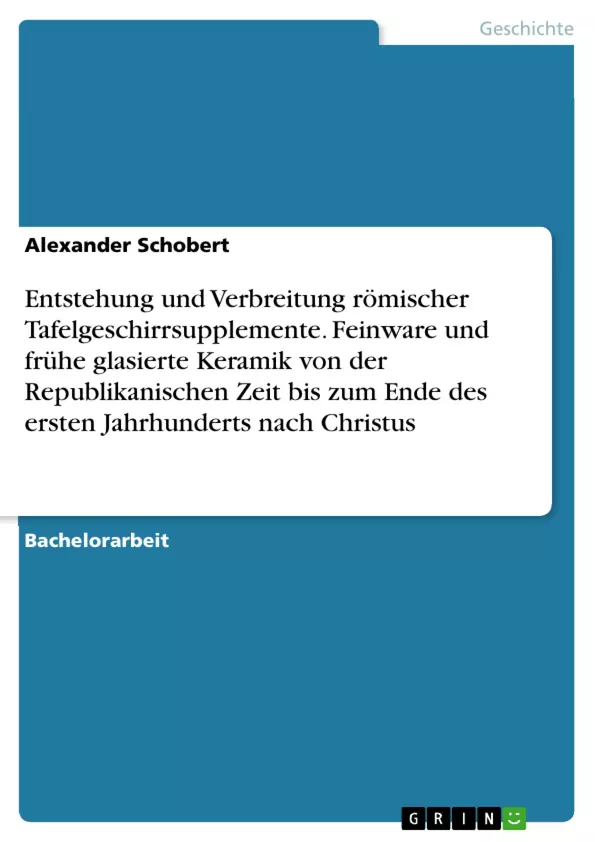Vorliegende Bachelorarbeit behandelt Entstehung und Verbreitung römischer Tafelgeschirrsupplemente von Republikanischer Zeit bis Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Der Untersuchungsschwerpunkt liegt dabei auf Feinware (dünnwandige Keramik) sowie früher glasierter Keramik.
Aus dem Inhalt:
- Forschungsgeschichte
- Verbreitungsgebiete und regionale Produktionszentren von römischer Feinware
- Herstellung glasierter Ware: Arbeitsabläufe, Glasur und Brandführung
Resümee der Arbeit:
Bleiglasurkeramik zeigt sich seit ihrer Genese in Mesopotamien am Ende des 3. Jahrtausends vor Chr als sehr langlebig. Obwohl sie im Fundmaterial relativ selten vorkommt, findet man glasierte Ware, die gesamte Antike hindurch, weit verstreut im Mittelmeerraum und auf dem europäischen Festland. Überall, ob in Gallien oder in Töpfereien an der kleinasiatischen Küste, dürfte eine enge Verwandtschaft in Form und Dekor vorliegen.
Innerhalb des Tafelgeschirrs scheint der bleiglasierte Skyphos mit Ringhenkel und Daumenplatte ein sehr beliebtes Gefäß gewesen zu sein. Den intensiven Ost-West-Austausch von Know-how und Tradition erkennt man am ornamentalen Dekor, der zuweilen Motive des megarischen Bechers aufnimmt. Ebenso ist die Beziehungen zu späthellenistischen Keramiktypen, wie der pergamenischen Applikenkeramik und syrischen Bleiglasurtechniken nahe liegend.
An der Idee, dass die Form und Farbgestaltung glasierter Keramik hauptsächlich auf toreutische Bronze- und Silbervorbilder zurückzuführen ist, lässt sich ohne weiteres festhalten. Ebenso plausibel erscheint jedoch genau der umgekehrte Weg, dass man – um Kosten einzusparen – zuerst glasierte Prototypen auf den Markt brachte. Hatten sich diese als Trendsetter erwiesen, zog die Metallfertigung nach.
Inhaltsverzeichnis (Table of Contents)
- FEINWARE (DÜNNWANDIGE KERAMIK)
- FORSCHUNGSGESCHICHTE
- FABRIKATE UND WARE
- GENESE DER FEINWARE IN REPUBLIKANISCHER ZEIT
- FORMENSCHATZ
- DÜNNWANDIGE TRINKBECHER
- RIPPENBECHER
- ACO-BECHER
- FALTENBECHER
- SCHALEN UND SCHÄLCHEN
- DÜNNWANDIGE KERAMIK AUS DEM MEDITERRANEN OSTEN
- OBERFLÄCHENMERKMALE
- ÜBERZUG
- DEKOR
- VERBREITUNGSGEBIETE UND REGIONALE PRODUKTIONSZENTREN
- RESÜMEE
- FRÜHE GLASIERTE KERAMIK
- FORSCHUNGSGESCHICHTE
- HERSTELLUNG GLASIERTER WARE: ARBEITSABLÄUFE, GLASUR UND BRANDFÜHRUNG
- ENTSTEHUNG UND VERBREITUNG
- RESÜMEE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte (Objectives and Key Themes)
Diese Arbeit befasst sich mit der dünnwandigen Keramik, einem wichtigen Bestandteil des Tafelgeschirrs in der römischen Zeit. Sie untersucht die Forschungsgeschichte des Themas, beschreibt die Herstellungstechniken und den Formenschatz, und beleuchtet die Verbreitung und regionale Produktionszentren dieser Keramikgattung.
- Forschungsgeschichte der dünnwandigen Keramik und wichtige Wissenschaftler
- Herstellungstechniken, Materialien und Brennverfahren
- Formenvielfalt und Typologie der dünnwandigen Keramik
- Verbreitung und regionale Produktionszentren in römischen Gebieten
- Zusammenhang zwischen dünnwandiger Keramik und Tafelkultur
Zusammenfassung der Kapitel (Chapter Summaries)
- Kapitel 1: Feinware (dünnwandige Keramik)
- Stellt den Kontext und die Bedeutung dünnwandiger Keramik im römischen Tafelgeschirr dar.
- Beschreibt die Forschungsgeschichte des Themas und die Entwicklung der Fachterminologie.
- Behandelt die verschiedenen Fabrikate und Warengruppen.
- Präsentiert eine ausführliche Analyse der Formenvielfalt.
- Diskutiert die Oberflächenmerkmale und Dekore.
- Beleuchtet die Verbreitung und die regionalen Produktionszentren.
- Kapitel 2: Frühe Glasierte Keramik
- Beschreibt die Forschungsgeschichte der frühen glasierten Keramik.
- Erörtert die Herstellungstechniken, Glasurarten und Brennverfahren.
- Beleuchtet die Entstehung und Verbreitung glasierter Keramik.
Schlüsselwörter (Keywords)
Dünnwandige Keramik, Pareti Sottili, Thin Walled Pottery, Römische Keramik, Tafelgeschirr, Formenschatz, Produktionszentren, Verbreitung, Glasierte Keramik, Forschungsgeschichte, Fabrikate, Fabric, Petrographische Analyse, Oberflächendesign, Dekor.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter römischer „Feinware“?
Feinware bezeichnet besonders dünnwandige Keramik, die im römischen Tafelgeschirr vor allem als Trinkgefäße (Becher, Schalen) verwendet wurde.
Wie wurde frühe glasierte Keramik hergestellt?
Die Keramik wurde oft mit einer Bleiglasur versehen, wobei spezielle Brennverfahren und Arbeitsabläufe nötig waren, um die charakteristische glänzende Oberfläche zu erzielen.
Welche Gefäßformen waren besonders beliebt?
Besonders verbreitet waren der bleiglasierte Skyphos mit Ringhenkel sowie verschiedene dünnwandige Trinkbecher wie Aco-Becher oder Rippenbecher.
Gab es einen Austausch zwischen Keramik und Metallgefäßen?
Ja, die Form- und Farbgestaltung glasierten Geschirrs orientierte sich oft an teuren Bronze- oder Silbervorbildern (Toreutik), um Luxus zu einem günstigeren Preis zu imitieren.
Wo lagen die Produktionszentren dieser Keramik?
Wichtige Zentren befanden sich in Italien, Gallien, aber auch an der kleinasiatischen Küste, wobei ein intensiver Ost-West-Austausch von Techniken stattfand.
Welche Dekore sind typisch für diese Zeit?
Häufig finden sich ornamentale Dekore, Appliken oder Motive, die von späthellenistischen Vorbildern wie dem megarischen Becher beeinflusst sind.
- Quote paper
- Alexander Schobert (Author), 2014, Entstehung und Verbreitung römischer Tafelgeschirrsupplemente. Feinware und frühe glasierte Keramik von der Republikanischen Zeit bis zum Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/314668