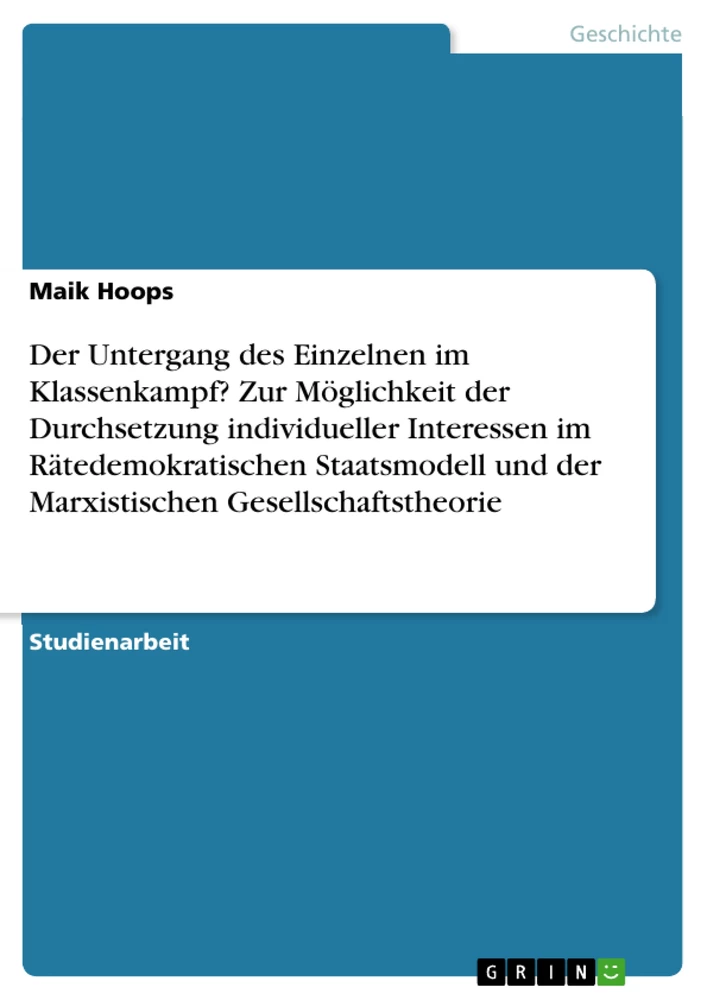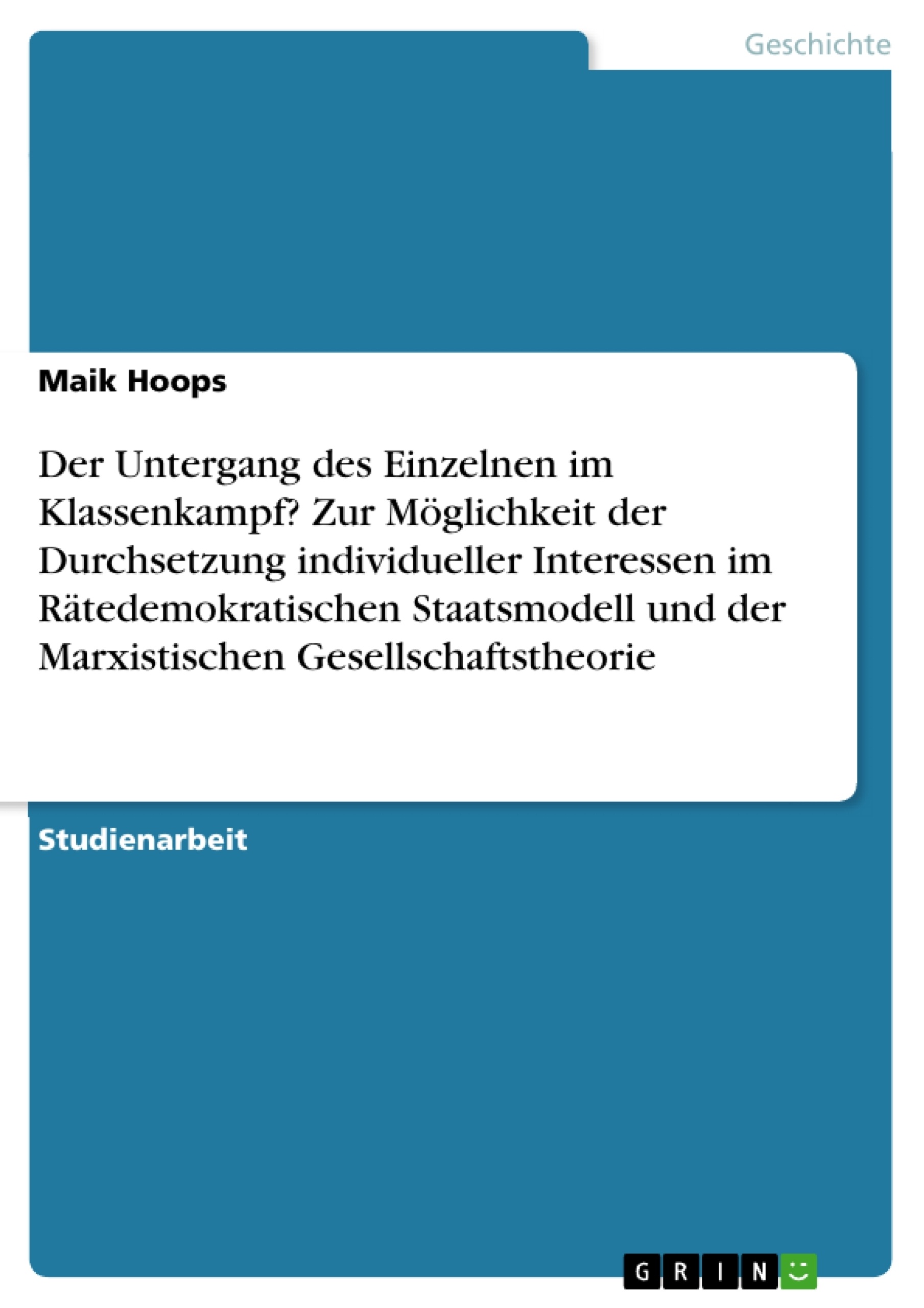Diese Hausarbeit ist ein wissenschaftlicher Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem sozialistischen Staatsmodell der Rätedemokratie und dem in diesem Ausdruck zu findenden Menschenbild des Marxismus.
Gegen Ende des Ersten Weltkrieges stellte sich auch in Deutschland mit dem bevorstehenden Zusammenbruch der Monarchie die Frage nach einer politischen Neuordnung. Hier witterten vor allem die deutschen Sozialisten Chancen auf die Verwirklichung ihrer Ideale. Dabei kam es zu einem innerparteilichen Streit in der SPD, der die Abspaltung der „Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands“ (USPD) zur Folge hatte. Diese Unabhängigen Sozialdemokraten hielten im Gegensatz zur SPD weiterhin streng am Marxismus fest und pochten auf die Errichtung einer Räterepublik, einem basisdemokratischen Staat, in dem die "Diktatur des Proletariats" herrschen sollte. Diese Hausarbeit befasst sich mit diesem Staatsmodell.
Zunächst wird das marxistische Weltbild als Grundlage der Räterepublik verdeutlicht, daraufhin das konkrete Modell der Räterepublik als Verwirklichung dieser Ideale analysiert. Dabei wird der Fokus auf die Rolle des Individuums gelegt: Intention dieser Hausarbeit ist es, die Frage zu untersuchen, inwieweit das Staatsmodell der klassischen Räterepublik im demokratischen Willensbildungsprozess dem Individualismus des Einzelnen gerecht wird bzw. wie sehr er im Kollektiv an Bedeutung verliert. Ermöglicht dieses System, dessen Demokratie auf betrieblichen Versammlungen aufbaut, den Ausdruck und die Durchsetzung individueller, auch nichtwirtschaftlicher Interessen?
Damit verbunden soll die theoretische Grundlage der Räterepublik, der Marxismus, daraufhin untersucht werden, wie er zum Individualismus steht und wie er die Freiheit des Einzelnen interpretiert. Dazu soll herausgearbeitet werden, inwieweit er seinen Fokus auf die wirtschaftlichen Interessen der Menschheit legt und nichtwirtschaftliches Interesse unbeachtet lässt. Des Weiteren ist die Frage zu klären, wie sehr der Marxismus unter Nichtberücksichtigung anderer Faktoren menschliches Interesse ausschließlich von den jeweiligen Produktionsverhältnissen ableitet. Schließlich soll elaboriert werden, inwieweit der Kollektivismus und die Nichtbeachtung des Individualismus des Marxismus im Rätesystem ihren konkreten Ausdruck finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Grundzüge des Marxismus
- 1.1 Marxistische Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie
- 1.2 Die Entfremdung der Arbeit
- 1.3 Religion als Opium des Volkes
- 1.4 Marxistische Philosophie
- 1.5 Menschenrechtsgedanke im Marxismus
- 1.6 Ziele des Marxismus
- 2. Das „,reine\" Rätesystems der USPD
- 2.1 Aufbau und Prinzipien
- 2.2 Ziel und Zweck der Räterepublik
- 3. Analyse des Marxismus
- 4. Analyse der Räterepublik
- 5. Fazit
- 6. Bibliografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit das Staatsmodell der klassischen Räterepublik dem Individualismus des Einzelnen gerecht wird und wie stark dieser im Kollektiv an Bedeutung verliert. Im Fokus steht insbesondere das Modell der reinen Rätedemokratie der USPD im zeitlichen Rahmen der Jahre 1918/19. Ziel ist es, die theoretische Grundlage der Räterepublik, den Marxismus, auf seine Haltung zum Individualismus und seine Interpretation der Freiheit des Einzelnen zu untersuchen. Dabei soll herausgearbeitet werden, inwieweit der Marxismus seinen Fokus auf die wirtschaftlichen Interessen der Menschheit legt und nichtwirtschaftliches Interesse unberücksichtigt lässt. Die Analyse soll beleuchten, wie stark der Marxismus unter Nichtberücksichtigung anderer Faktoren menschliches Interesse ausschliesslich von den jeweiligen Produktionsverhältnissen ableitet.
- Die Rolle des Individualismus im Rätesystem
- Die Interpretation der Freiheit des Einzelnen im Marxismus
- Die Bedeutung wirtschaftlicher Interessen im Marxismus
- Die Abhängigkeit menschlichen Interesses von den Produktionsverhältnissen
- Der Ausdruck von Kollektivismus und Nichtbeachtung des Individualismus im Rätesystem
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und stellt die Fragestellung sowie die Intention der Untersuchung dar. Sie skizziert die historische Situation in Deutschland im Anschluss an den Ersten Weltkrieg und die Entstehung der USPD als Abspaltung der SPD.
Das erste Kapitel widmet sich den Grundzügen des Marxismus als theoretischer Grundlage der Räterepublik. Es beleuchtet die marxistische Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie, die Entfremdung der Arbeit, die Rolle der Religion, die marxistische Philosophie, den Menschenrechtsgedanken und die Ziele des Marxismus.
Im zweiten Kapitel wird das „reine“ Rätesystem der USPD in seinen Aufbauprinzipien und Zielen erläutert.
Die Kapitel 3 und 4 befassen sich mit der Analyse des Marxismus und der Räterepublik im Hinblick auf die Fragestellung der Hausarbeit.
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die eingangs gestellte Frage.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen der Rätedemokratie, dem Marxismus, dem Individualismus, dem Kollektivismus, der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interessen, der Freiheit des Einzelnen und der Produktionsverhältnisse. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der Räterepublik und untersucht deren Auswirkungen auf die individuelle Freiheit im Kontext der marxistischen Gesellschafts- und Wirtschaftstheorie.
- Quote paper
- Maik Hoops (Author), 2015, Der Untergang des Einzelnen im Klassenkampf? Zur Möglichkeit der Durchsetzung individueller Interessen im Rätedemokratischen Staatsmodell und der Marxistischen Gesellschaftstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316422