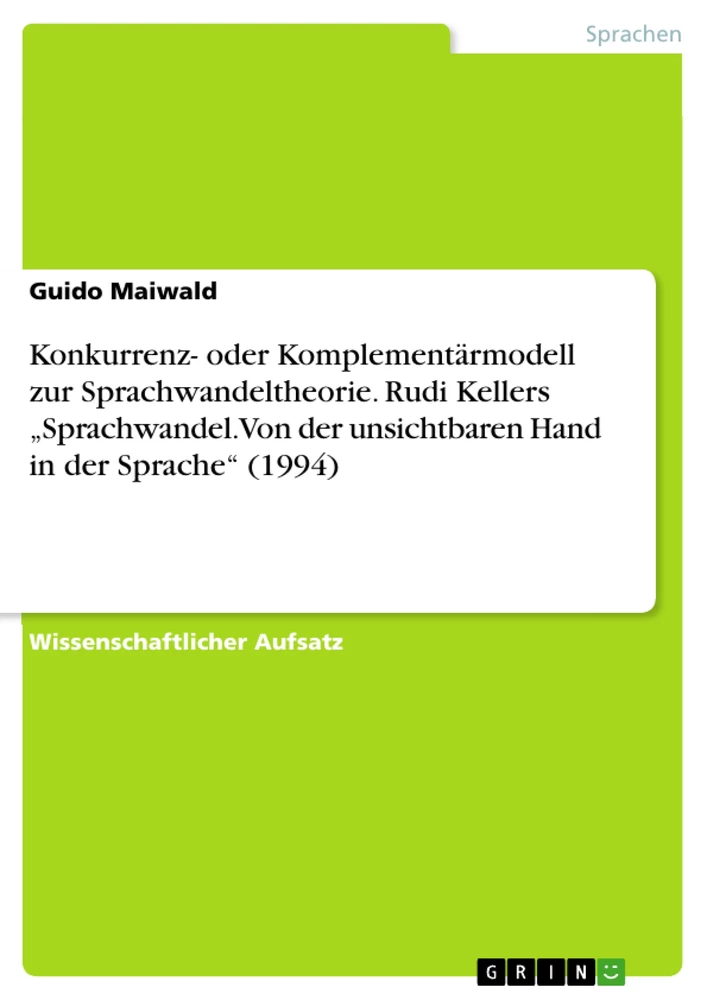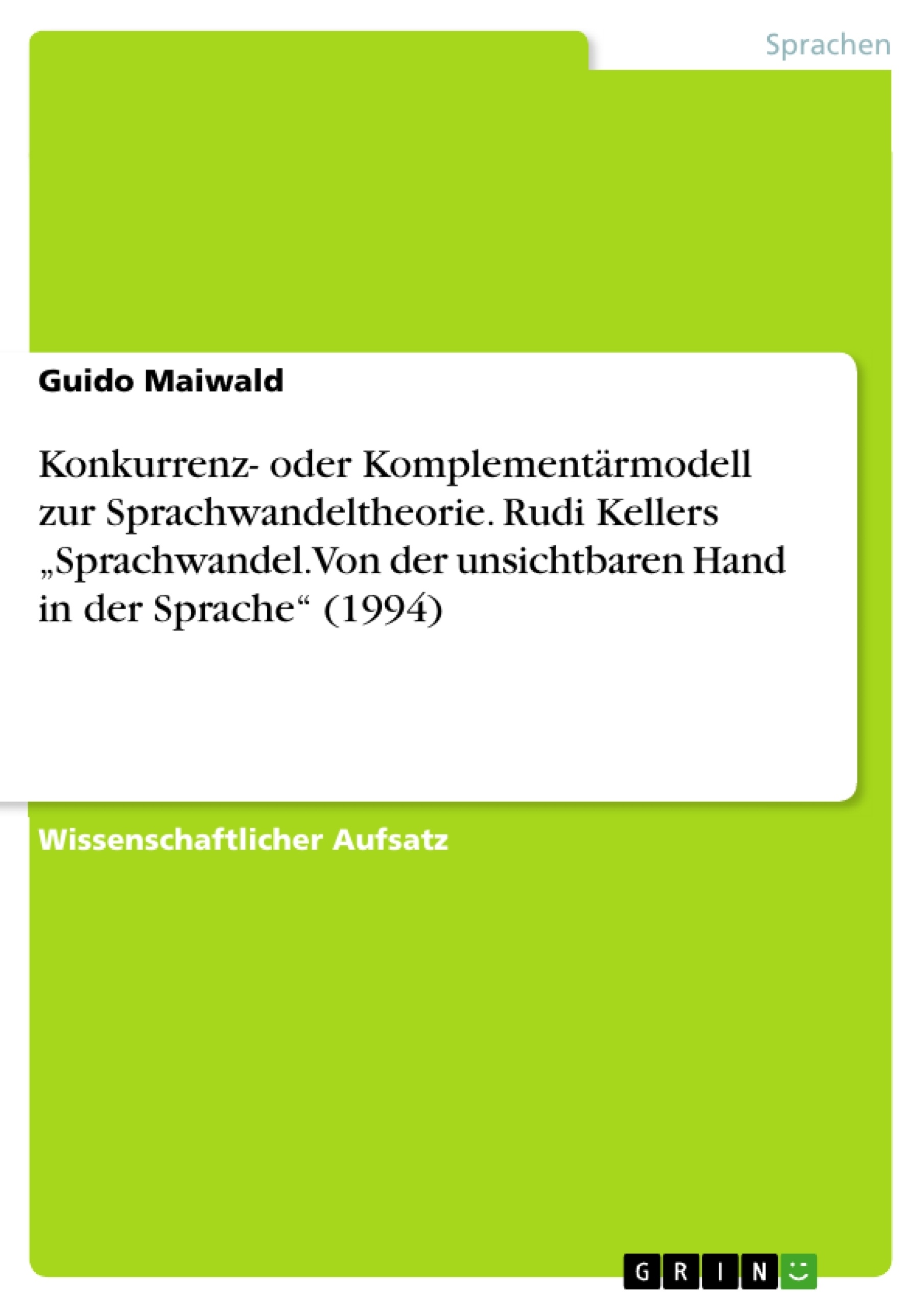Was ist die Aufgabe von Sprache und wer oder was verändert sie und warum? Gemeinhin war die Sprachwandelforschung Hauptforschungsgegenstand der historischen Sprachwissenschaft, wobei diese auf strukturalistischen und generativen Theorien basierte. Neben dem Sprachwandel waren und sind Sprachgeschichte, Synchronie und Diachronie, sowie Rekonstruktion Untersuchungsgegenstände der Sprachforschung.
Ziel des zweiten Kapitels ist es zunächst, die wichtigsten Theorien und Begrifflichkeiten, sowie kontrastierende Lehrmeinungen zum Sprachwandel vorzustellen. Im 3. Kapitel wird im Wesentlichen Rudi Kellers Publikation „Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache“ aus dem Jahre 1994 vorgestellt. Diese enthält zum einen eine Kritik an der Vorangehensweise der bisherigen Theorien zum Sprachwandel. Zudem entwirft Keller seine eigene Theorie, in der er von einem bislang unterbeleuchteten Faktor im Prozess des Sprachwandels spricht und daher auch den Begriff der 3. Dimension gebraucht. Im darauf folgenden Teil soll geklärt werden, inwieweit Kellers Modell als Konkurrenz- oder Komplementärmodell zu anderen Theorien des Sprachwandels verstanden werden kann.
„Die Welt ändert sich; es gibt ständig technischen Fortschritt und die Sprache muss sich deshalb ebenfalls ändern, um mit der Entwicklung der Welt Schritt zu halten.“
Diese Erklärung gab Rudi Keller als Beispiel einer zu kurz greifenden und nicht plausiblen Erklärung zu den Ursachen des Sprachwandels. Wie sollte zum Beispiel mithilfe dieses Paradigmas erklärt werden, warum sich z. B. die „Photographie“ zum simplifizierten „Foto“ wandelte. Technische Veränderungen bieten demnach weder notwendige noch hinreichende Erklärungsansätze zum Sprachwandel, da es nicht Aufgabe der Sprache sei die Welt abzubilden. Nach Bußmann kann sprachlicher Wandel als Prozess der Veränderung von Sprachelementen in der Zeit gesehen werden. Dabei vollzieht sich Sprachwandel auf allen sprachlichen Ebenen, also im Bereich der Phonologie, Morphologie, Syntax und Semantik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien zum Sprachwandel
- Kellers Theorie von der "unsichtbaren Hand"
- Résumé: Kellers Theorie - Konkurrenz- oder Komplementärmodell zur Sprachwandeltheorie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert Rudi Kellers Theorie des Sprachwandels, die in seinem Werk "Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache" (1994) dargelegt wird. Es wird untersucht, inwiefern Kellers Theorie als Konkurrenz- oder Komplementärmodell zu etablierten Theorien des Sprachwandels verstanden werden kann.
- Kritik an traditionellen Theorien des Sprachwandels
- Kellers Konzept der "unsichtbaren Hand" als Erklärung für Sprachwandel
- Die Rolle von sozialen und kulturellen Faktoren beim Sprachwandel
- Die Bedeutung des Sprachgebrauchs für die Sprachentwicklung
- Die Frage nach der Konkurrenz oder Komplementarität von Kellers Theorie zu anderen Modellen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Rudi Kellers Kritik an simplifizierten Erklärungen des Sprachwandels vor und führt in die Thematik des Sprachwandels ein. Sie beleuchtet die verschiedenen Ebenen des Sprachwandels und die Frage nach den Ursachen und Triebkräften der Sprachentwicklung.
Theorien zum Sprachwandel
Dieses Kapitel präsentiert die wichtigsten Theorien und Begrifflichkeiten des Sprachwandels, darunter die Ansätze von Jacob Grimm, Wilhelm von Humboldt, William D. Whitney, den Junggrammatikern, August Schleicher und Hermann Paul. Es werden die Entwicklung des Sprachbegriffs, die Kontroversen zwischen Stammbaum- und Wellentheorie sowie die Bedeutung des Sprachgebrauchs für den Sprachwandel beleuchtet.
Kellers Theorie von der "unsichtbaren Hand"
Das Kapitel stellt Kellers Theorie des Sprachwandels vor, die auf dem Konzept der "unsichtbaren Hand" basiert. Es werden Kellers Kritik an bestehenden Theorien und seine eigene Sichtweise auf den Sprachwandel, die den Einfluss von sozialen und kulturellen Faktoren betont, erläutert.
Schlüsselwörter
Sprachwandel, Sprachtheorie, "unsichtbare Hand", Sprachgebrauch, soziale Faktoren, kulturelle Faktoren, Konkurrenzmodell, Komplementärmodell, historische Sprachwissenschaft, synchrone Sprachwissenschaft, diachrone Sprachwissenschaft.
- Arbeit zitieren
- Guido Maiwald (Autor:in), 2009, Konkurrenz- oder Komplementärmodell zur Sprachwandeltheorie. Rudi Kellers „Sprachwandel. Von der unsichtbaren Hand in der Sprache“ (1994), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/316714