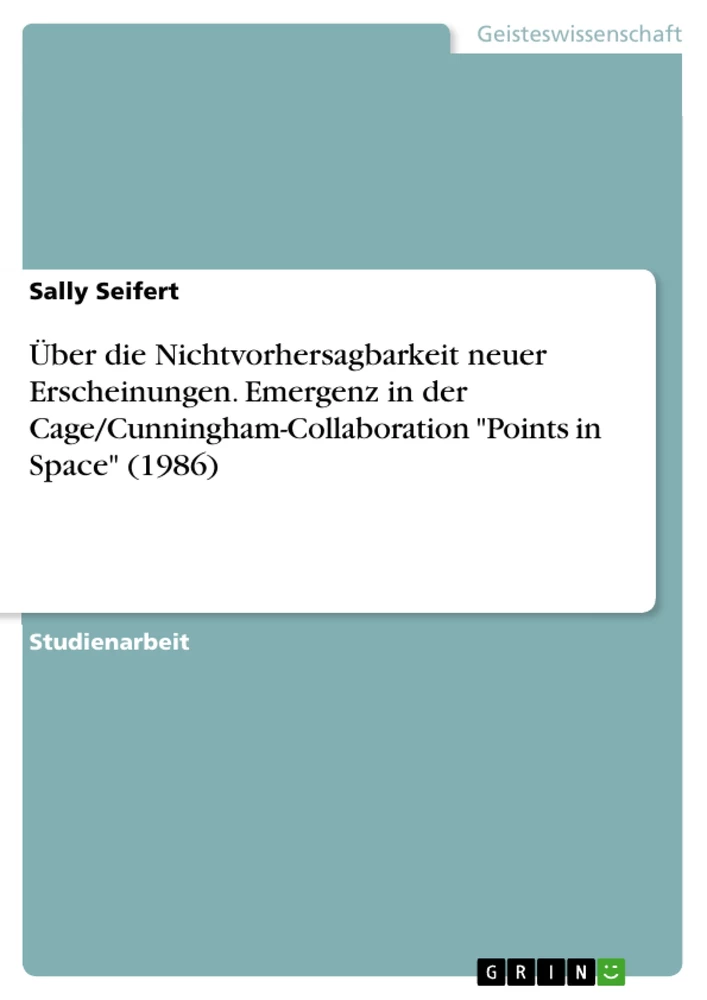Collaboration „meint als englisches Wort [die] Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien, mit dem Zweck etwas Größeres oder wenigstens etwas anderes als die Summe der Einzelteile zu erzielen“. Bei den Einzelteilen der Cage/Cunningham-Collaboration, mit der ich mich im Folgenden beschäftigen möchte, handelt es sich um den Tänzer und Choreographen Merce Cunningham und den Komponisten John Cage, deren jeweilige Einflüsse noch immer in der zeitgenössischen Kunstlandschaft spürbar sind.
So war der am 05. September 1912 geborene John Cage nicht nur ein begeisterter Dichter, Maler, Architekt und Pilzwissenschaftler, sondern durch seine Untersuchung der Stille oder durch Erfindungen wie der des Prepared Pianos zudem einer der Protagonisten der Neuen Musik.
Ferner gehörte der am 16. April 1919 geborene Merce Cunningham zu den Ersten, die sich gegen den expressionistischen Charakter des modernen Tanzes wandten. Indem er das Augenmerk auf die Bewegung an sich verlagerte, prägte er dessen gesamten Werdegang. Von innovativem Charakter war außerdem seine Entwicklung der Cunningham-Technik sowie sein Gebrauch des digitalen Choreographieprogramms Life Forms.
Und doch erzielte die Zusammenarbeit der beiden Avantgardisten, die 1936 an der Cornish School of the Arts in Seattle, Washington, begann, etwas noch Größeres als die Summe dieser separaten Leistungen. Ein Beispiel hierfür ist die Entstehung völlig neuer Kunstformen, wie der des Happening oder der Minimal Art. Zwei vermutlich noch wichtigere Resultate sind die durch Cage und Cunningham etablierte Independenz und Interdependenz verschiedener Künste und der bewusste Einsatz des Zufalls während der Produktion ihrer Stücke.
Dieser bereits im Begriff der Collaboration präsenten Emergenz möchte ich mich nun widmen. Dabei soll der Fragestellung nachgegangen werden, wie genau sie sich durch die sehr vielschichtige Zusammenarbeit der beiden Avantgardisten zieht. Nach einer einführenden Klärung der Begrifflichkeiten, setze ich daher bei den ästhetischen Voraussetzungen für Emergenz innerhalb der Cage/Cunningham-Collaboration an. Die verschiedenen Ebenen des Begriffs werden anschließend auch an einem praktischen Beispiel untersucht, wobei der Gegenstand der dafür erforderlichen Analyse das Werk Points in Space sein soll.
Besondere Aufmerksamkeit richte ich außerdem auf die Möglichkeiten, die sich aus dem gezielten Einsatz von Emergenz in Bezug auf den Zuschauer ergeben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Themenspezifische Definition des Emergenzbegriffs
3. Ästhetische Voraussetzungen für Emergenz innerhalb der Cage/Cunningham-Collaboration
3.1 Independenz der Künste
3.2 Interdependenz der Künste
4. Emergenz am Beispiel von Points in Space
5. Fazit
6. Bibliographie
7. Filmographie
8. Anhang
-
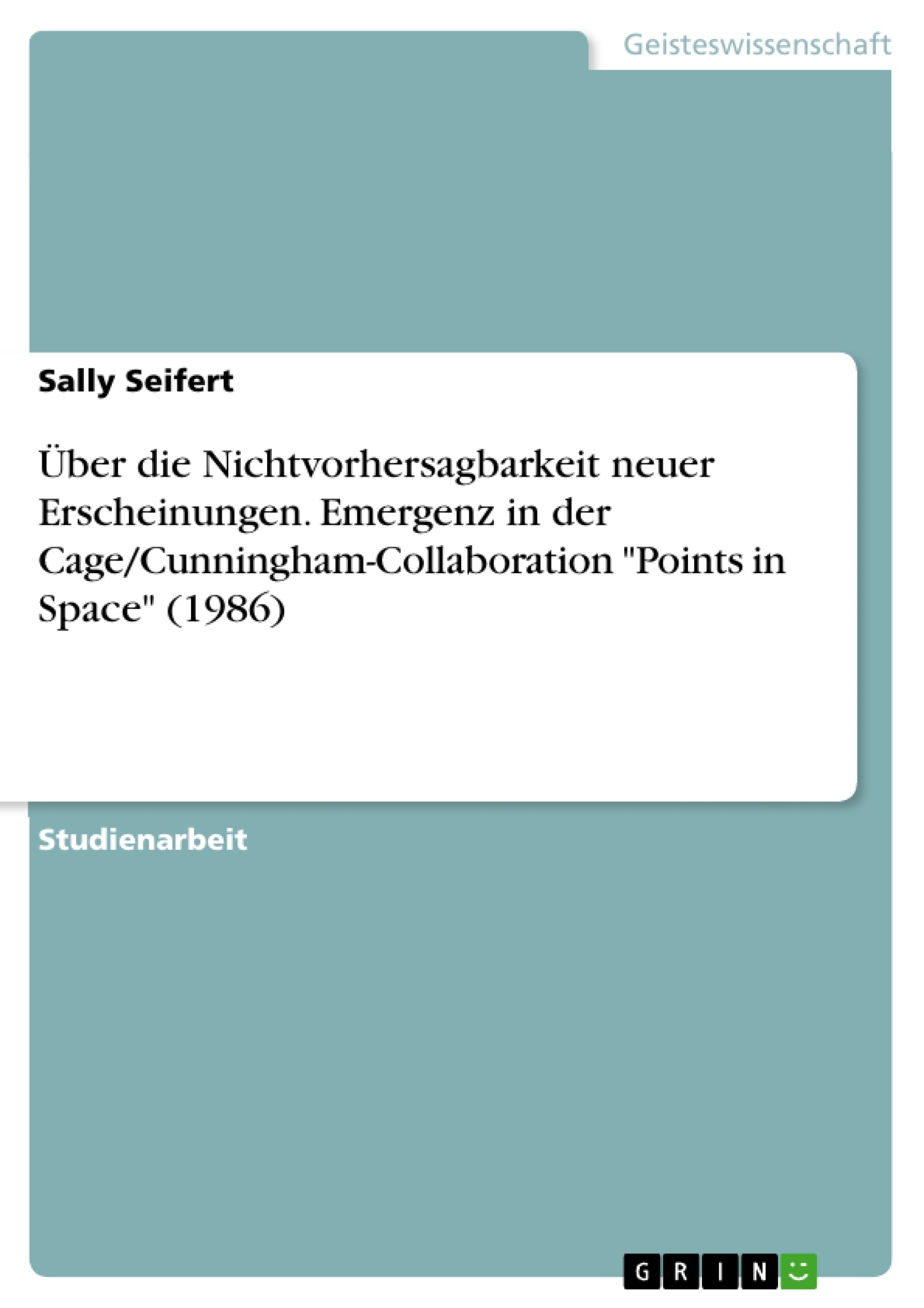
-

-

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen. -

-
Laden Sie Ihre eigenen Arbeiten hoch! Geld verdienen und iPhone X gewinnen.