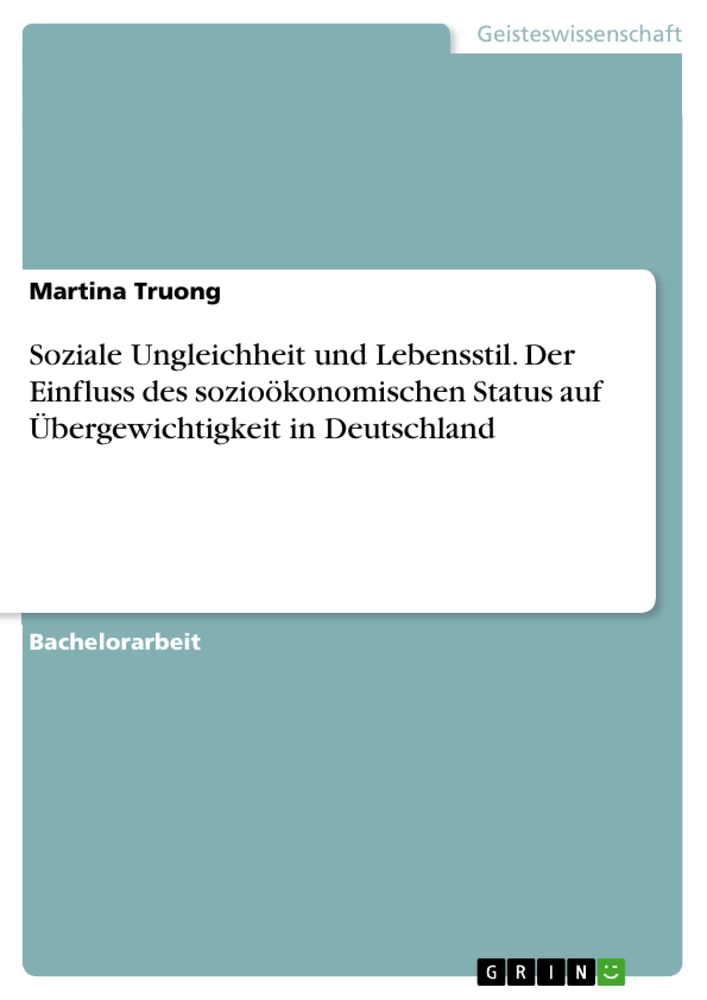Der große Anteil an übergewichtigen Personen in Deutschland stellt seit Jahren ein gesellschaftliches Problem dar und lässt sowohl die Gesundheits- als auch die Sozialwissenschaften
nach möglichen Kausalbeziehungen suchen, die oftmals in sozioökonomischen Rangordnungen zu finden sind. Ziel vorliegender Bachelorarbeit ist, den Einfluss des sozioökonomischen Status auf das Übergewicht darzustellen.
Es wird davon ausgegangen, dass dieser Einfluss über einen gesunden bzw. ungesunden Lebensstil als Intervention vermittelt wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Menschen mit höherem sozioökonomischen Status seltener an Übergewicht erkranken und dieser Effekt über die sportliche Aktivität vermittelt wird.
Über die Annahme, dass sozioökonomisch höher Gestellte wegen einer gesünderen Ernährung seltener übergewichtig sind, kann aufgrund unzureichender Daten keine Aussage
getroffen werden. Somit geben diese Befunde erste Einblicke in den Zusammenhang zwischen dem Status und dem Körpergewicht sowie Denkanstöße für weitere Untersuchungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund und Hypothesen
- Forschungsstand
- Die soziale Ungleichheit und der sozioökonomische Status
- Lebensstile als Vermittler der sozialen Ungleichheit
- Der Einfluss des SES auf die Ernährung
- Der Einfluss des SES auf die sportliche Aktivität
- Daten und Methoden
- Beschreibung des ALLBUS 2004
- Operationalisierung
- Probleme
- Methoden
- Ergebnisse
- Deskriptive Statistik
- Bivariate und multivariate Analysen
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss des sozioökonomischen Status auf das Übergewicht in Deutschland. Sie geht davon aus, dass dieser Einfluss über einen gesunden bzw. ungesunden Lebensstil vermittelt wird. Die Arbeit analysiert den Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Übergewicht und untersucht, inwiefern der Lebensstil eine Rolle spielt.
- Sozioökonomische Ungleichheit und Übergewicht
- Einfluss des Lebensstils auf das Körpergewicht
- Rolle der Ernährung und sportlichen Aktivität
- Analyse von Daten der ALLBUS-Studie
- Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status, Lebensstil und Übergewicht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Problem des Übergewichts in Deutschland dar und führt die Forschungsfrage ein. Das zweite Kapitel beleuchtet den theoretischen Hintergrund, den aktuellen Forschungsstand und die Hypothesen. Es werden Theorien der sozialen Ungleichheit und Lebensstile sowie der Einfluss des sozioökonomischen Status auf Ernährung und sportliche Aktivität betrachtet. Kapitel drei beschreibt die verwendeten Daten und Methoden, inklusive der Operationalisierung und der Herausforderungen der Untersuchung. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse präsentiert, einschließlich der deskriptiven Statistik und der bivariaten und multivariaten Analysen. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion und einem Fazit.
Schlüsselwörter
Sozioökonomischer Status, Übergewicht, Lebensstil, Ernährung, Sportliche Aktivität, ALLBUS, Soziale Ungleichheit, Gesundheit, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen sozioökonomischer Status und Übergewicht zusammen?
Studien zeigen, dass Menschen mit einem niedrigeren sozioökonomischen Status (SES) in Deutschland häufiger an Übergewicht leiden. Dies liegt oft an Unterschieden im Lebensstil, wie Ernährung und Bewegung.
Welche Rolle spielt der Lebensstil als Vermittler?
Der SES beeinflusst das Körpergewicht nicht direkt, sondern über "Interventionsvariablen" wie sportliche Aktivität und Ernährungsgewohnheiten. Ein gesunder Lebensstil ist bei höheren Statusgruppen statistisch häufiger anzutreffen.
Warum treiben Menschen mit höherem Status häufiger Sport?
Gründe können bessere zeitliche Ressourcen, ein höheres Gesundheitsbewusstsein oder der soziale Druck innerhalb der Statusgruppe sein. Sport fungiert hier oft als Teil eines prestigeträchtigen Lebensstils.
Was ist der ALLBUS und welche Rolle spielt er in dieser Untersuchung?
Der ALLBUS (Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften) liefert repräsentative Daten über die deutsche Bevölkerung. Die Arbeit nutzt Daten aus dem Jahr 2004, um statistische Zusammenhänge zwischen Status und Gewicht zu belegen.
Gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Einkommen und Ernährung?
Obwohl oft angenommen wird, dass ein höheres Einkommen zu gesünderer Ernährung führt, ist die Datenlage hierzu komplexer. Bildung und Wissen über gesunde Lebensmittel scheinen oft einflussreicher zu sein als das reine Einkommen.
Welche soziologischen Theorien erklären diese Ungleichheit?
Theorien zur sozialen Ungleichheit und zu Lebensstilen (z. B. nach Bourdieu) erklären, wie soziale Schichten ihre Identität auch über den Körper und Gesundheitsverhalten definieren und abgrenzen.
- Quote paper
- Martina Truong (Author), 2015, Soziale Ungleichheit und Lebensstil. Der Einfluss des sozioökonomischen Status auf Übergewichtigkeit in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317268