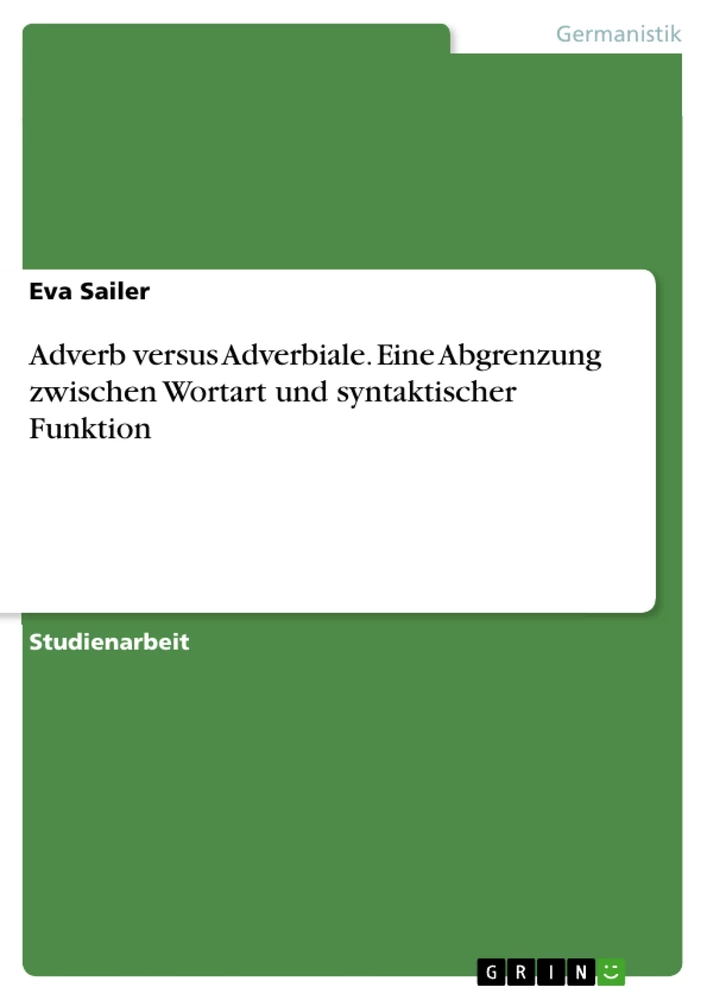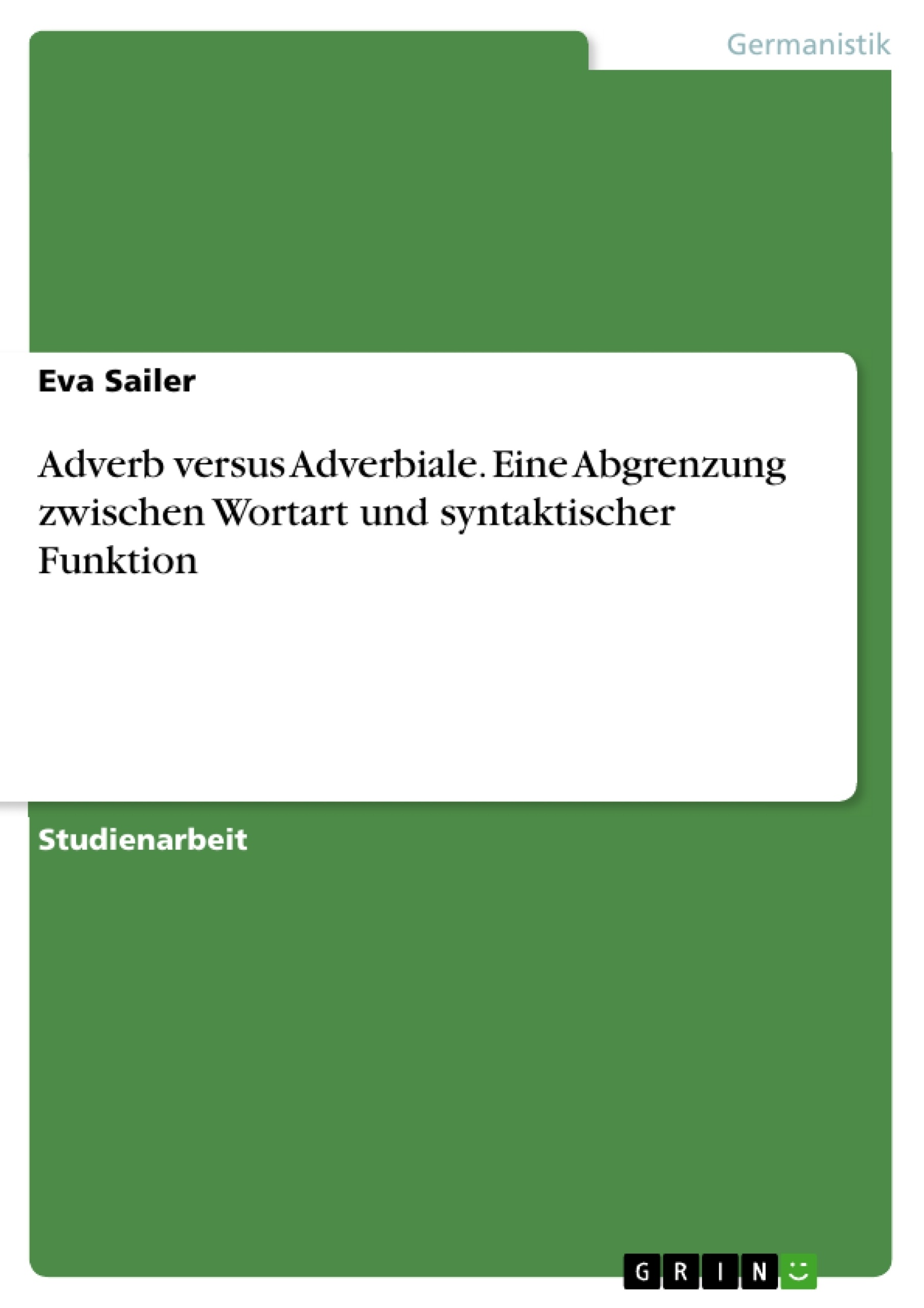Eine eindeutige Definition der Wortart Adverb beziehungsweise eine klare Aufstellung ihres Gebrauchs ist mit Schwierigkeiten verbunden. Am Beispiel Adverb – Adverbiale soll in der vorliegenden Arbeit diesem Problem auf den Grund gegangen werden. Zu Beginn wird die Wortart Adverb dargestellt, um anschließend der syntaktischen Funktion Adverbiale gegenübergestellt werden zu können. Darauffolgend soll versucht werden, eine möglichst genaue Unterscheidung zwischen Adverb und Adverbiale herauszuarbeiten.
Versucht man, die Wortart Adverb innerhalb des deutschen Sprachgebrauchs einzuordnen, stößt man bereits zu Beginn auf einige Unstimmigkeiten und Schwierigkeiten. Ursachen dieser Ungereimtheiten sind unter anderem die Unterscheidung zwischen Adverb und Adjektiv innerhalb der Einteilung der Wortarten, aber auch die Abgrenzung zwischen dem Adverb als Wortart und der Adverbiale als syntaktischer Funktion kann hier als Beispiel genannt werden. Hierbei handelt es sich zwar um zwei grundsätzlich verschiedene Ebenen – Wortart und syntaktische Funktion –, jedoch weist die Verwechslung von Adverb und adverbialer Bestimmung auf das vorliegende Problem einer mangelnden Trennung hin.
Schon aufgrund der Wortähnlichkeit führt es im deutschen Sprachgebrauch und auch in der deutschen Grammatik oftmals zu Verwechslungen oder gar Identitätsverlusten, so dass der Plural von Adverb gerne mit dem Plural der adverbialen Bestimmung – Adverbiale – gleichgesetzt wird. Gleichzeitig darf man aber nicht außer Acht lassen, dass syntaktische Kriterien oftmals eine bedeutende Rolle bei der Klassifikation von Wortarten spielen und somit nicht gänzlich getrennt, sondern mehr ergänzend betrachtet werden müssen. Wortarten begründen sich oftmals auf spezielle syntaktische Funktionen und können sich erst durch sie als eigenständige Kategorie beweisen und eindeutig bestimmt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Adverb versus Adverbiale – Probleme der Unterscheidung
- 2. Das Adverb – eine Wortart
- 2.1 Definition
- 2.2 Einordnung
- 2.3 Sonderformen und Schwierigkeiten
- 3. Die Adverbiale – eine syntaktische Funktion
- 3.1 Definition
- 3.2 Einteilung
- 4. Unterscheidung zwischen Wortart Adverb und syntaktischer Funktion Adverbiale
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Unterscheidung zwischen Adverb als Wortart und Adverbiale als syntaktische Funktion im Deutschen. Sie analysiert die Schwierigkeiten, die eine eindeutige Abgrenzung dieser beiden Kategorien bereitet, und beleuchtet die unterschiedlichen Definitionen und Einordnungen in der deutschsprachigen Grammatik.
- Probleme bei der Definition und Abgrenzung von Adverb und Adverbiale
- Unterschiede in der Behandlung von Adverbien in verschiedenen Grammatiken
- Analyse der syntaktischen und morphologischen Kriterien zur Klassifizierung von Adverbien
- Gegenüberstellung der Wortart Adverb und der syntaktischen Funktion Adverbiale
- Zusammenfassende Betrachtung der Unterscheidungskriterien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Adverb versus Adverbiale – Probleme der Unterscheidung: Das Kapitel beginnt mit einem Zitat, das die Schwierigkeiten bei der Definition des Adverbs hervorhebt. Es wird die Problematik der Abgrenzung zwischen Adverb als Wortart und Adverbiale als syntaktische Funktion thematisiert. Die Ähnlichkeit der Begriffe führt zu Verwechslungen und Identitätsverlusten. Syntaktische Kriterien spielen eine wichtige Rolle bei der Klassifizierung von Wortarten und sollten nicht vernachlässigt werden. Die Arbeit kündigt an, sich mit dem Problem der Unterscheidung zwischen Adverb und Adverbiale auseinanderzusetzen, indem sie zunächst das Adverb darstellt, um es anschließend der Adverbiale gegenüberzustellen und eine genaue Unterscheidung herauszuarbeiten.
2. Das Adverb – eine Wortart: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, eine eindeutige Definition des Adverbs zu liefern. Es werden unterschiedliche Definitionen aus verschiedenen Grammatiken (Duden, Handbuch der deutschen Wortarten, Metzler Lexikon Sprache) vorgestellt, die jeweils unterschiedliche Kriterien (morphologische und syntaktische) betonen. Die heterogene Natur des Adverbs als Unterkategorie unflektierbarer Wortarten wird hervorgehoben und anhand eines Wortartenbaums verdeutlicht. Die Bedeutung der syntaktischen Funktion bei der Klassifizierung von Adverbien wird betont, wobei das Hauptaugenmerk auf der jeweiligen Funktion des Wortes liegt. Ein Beispiel veranschaulicht die Fähigkeit von Adverbien, andere Adverbien zu modifizieren.
Schlüsselwörter
Adverb, Adverbiale, Wortart, syntaktische Funktion, Grammatik, Definition, Klassifizierung, deutsche Sprache, morphologische Kriterien, syntaktische Kriterien, Wortartenbaum.
FAQ: Adverb versus Adverbiale – Probleme der Unterscheidung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Unterscheidung zwischen Adverb als Wortart und Adverbiale als syntaktische Funktion im Deutschen. Sie analysiert die Schwierigkeiten bei der eindeutigen Abgrenzung beider Kategorien und beleuchtet unterschiedliche Definitionen und Einordnungen in der deutschsprachigen Grammatik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Probleme bei der Definition und Abgrenzung von Adverb und Adverbiale, Unterschiede in der Behandlung von Adverbien in verschiedenen Grammatiken, die Analyse syntaktischer und morphologischer Kriterien zur Klassifizierung von Adverbien, die Gegenüberstellung von Wortart Adverb und syntaktischer Funktion Adverbiale sowie eine zusammenfassende Betrachtung der Unterscheidungskriterien.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Adverb versus Adverbiale – Probleme der Unterscheidung; 2. Das Adverb – eine Wortart (mit Unterkapiteln zur Definition, Einordnung und Sonderformen); 3. Die Adverbiale – eine syntaktische Funktion (mit Unterkapiteln zur Definition und Einteilung); 4. Unterscheidung zwischen Wortart Adverb und syntaktischer Funktion Adverbiale; 5. Zusammenfassung.
Welche Schwierigkeiten werden bei der Unterscheidung von Adverb und Adverbiale hervorgehoben?
Die Ähnlichkeit der Begriffe führt zu Verwechslungen und Identitätsverlusten. Die Abgrenzung ist schwierig, da syntaktische Kriterien eine wichtige Rolle spielen und nicht vernachlässigt werden dürfen. Unterschiedliche Grammatiken betonen verschiedene Kriterien (morphologische und syntaktische) bei der Definition des Adverbs, was die Unterscheidung zusätzlich erschwert.
Welche Grammatiken werden herangezogen?
Die Arbeit bezieht sich auf verschiedene Grammatiken, darunter der Duden und das Handbuch der deutschen Wortarten sowie das Metzler Lexikon Sprache. Diese werden verglichen, um die unterschiedlichen Definitionen und Einordnungen von Adverbien aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt die syntaktische Funktion?
Die syntaktische Funktion spielt eine entscheidende Rolle bei der Klassifizierung von Adverbien. Das Hauptaugenmerk liegt auf der jeweiligen Funktion des Wortes im Satz. Syntaktische Kriterien sind unerlässlich für eine klare Unterscheidung zwischen Adverb und Adverbiale.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Adverb, Adverbiale, Wortart, syntaktische Funktion, Grammatik, Definition, Klassifizierung, deutsche Sprache, morphologische Kriterien, syntaktische Kriterien, Wortartenbaum.
Wo finde ich eine Zusammenfassung der Kapitel?
Die HTML-Datei enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel, die die wichtigsten Punkte und Argumentationslinien jedes Kapitels darstellt.
- Quote paper
- Eva Sailer (Author), 2012, Adverb versus Adverbiale. Eine Abgrenzung zwischen Wortart und syntaktischer Funktion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317458