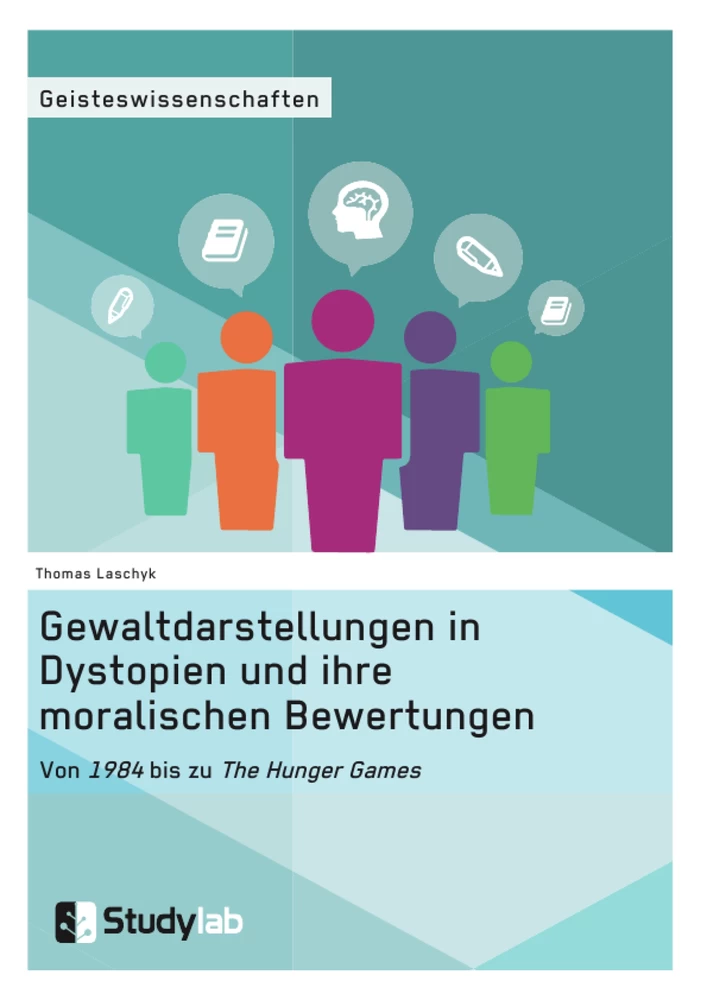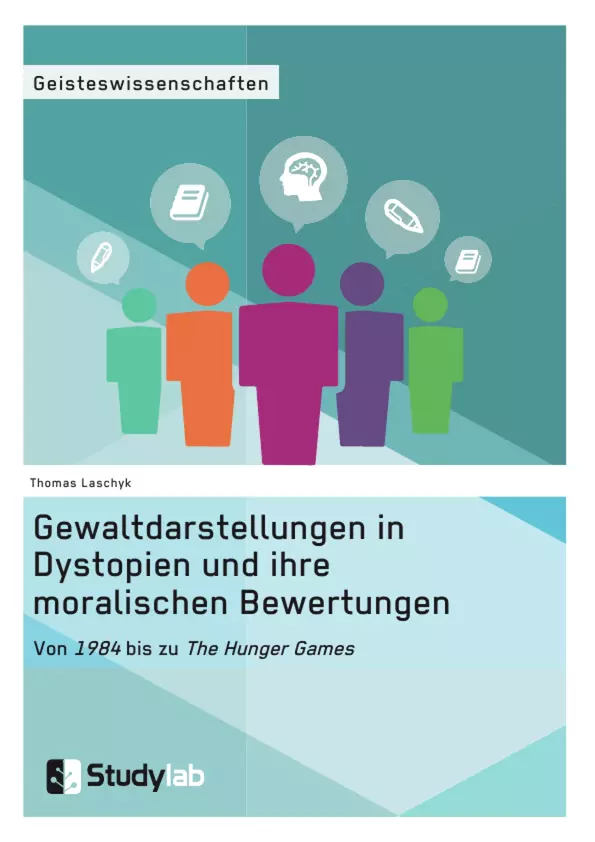In dieser Arbeit werden die "kanonischen Dystopien" "1984" von George Orwell und "Wir" von Jewgeni Samjatin mit einem der kürzlich erschienenen dystopischen Werke, "The Hunger Games" von Suzsanne Collins in ihren Gewaltdarstellungen und deren moralischen Bewertungen verglichen, um etwaige Unterschiede und ihre Implikationen für den Wandel von Bewertung von Gewalt in der Gesellschaft festzustellen.
Dazu wird zunächst der Begriff der Dystopie von anderen, verwandten Begriffen abgegrenzt, um anschließend auf die genaue Differenzierung des Gewaltbegriffs und die Ästhetisierung von Gewalt einzugehen. Danach werden an den betreffenden Werken die unterschiedlichsten Ausprägungen und Formen von Gewalt untersucht und miteinander verglichen. Anschließend werden die Ergebnisse im Kontext der gesellschaftlichen Bewertungen von Gewalt interpretiert.
Aus dem Inhalt:
– Die soziologische Debatte über die menschliche Gewalt
– Gewaltdarstellung in Dystopien und ihre moralische Bewertungen
– Definition und Abgrenzung des Begriffs „Dystopie“
– Definition von Gewalt und Gewaltästhetik
– Arten von Gewalt und Gewaltdarstellung
Die Geschichte der Gewaltdarstellungen in der Literatur lässt sich so weit zurück verfolgen, dass man nicht einmal mehr sagen könnte, welches Phänomen das erste war: "Die Gewalt oder das Sprechen über Gewalt?". Im Gegensatz zu real verübter Gewalt ist es jedoch unsinnig, lediglich die Anzahl an Gewaltdarstellungen zahlenmäßig gegeneinander aufzuwiegen, um so Schlüsse auf die etwaige Veränderung der menschlichen Natur ziehen zu können. Viel entscheidender ist die bewusste, wie auch unbewusste, textimmanente Bewertung der dargestellten Gewalt und ihre zeitgenössische und gegenwärtige Interpretation.
Für diesen besonderen Analysepunkt eignen sich aufgrund ihrer strukturellen Besonderheiten und außerfiktionalen Intentionen die Dystopien, die eben genau diesem Anspruch entsprechen. Diese "spiegeln und extrapolieren geistige Strömungen und Denkweisen, sozio-politische Ereignisse, Entwicklungen und Tendenzen [...], die die zeitgenössische außerliterarische Gegenwart in eine diesen fiktiven Gesellschaftsentwürfen ähnliche Zukunft verwandeln könnten."
Inhaltsverzeichnis
- I. Die soziologische Debatte über die menschliche Gewalt.
- II. Gewaltdarstellung in Dystopien und ihre moralischen Bewertungen
- 1. Definition und Abgrenzung des Begriffs "Dystopie".
- 1.1. Historischer Utopie-Begriff..
- 1.2. Andere Gattungsbezeichnungen .....
- 1.3. Merkmale der Dystopie...
- 2. Defintion von Gewalt und Gewaltästhetik.
- 2.1. Das Verhältnis von Macht, Zwang und Gewalt ..
- 2.2. Darstellungen von Gewalt und Ästhetisierungen ......
- 3. Arten von Gewalt und Gewaltdarstellungen
- 3.1. Physische und psychische Gewalt..
- 3.2. Staatsgewalt..
- 3.3. Gegengewalt...
- 4. Fazit
- 1. Definition und Abgrenzung des Begriffs "Dystopie".
- III. Der Triumph der humanistischen Tradition
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Darstellung von Gewalt in dystopischen Werken und deren moralischen Bewertungen. Sie analysiert die soziologische Debatte über die menschliche Gewalt und untersucht, ob Gewalt und Gewalttätigkeit noch zeitgemäß sind.
- Definition und Merkmale von Dystopien
- Darstellung von Gewalt und Gewaltästhetik in dystopischen Werken
- Arten von Gewalt und Gewaltdarstellungen
- Moralische Bewertungen von Gewaltdarstellungen in Dystopien
- Der Einfluss von Gewalt auf die menschliche Natur
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die soziologische Debatte über die menschliche Gewalt und stellt aktuelle Forschungsarbeiten zum Thema vor. Es werden verschiedene Theorien und Perspektiven auf die Entstehung und Entwicklung von Gewalt in der Geschichte beleuchtet.
Das zweite Kapitel widmet sich der Definition und Abgrenzung des Begriffs "Dystopie" und analysiert die Merkmale dieser literarischen Gattung. Es werden verschiedene Arten von Gewalt und Gewaltdarstellungen in Dystopien untersucht, wobei der Fokus auf den Aspekt der Gewaltästhetik liegt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Triumph der humanistischen Tradition. Hier werden die Auswirkungen von Gewalt auf die menschliche Natur und die Möglichkeiten einer gewaltfreien Gesellschaft diskutiert.
Schlüsselwörter
Dystopie, Gewalt, Gewaltästhetik, Moral, Humanismus, Soziologie, Literatur, Literaturanalyse, Gewaltforschung.
Häufig gestellte Fragen
Welche dystopischen Werke werden in der Arbeit verglichen?
Verglichen werden die Klassiker „1984“ (Orwell) und „Wir“ (Samjatin) mit dem modernen Werk „The Hunger Games“ (Collins).
Was ist der Unterschied zwischen physischer und psychischer Gewalt in Dystopien?
Physische Gewalt umfasst direkte körperliche Misshandlung, während psychische Gewalt Manipulation, Überwachung und die Zerstörung der Individualität beschreibt.
Was versteht man unter der Ästhetisierung von Gewalt?
Dies beschreibt die bewusste literarische Darstellung von Gewalt, die über die bloße Handlung hinausgeht und moralische oder gesellschaftskritische Implikationen hat.
Wie bewertet die Gesellschaft Gewalt in der Literatur?
Die Arbeit untersucht, wie sich die moralische Bewertung von Gewalt über die Jahrzehnte gewandelt hat und was dies für unser heutiges Verständnis von Humanismus bedeutet.
Welche Funktion hat Staatsgewalt in diesen Romanen?
Staatsgewalt dient in Dystopien dazu, die totale Kontrolle über die Bevölkerung zu sichern und jeglichen Widerstand im Keim zu ersticken.
- Quote paper
- Thomas Laschyk (Author), 2015, Gewaltdarstellungen in Dystopien und ihre moralischen Bewertungen. Von "1984" bis zu "The Hunger Games", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/317474