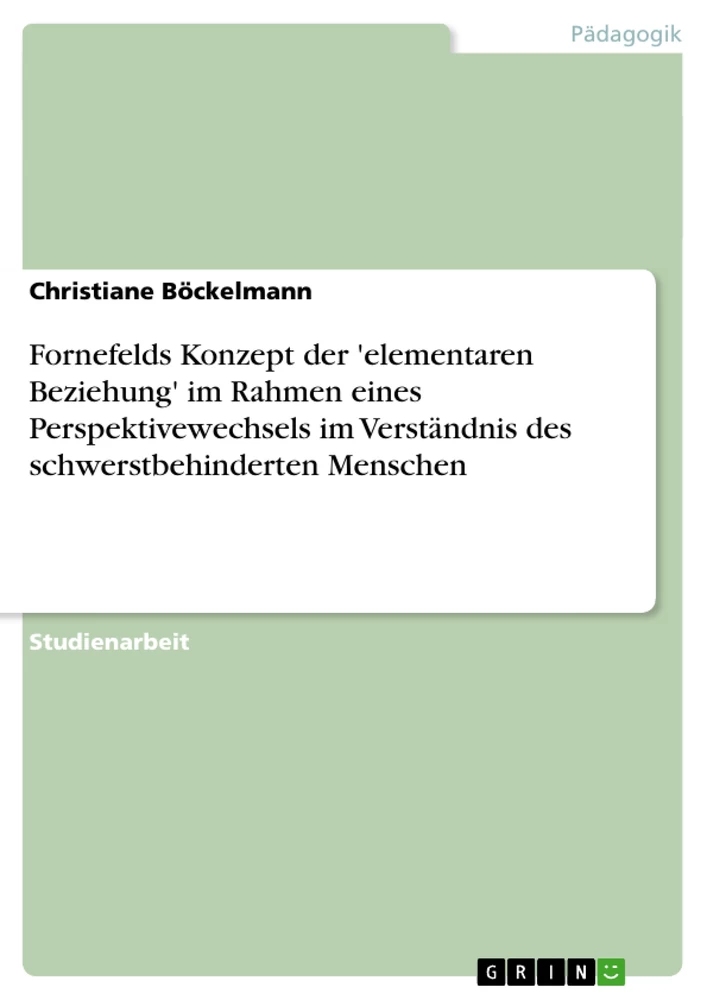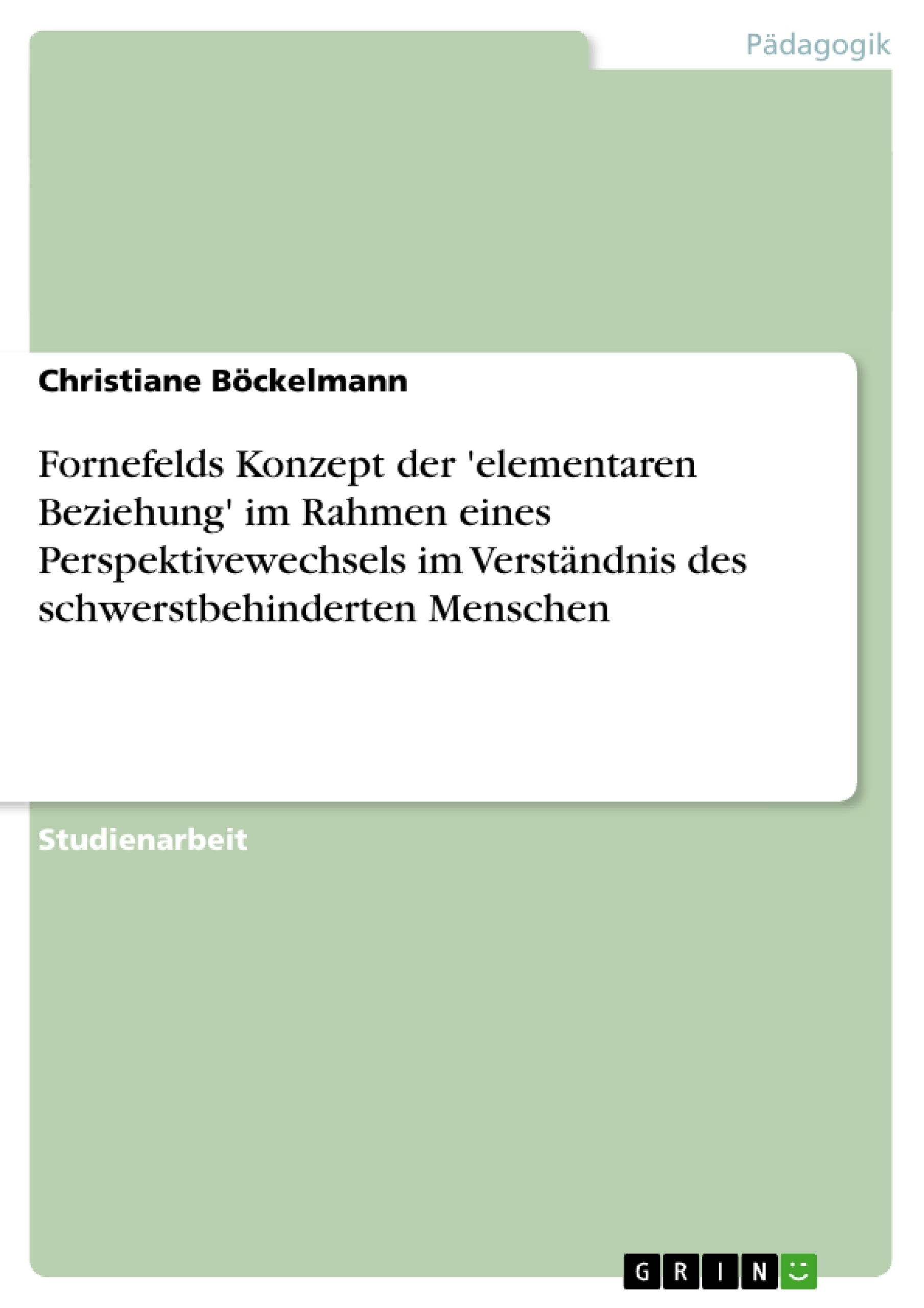„Scheu, Abscheu, Ekel und Hilflosigkeit – wir hatten es mit Menschen zu tun, die sich schlugen, kratzten, bissen, die laut schrien, ungewöhnliche Bewegungen machten, die unangenehm riechen, denen der Speichel aus dem Mund lief, die verkrüppelte Körper hatten. Wir merkten sehr bald, dass wir keine Verhaltensmuster hatten, mit denen wir auf diese Kinder hätten reagieren können“ (Pfeffer 1988; 127)
Am ersten Tag meines Blockpraktikums in einer Schule für Geistigbehinderte erfuhr ich, dass in meiner Praktikumsklasse auch ein schwerstbehindertes Mädchen sein sollte. Da ich unmittelbar noch nie mit Schwerstbehinderten zu tun gehabt hatte, war ich sehr gespannt auf diese Erfahrung. Julia ist ein 15 jähriges Mädchen, das nur den Kopf bewegen kann. Ihr Kopf wirkte im Verhältnis zu ihrem schmächtigen Körper übergroß, ihre Augen rollten hin und her, sie schien weder mich noch irgend jemanden anders anzublicken. Ihr Mund stand offen und sie speichelte. Ich glaube, ich habe in meinen ersten Praktikumstagen zum ersten Mal einen behinderten Menschen, mit dem ich nahe zu tun hatte, nur von außen betrachtet. Julia war die ersten Tage für mich das Bild eines schwerstbehinderten Menschen und ich fühlte mich schlecht, weil ich nicht mehr empfand, weil ich keinen Bezug zu ihr fand, ihr nicht begegnen konnte.
Diese beiden Beispiele für Erstbegegnungen mit schwerstbehinderten Menschen zeigen, wie sich das, was sie von uns unterscheidet, übermächtig in den Vordergrund drängt, so dass ihr Anderssein als Fremdheit empfunden wird, das Unsicherheit und Ablehnung, sogar Ekel hervorruft. Das Verhalten des schwerstbehinderten Menschen entspricht nicht unseren Erfahrungen und Normen, die wir in bezug auf den Mitmenschen haben. Wir finden daher keine Möglichkeit, ihm zu begegnen.
Im Folgenden möchte ich mich mit dieser Fremdheit, die wir empfinden, auseinandersetzen und verdeutlichen, wie unser Umgang mit ihr zu dem führen kann, was Fornefeld als „elementare Beziehungsstörung“ bezeichnet. Daran anschließend werde ich aufzeigen, welche Veränderungen ein Perspektivewechsel in der Betrachtung behinderter Menschen bewirken kann und mit Fornefelds Konzept der „elementaren Beziehung“ eine Möglichkeit beschreiben, zu Menschen mit schwerster Behinderung, insbesondere zu schwerstgeistigbehinderten Schülern im Rahmen eines beziehungsorientierten Unterrichts, einen Zugang zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der behinderte Mensch als der Fremde
- Formen des Umgangs mit der Fremdheit des behinderten Menschen
- Der Begriff der „Beziehung“ und der „elementaren Beziehungsstörung“ bei Fornefeld
- Perspektivewechsel im Verständnis des behinderten Menschen
- Fornefelds Konzept der „,elementaren Beziehung“
- Fornefelds phänomenologische Sicht auf den Menschen
- Struktur und Wirkung der elementaren Beziehung
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit Fornefelds Konzept der „elementaren Beziehung“ und beleuchtet dessen Relevanz im Kontext eines Perspektivewechsels im Verständnis des schwerstbehinderten Menschen. Der Text untersucht die Herausforderungen, die die Fremdheit des schwerstbehinderten Menschen für uns als Nichtbehinderte darstellt und wie diese zu einer „elementaren Beziehungsstörung“ führen können. Ziel ist es, Fornefelds Konzept näher zu erläutern und zu zeigen, wie es einen Zugang zu Menschen mit schwerster Behinderung ermöglicht.
- Die Fremdheit des schwerstbehinderten Menschen
- Fornefelds Konzept der „elementaren Beziehung“
- Perspektivewechsel im Verständnis des behinderten Menschen
- Der Einfluss der „elementaren Beziehung“ auf den Umgang mit schwerstbehinderten Menschen
- Beziehungsorientierter Unterricht im Kontext der „elementaren Beziehung“
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung schildert die Schwierigkeit im Umgang mit schwerstbehinderten Menschen und stellt die Frage nach einem neuen Verständnis. Kapitel 2.1 analysiert die Fremdheit des schwerstbehinderten Menschen und zeigt auf, wie diese zu Angst und Ablehnung führt. Kapitel 2.2 untersucht verschiedene Formen des Umgangs mit dieser Fremdheit und beleuchtet die Grenzen von Enteignung und Aneignung. Die Arbeit widmet sich anschließend dem Begriff der „Beziehung“ und der „elementaren Beziehungsstörung“ nach Fornefeld, bevor sie den Perspektivewechsel im Verständnis des behinderten Menschen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schwerstbehinderung, elementare Beziehung, Perspektivewechsel, Fremdheit, Beziehungsstörung, Fornefeld, Inklusion, Unterricht, Kommunikation, phänomenologische Sicht, Interaktion, Integration, Akzeptanz, Entwicklungsmodelle, therapeutische Intervention.
- Quote paper
- Christiane Böckelmann (Author), 2003, Fornefelds Konzept der 'elementaren Beziehung' im Rahmen eines Perspektivewechsels im Verständnis des schwerstbehinderten Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/31956