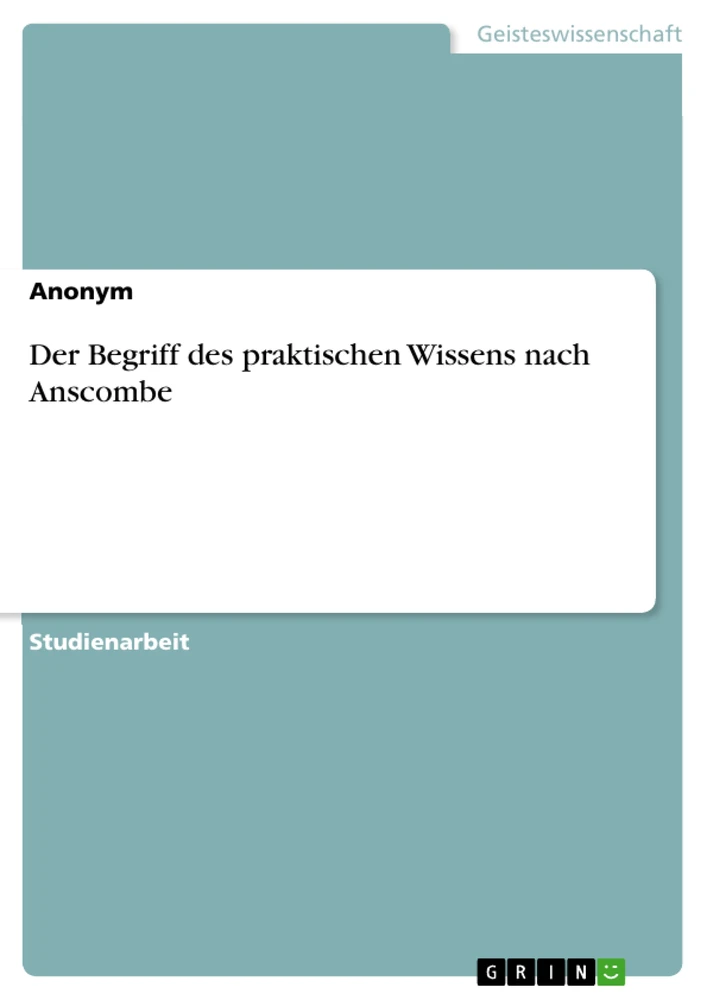Im Folgenden soll die Frage beantwortet werden, was Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe unter dem Begriff des praktischen Wissens versteht. Dabei soll auch geklärt werden, inwiefern (beziehungsweise ob) dieses eine eigenständige, also irreduzible epistemologische Kategorie darstellt und welche Rolle diese Wissensform für das absichtliche Handeln spielt.
Der zuletzt genannte Punkt soll insofern dem tiefergehenden Verständnis dienen, als der Begriff des praktischen Wissens so in seinem funktionalen Zusammenhang betrachtet werden kann. Das heißt, indem man die Rolle analysiert, die dieser Begriff in Anscombes Darstellung einnimmt, lässt sich, so die Idee, besser verstehen, was sie unter praktischem Wissen versteht und warum dieses ihrer Meinung nach nicht auf ein spekulatives oder kontemplatives Wissen zurückgeführt werden kann.
Die in diesem Zusammenhang entscheidende Frage ist also die, warum nach Anscombe das praktische Wissen als eigenständige Wissensform eine notwendige Bedingung für ein absichtliches Handeln darstellt, die absichtliche Handlung also nicht auf die notwendigerweise begleitenden Elemente des spekulativen Wissens reduziert werden kann.
Die Arbeit folgt dabei nachstehendem Aufbau: Zuerst sollen einige Anmerkungen zum Wissensbegriff des späten Wittgenstein erfolgen. Dies ist insofern eine sinnvolle Ausgangsbasis, als Anscombes eigene Position sehr stark durch Wittgensteins Überlegungen geprägt wurde. Anschließend wird Anscombes Begriff des Wissens ohne Beobachtung eingeführt und so die Grundlage des Übergangs zum Begriff des praktischen Wissens geschaffen. Daraufhin wird der Begriff des praktischen Wissens eingeführt und dem des spekulativen Wissens gegenübergestellt. Anschließend wird – vor dem Hintergrund der Frage, inwiefern es sich dabei um eine eigenständige epistemologische Kategorie handelt – die Rolle des praktischen Wissens für das absichtliche Handeln analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Begriff des Wissens bei Anscombe und bei Wittgenstein
- Wissen ohne Beobachtung
- Praktisches und spekulatives Wissen
- Praktisches Wissen als Grundlage des (absichtlichen) Handelns
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Anscombes Verständnis von praktischem Wissen und dessen Rolle im absichtlichen Handeln. Sie klärt, ob es sich um eine eigenständige epistemologische Kategorie handelt und wie es sich zum spekulativen Wissen verhält. Die Arbeit basiert auf Wittgensteins Überlegungen zum Wissensbegriff, da Anscombes Position stark von ihm beeinflusst wurde.
- Anscombes Begriff des praktischen Wissens
- Der Unterschied zwischen praktischem und spekulativem Wissen
- Die Rolle des Wissens im absichtlichen Handeln
- Der Einfluss Wittgensteins auf Anscombes Philosophie
- Wissen ohne Beobachtung als Grundlage des praktischen Wissens
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach Anscombes Verständnis von praktischem Wissen und dessen Rolle für das absichtliche Handeln. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit: Zunächst werden Wittgensteins Überlegungen zum Wissensbegriff behandelt, gefolgt von der Einführung von Anscombes "Wissen ohne Beobachtung" als Grundlage für das Verständnis von praktischem Wissen. Anschließend wird das praktische Wissen dem spekulativen Wissen gegenübergestellt, bevor die Rolle des praktischen Wissens für absichtliches Handeln analysiert wird. Abschließend werden die Ergebnisse zusammengefasst und die Forschungsfrage beantwortet. Der Fokus liegt auf der Klärung, ob praktisches Wissen eine eigenständige epistemologische Kategorie darstellt und warum es nicht auf spekulatives Wissen reduzierbar ist.
Der Begriff des Wissens bei Anscombe und bei Wittgenstein: Dieses Kapitel untersucht Anscombes Handlungstheorie und ihren Versuch, die Ethik auf ein solides Fundament zu stellen. Es wird deutlich, dass Anscombe, im Gegensatz zu früheren Ansätzen, einen privilegierten Zugang zu eigenen Absichten ablehnt, ähnlich wie Wittgenstein, der die Unmöglichkeit einer unfehlbaren Introspektion argumentierte. Das Kapitel betont, dass für Anscombe Wissen nur dort existiert, wo Irrtum möglich ist. Obwohl Anscombe Wittgensteins Auffassung teilt, dass Berichte über eigene mentale Zustände dieses Kriterium nicht erfüllen, unterscheidet sie sich von ihm in der Hinsicht, dass Berichte über eigene Absichten wahr oder falsch sein können. Anscombes Einführung des Begriffs „Wissen ohne Beobachtung“ dient dazu, eine mentalistische Position zu vermeiden, ohne die Existenz eines Geistes zu leugnen.
Wissen ohne Beobachtung: Dieses Kapitel beschreibt Anscombes Begriff des „Wissens ohne Beobachtung“ und dessen enge Beziehung zum praktischen Wissen. Obwohl praktisches Wissen immer Wissen ohne Beobachtung ist, sind die beiden Begriffe nicht deckungsgleich. Anscombe veranschaulicht dies mit Beispielen wie der Kenntnis der Position der eigenen Gliedmaßen. Das entscheidende Kriterium für Wissen ohne Beobachtung ist die Abwesenheit separat beschreibbarer Empfindungen. Der Vergleich mit dem Empfinden beim Fahrstuhlfahren veranschaulicht diesen Unterschied: während das Fahrstuhlgefühl in anderen Kontexten auftreten kann, ist die Empfindung einer Reflexbewegung untrennbar mit der Bewegung selbst verbunden und daher nicht missdeutbar. Dieses Kapitel legt die Grundlage für das Verständnis des praktischen Wissens, indem es die Besonderheit des Wissens ohne Beobachtung herausarbeitet.
Schlüsselwörter
Praktisches Wissen, Spekulatives Wissen, Anscombe, Wittgenstein, Handlungstheorie, Intention, Wissen ohne Beobachtung, epistemologische Kategorie, absichtliches Handeln, Introspektion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Anscombes Praktisches Wissen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht Anscombes Verständnis von praktischem Wissen und dessen Rolle im absichtlichen Handeln. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob es sich um eine eigenständige epistemologische Kategorie handelt und wie es sich zum spekulativen Wissen verhält. Wittgensteins Einfluss auf Anscombes Position spielt dabei eine entscheidende Rolle.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Anscombes Begriff des praktischen Wissens, den Unterschied zwischen praktischem und spekulativem Wissen, die Rolle des Wissens im absichtlichen Handeln, den Einfluss Wittgensteins auf Anscombes Philosophie und "Wissen ohne Beobachtung" als Grundlage des praktischen Wissens.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgt die Auseinandersetzung mit Wittgensteins und Anscombes Wissensbegriff, die Erklärung von "Wissen ohne Beobachtung", ein Vergleich von praktischem und spekulativem Wissen, die Analyse der Rolle des praktischen Wissens im absichtlichen Handeln und schließlich ein Fazit mit der Beantwortung der Forschungsfrage.
Was ist Anscombes "Wissen ohne Beobachtung"?
Anscombes "Wissen ohne Beobachtung" beschreibt eine Art von Wissen, das nicht auf separaten, beschreibbaren Empfindungen beruht. Es ist eng mit praktischem Wissen verbunden, aber nicht deckungsgleich. Beispiele hierfür sind die Kenntnis der Position der eigenen Gliedmaßen oder die Empfindung einer Reflexbewegung. Das Wissen ist untrennbar mit der Handlung selbst verbunden und nicht missdeutbar.
Wie unterscheidet sich praktisches von spekulativem Wissen bei Anscombe?
Die Arbeit untersucht den Unterschied zwischen praktischem und spekulativem Wissen im Detail. Ein zentrales Thema ist die Frage, ob praktisches Wissen eine eigenständige epistemologische Kategorie darstellt und warum es nicht auf spekulatives Wissen reduzierbar ist. Diese Unterscheidung wird anhand von Anscombes Theorie und im Kontext von Wittgensteins Philosophie erläutert.
Welche Rolle spielt Wittgenstein in dieser Arbeit?
Wittgensteins Überlegungen zum Wissensbegriff bilden die Grundlage der Arbeit, da Anscombes Position stark von ihm beeinflusst wurde. Die Arbeit vergleicht die Positionen beider Philosophen und untersucht, wie Wittgensteins Ideen Anscombes Verständnis von praktischem Wissen prägen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Praktisches Wissen, Spekulatives Wissen, Anscombe, Wittgenstein, Handlungstheorie, Intention, Wissen ohne Beobachtung, epistemologische Kategorie, absichtliches Handeln, Introspektion.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Forschungsfrage, ob praktisches Wissen eine eigenständige epistemologische Kategorie darstellt und warum es nicht auf spekulatives Wissen reduzierbar ist. Die genaue Antwort wird in der vollständigen Arbeit dargelegt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Der Begriff des praktischen Wissens nach Anscombe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319671