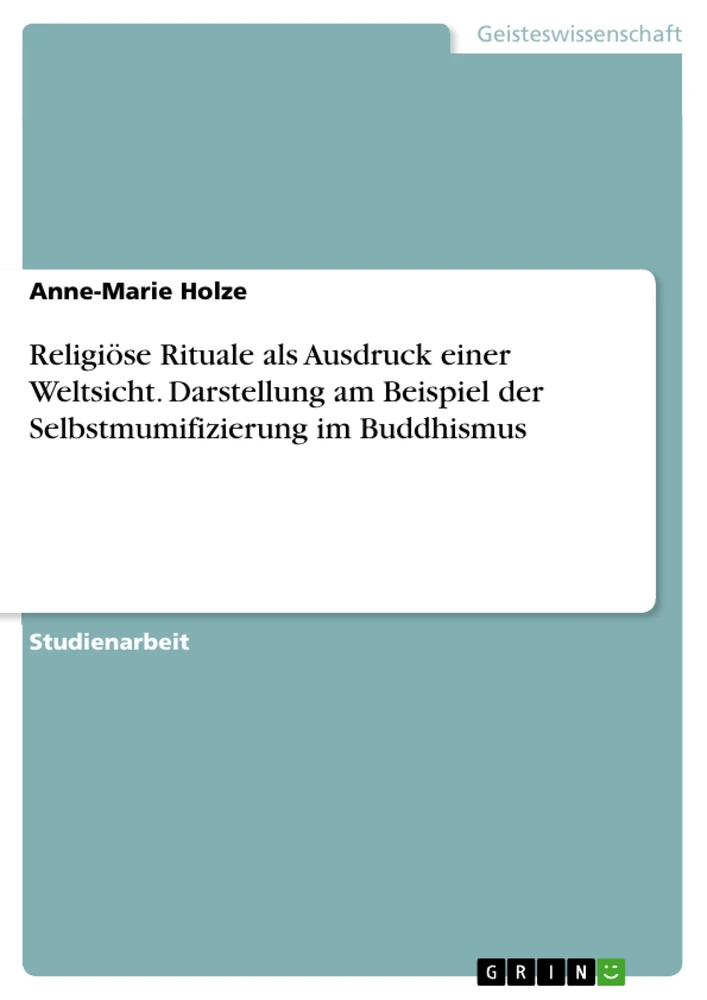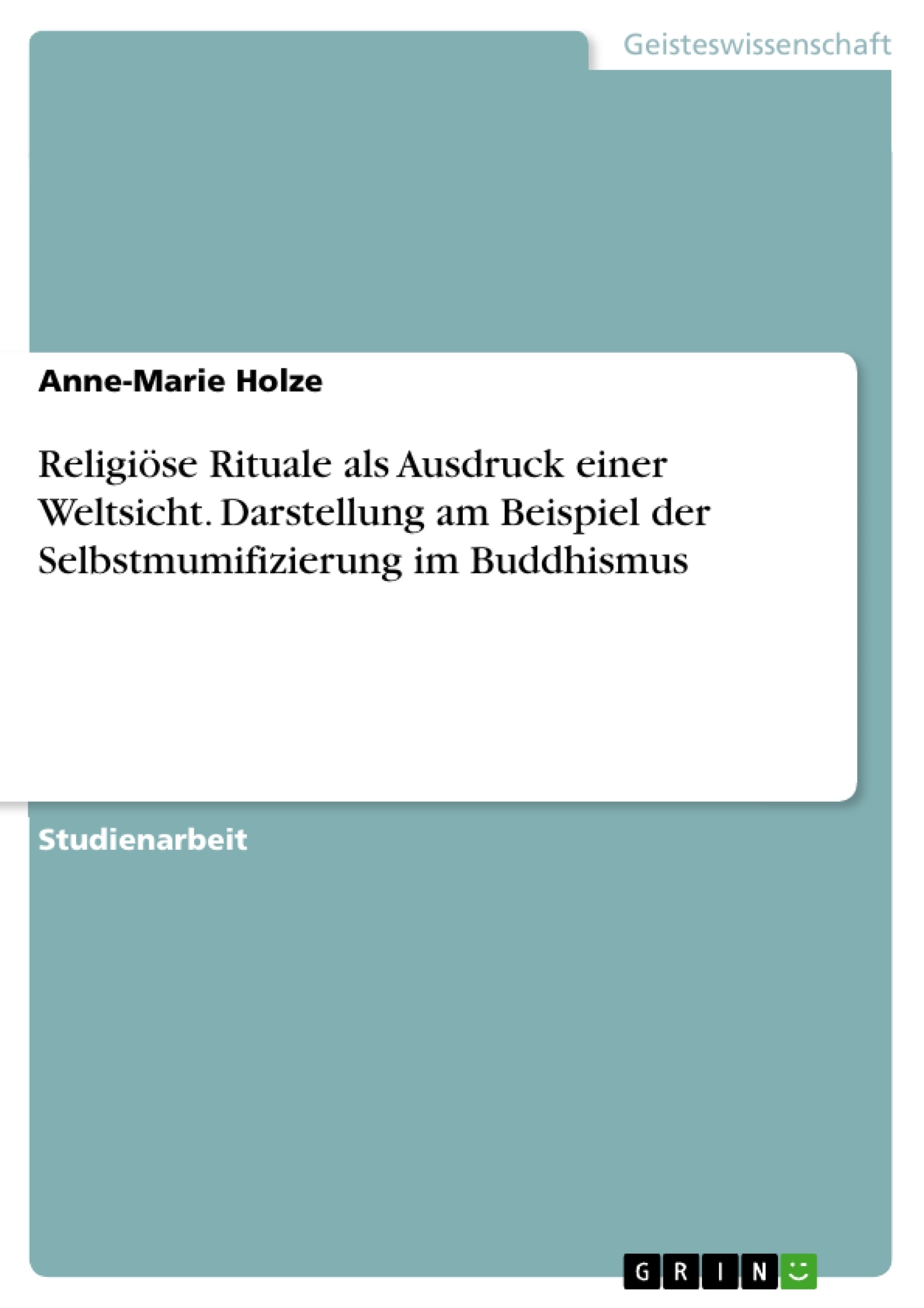Ende Februar 2015 machte eine Schlagzeile in den Medien die Runde: „In dieser Buddha-Statue steckt eine Mumie.“ Wer sich weder mit Religionen auskennt noch dem Buddhismus angehört, wird diesen Zusammenhang nicht verstehen. Bei genauerer Recherche aber scheint deutlich zu werden, dass dahinter ein Ritual der Selbstmumifizierung steckt und auch mehr, als Zeitungs- oder Onlineartikel beschreiben. Aus den gegebenen Informationen aber gelangt man beispielsweise zu folgenden Fragen: Wie ist diese Prozedur in den Buddhismus einzuordnen? Wer ist daran beteiligt? Was soll das für Folgen haben? Welche Denkweise steckt dahinter?
Diesen Aspekten soll sich in der vorliegenden Arbeit angenähert werden. Dazu wird zuerst der Buddhismus als Religion betrachtet und versucht, gedankliche Ursprünge herauszufiltern. Es ist in diesem Rahmen nicht möglich, alle religiösen Facetten darzustellen, jedoch soll der am bedeutendsten scheinende Punkt des Leidens im Buddhismus klarer gemacht werden. Weiterhin wird in diesem Kontext die Bedeutung des Todes untersucht.
Geht man einen Schritt weiter und interpretiert die Denkweise einer Religion als Weltsicht, können die in ihr verankerten Rituale als eine Ausdrucksform jener formuliert werden. Der dritte Punkt der Arbeit widmet sich der Bedeutung von solchen Handlungen. Was sind Rituale? Wozu können sie benutzt werden? Welche Rolle spielen sie? Diese Fragen werden mit dem Fokus auf das Feld der Religionen beantwortet. Dabei geht es nicht speziell um den Buddhismus, er sei hier neben andere religiöse Richtungen gestellt. Schließlich noch einmal besonders hervorgehoben wird der Begriff des Opferrituals. In Punkt vier der Arbeit fließen nun die Erkenntnisse über die Struktur des Buddhismus, die Rolle des Leidens, die Bedeutung von Ritualen und deren Potenzial ineinander. Das aktuelle Beispiel der gefundenen Mönchsleiche in einer Buddha-Statue wird betrachtet, um jene Faktoren zueinander zu führen und anschaulich zu machen. Schließlich sollen folgende Fragen beantwortet werden: Können religiöse Rituale tatsächlich Weltsichten ausdrücken und wie kann dies die Selbstmumifizierung im Buddhismus leisten?
Inhaltsverzeichnis
- 1) Einleitung: Mönchsleiche in Buddha-Statue gefunden
- 2) Die Weltsicht einer Religion
- 2.1.) Die Rolle des Leidens im Buddhismus
- 3) Rituale und Bräuche in der Religion – Kreieren einer Weltsicht
- 3.1.) Opferrituale
- 4) Das Ritual der Selbstmumifzierung im Shingon-Buddhismus
- 4.1.) Die Aufmerksamkeit der Medienwelt
- 4.2.) Selbstmumifizierung & Weltsicht
- 5) Fazit: Religiöse Rituale beschreiben Weltsicht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken können. Am Beispiel der Selbstmumifizierung im Buddhismus soll die Verbindung zwischen religiösen Praktiken und den zugrundeliegenden Denkweisen aufgezeigt werden.
- Die Rolle des Leidens im Buddhismus
- Die Bedeutung von Ritualen in der Religion
- Die Selbstmumifizierung als Ausdruck buddhistischer Weltsicht
- Die Verbindung zwischen Ritualen und Weltsichten
- Der Einfluss von Medien auf die Wahrnehmung religiöser Praktiken
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Fall der gefundenen Mönchsleiche in einer Buddha-Statue und führt die zentralen Forschungsfragen ein. Im zweiten Kapitel wird die Rolle des Leidens im Buddhismus erläutert und die Denkweise dieser Religion als Weltsicht betrachtet. Der dritte Punkt widmet sich der Bedeutung von Ritualen in religiösen Kontexten, insbesondere dem Opferritual. Das vierte Kapitel analysiert das Ritual der Selbstmumifizierung im Shingon-Buddhismus, beleuchtet seine Medienpräsenz und zeigt auf, wie es buddhistische Weltsichten widerspiegelt.
Schlüsselwörter
Buddhismus, Selbstmumifizierung, Rituale, Weltsicht, Leiden, Opferrituale, Medien, Shingon-Buddhismus
Häufig gestellte Fragen zur Selbstmumifizierung im Buddhismus
Was versteht man unter Selbstmumifizierung im Buddhismus?
Die Selbstmumifizierung ist ein ritueller Prozess, bei dem Mönche durch extreme Askese und eine spezielle Diät ihren Körper bereits zu Lebzeiten auf die Mumifizierung vorbereiten, um als "lebende Buddhas" in Statuen oder Schreinen verehrt zu werden.
In welcher buddhistischen Strömung ist dieses Ritual verankert?
Das Ritual der Selbstmumifizierung wird insbesondere mit dem japanischen Shingon-Buddhismus in Verbindung gebracht.
Welche Rolle spielt das Leiden im Buddhismus in diesem Kontext?
Das Leiden (Dukkha) ist ein zentraler Punkt der buddhistischen Lehre. Rituale wie die Selbstmumifizierung dienen dazu, das Leiden zu überwinden und eine bestimmte Weltsicht sowie spirituelle Reinheit auszudrücken.
Können religiöse Rituale Weltsichten ausdrücken?
Ja, Rituale werden in dieser Arbeit als Ausdrucksformen einer tief verankerten religiösen Weltsicht interpretiert, die komplexe Glaubenssätze in handelbare Praktiken übersetzen.
Was sind Opferrituale im religiösen Sinne?
Opferrituale sind Handlungen, bei denen Gaben dargebracht werden, um eine Verbindung zum Transzendenten herzustellen oder um Hingabe und Verzicht innerhalb einer Glaubensgemeinschaft zu demonstrieren.
- Arbeit zitieren
- Anne-Marie Holze (Autor:in), 2014, Religiöse Rituale als Ausdruck einer Weltsicht. Darstellung am Beispiel der Selbstmumifizierung im Buddhismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319719