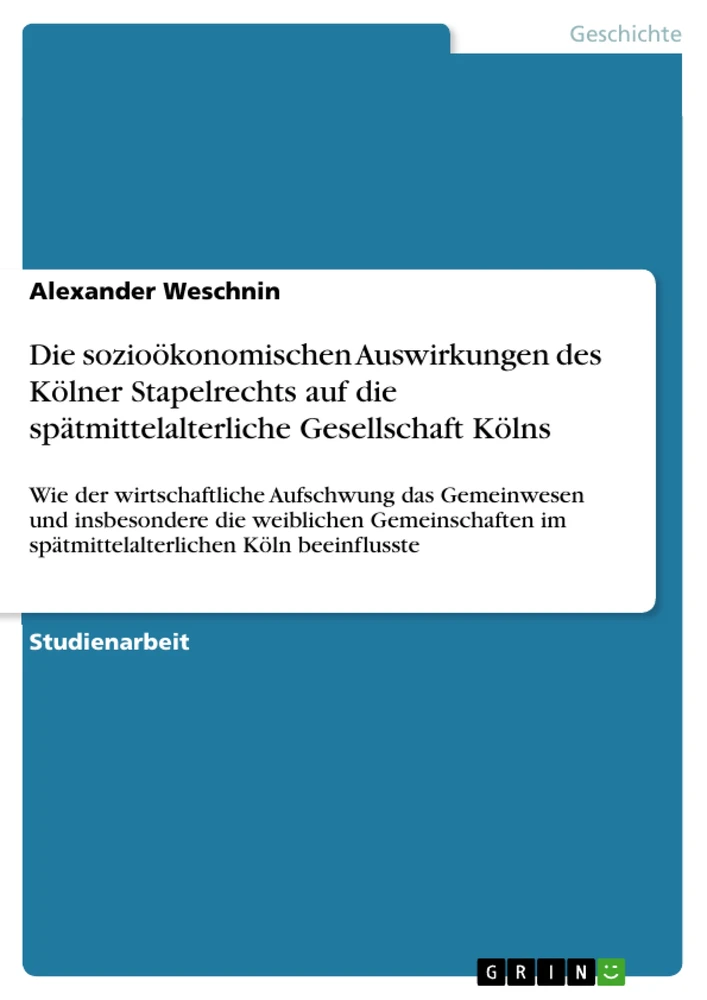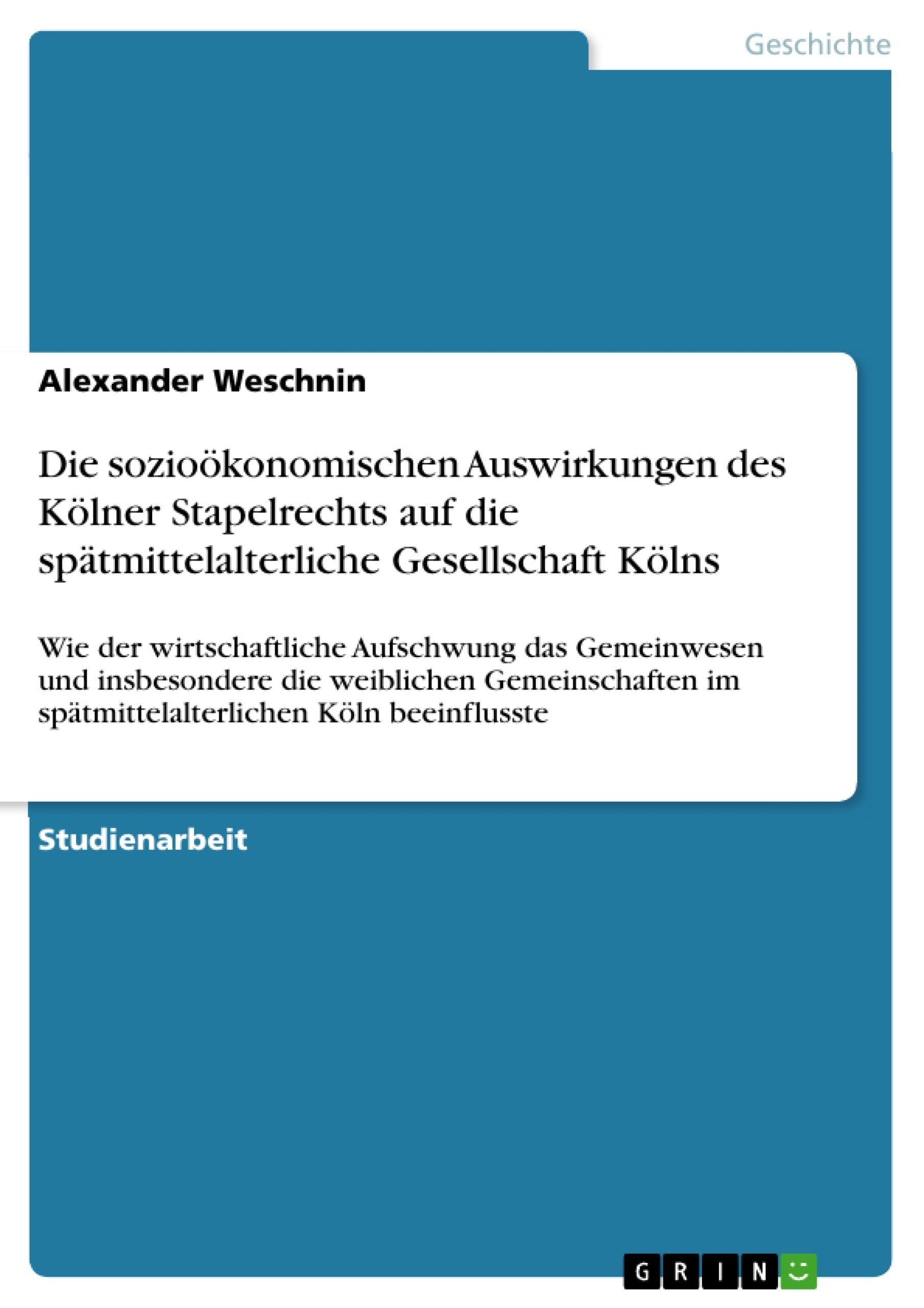Die Stadt Köln galt schon im 9. Jahrhundert als Sancta Colonia, als heiliges Köln und als Stadt mit besonderem Charakter. Seit dem Frühmittelalter entstanden in Köln unzählige Kirchen und Klöster, zwischenzeitlich prägten über hundert kirchliche Institutionen und Gemeinschaften das Stadtbild. Durch die Vielzahl von Orden, Stiften, Klöstern und anderen religiösen und kirchlichen Einrichtungen erlangte Köln eine besondere Bedeutung.
Die Kirche und ihre Institutionen besaßen einen Großteil des „heiligen“ Kölner Stadtbodens und hatten auch jenseits der großartigen Stadtmauer bedeutenden Einfluss. Geistliche Einrichtungen wurden ganz eigene Wirtschaftsunternehmen und fungierten als Auftragsgeber für Bauhandwerk, Goldschmieden und das Seidengewerbe. Die Forschung und die wissenschaftliche Lehre waren für einen längeren Zeitraum überwiegend auf kirchliche Bedürfnisse ausgerichtet, da die Mehrheit der Schriftkundigen Angehörige des Klerus waren und die nötigen Kenntnisse der lateinischen Schrift besaßen.
Im Spätmittelalter erlebte die Stadt Köln dann einen außergewöhnlichen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Durch den gewaltigen Transithandel stiegen die öffentlichen Einnahmen Kölns. Die „verkehrsgünstige Lage“ Kölns und das von Erzbischof Konrad von Hochstaden gewährte Stapelrecht von 1259 n. Chr. wurden zu den wesentlichen Elementen der Kölner Wirtschaftskraft. Eine Besonderheit der Kölner Wirtschaft des Spätmittelalters zeigt sich zudem in Form von Frauenzünften. Kölnerinnen waren fester Bestandteil der vielseitigen und exportorientierten Kölner Wirtschaft und hatten einen „überraschend“ hohen Anteil am Handel mit Metallen, Metallwaren und anderen Wirtschaftszweigen. Der Reichtum Kölns beruhte nicht nur auf der außerordentlichen Wirtschaftskraft, sondern zugleich auf „der Tüchtigkeit seiner Einwohner“. Mit etwa 40.000 Einwohnern war Köln, „die größte und bedeutendste deutsche Stadt“ im Spätmittelalter.
Die Ausarbeitung soll sich im Ganzen mit den sozioökonomischen Auswirkungen des Kölner Stapelrechts auf die spätmittelalterliche Gesellschaft in Köln beschäftigen. Hierbei soll zunächst die Entwicklung des hochmittelalterlichen Kölns zu einer der bedeutendsten Städte des Hochmittelalters skizziert werden. Nachdem der Weg des hochmittelalterlichen Kölns bestritten wurde, steht das von Erzbischof Konrad von Hochstaden gewährte Stapelrecht von 1259 n. Chr. im Fokus der Ausarbeitung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Stadt Köln - Der Weg zu einer der bedeutendsten Städte des Mittelalters
- Das Stapelrecht - Die treibende Kraft der spätmittelalterlichen Wirtschaft.
- Gesellschaftliche Auswirkungen des wirtschaftlichen Aufschwungs ......
- Auswirkungen auf den Klerus
- Auswirkungen auf die weiblichen Gemeinschaften….……………………..
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit den sozioökonomischen Auswirkungen des Kölner Stapelrechts auf die spätmittelalterliche Gesellschaft in Köln. Sie beleuchtet zunächst die Entwicklung Kölns zu einer der bedeutendsten Städte des Hochmittelalters und analysiert anschließend die wirtschaftlichen Folgen des Stapelrechts von 1259 n. Chr..
- Entwicklung des hochmittelalterlichen Kölns
- Wirtschaftliche Auswirkungen des Stapelrechts
- Gesellschaftliche Auswirkungen der Kölner Wirtschaftskraft
- Untersuchung der Auswirkungen auf männliche und weibliche Klostergemeinschaften
- Vergleich der wirtschaftlichen Einflüsse auf die verschiedenen Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Stadt Köln im Spätmittelalter dar und beleuchtet die Bedeutung der Kirchen und karitativen Einrichtungen für die Kölner Gesellschaft. Die Einleitung erläutert die außergewöhnliche wirtschaftliche und kulturelle Blüte der Stadt im Spätmittelalter.
- Das Kapitel „Die Stadt Köln – Der Weg zu einer der bedeutendsten Städte des Mittelalters“ untersucht die Entwicklung Kölns im Hochmittelalter und zeigt die Bedeutung der Stadt als Hauptstadt des Erzbistums und als einflussreicher politischer und wirtschaftlicher Knotenpunkt auf.
Schlüsselwörter
Die Ausarbeitung befasst sich mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Köln, Stapelrecht, Wirtschaft, Gesellschaft, Hochmittelalter, Spätmittelalter, Kirchen, Klöster, Klostergemeinschaften, Frauenzünfte, sozioökonomische Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen
Was war das Kölner Stapelrecht von 1259?
Es verpflichtete auswärtige Kaufleute, ihre Waren für drei Tage in Köln zum Verkauf anzubieten, bevor sie weitertransportiert werden durften.
Wie beeinflusste das Stapelrecht die Kölner Wirtschaft?
Es machte Köln zur bedeutendsten Handelsmetropole im Spätmittelalter und sicherte der Stadt enorme öffentliche Einnahmen durch den Transithandel.
Welche Rolle spielten Frauen in der Kölner Wirtschaft?
Eine Besonderheit waren die Frauenzünfte; Kölnerinnen hatten einen hohen Anteil am Handel mit Metallen, Seide und anderen Exportgütern.
Warum wurde Köln als „Sancta Colonia“ bezeichnet?
Wegen der Vielzahl an Kirchen, Klöstern und Stiften (über hundert), die das Stadtbild prägten und auch als bedeutende Wirtschaftsunternehmen fungierten.
Wie groß war Köln im Spätmittelalter?
Mit etwa 40.000 Einwohnern war Köln die größte und bedeutendste deutsche Stadt dieser Epoche.
- Quote paper
- Alexander Weschnin (Author), 2015, Die sozioökonomischen Auswirkungen des Kölner Stapelrechts auf die spätmittelalterliche Gesellschaft Kölns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321943