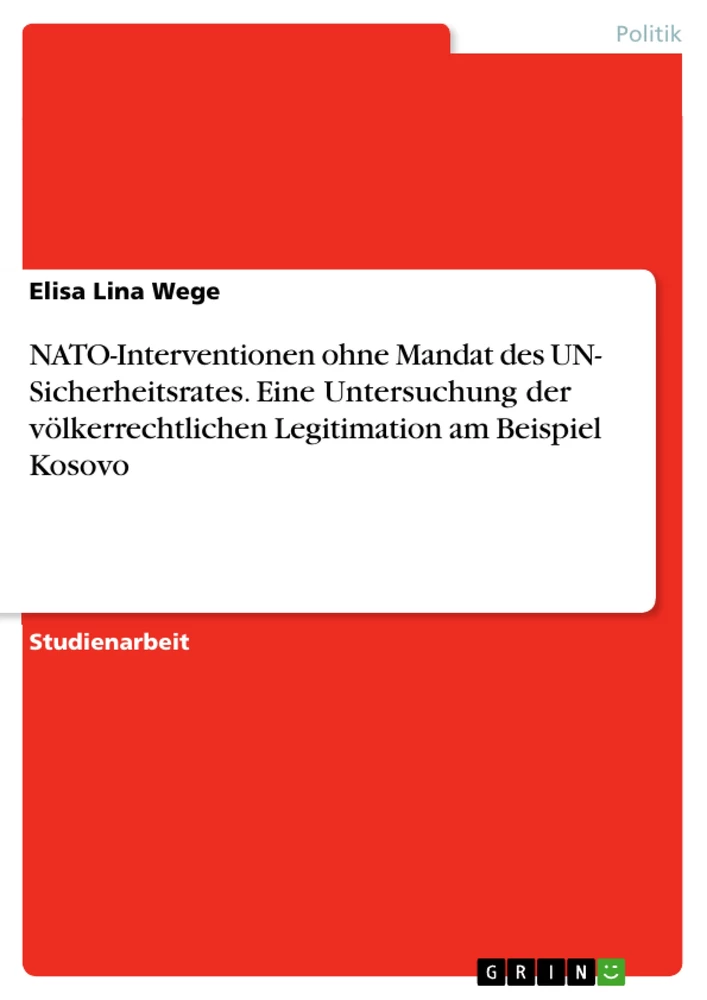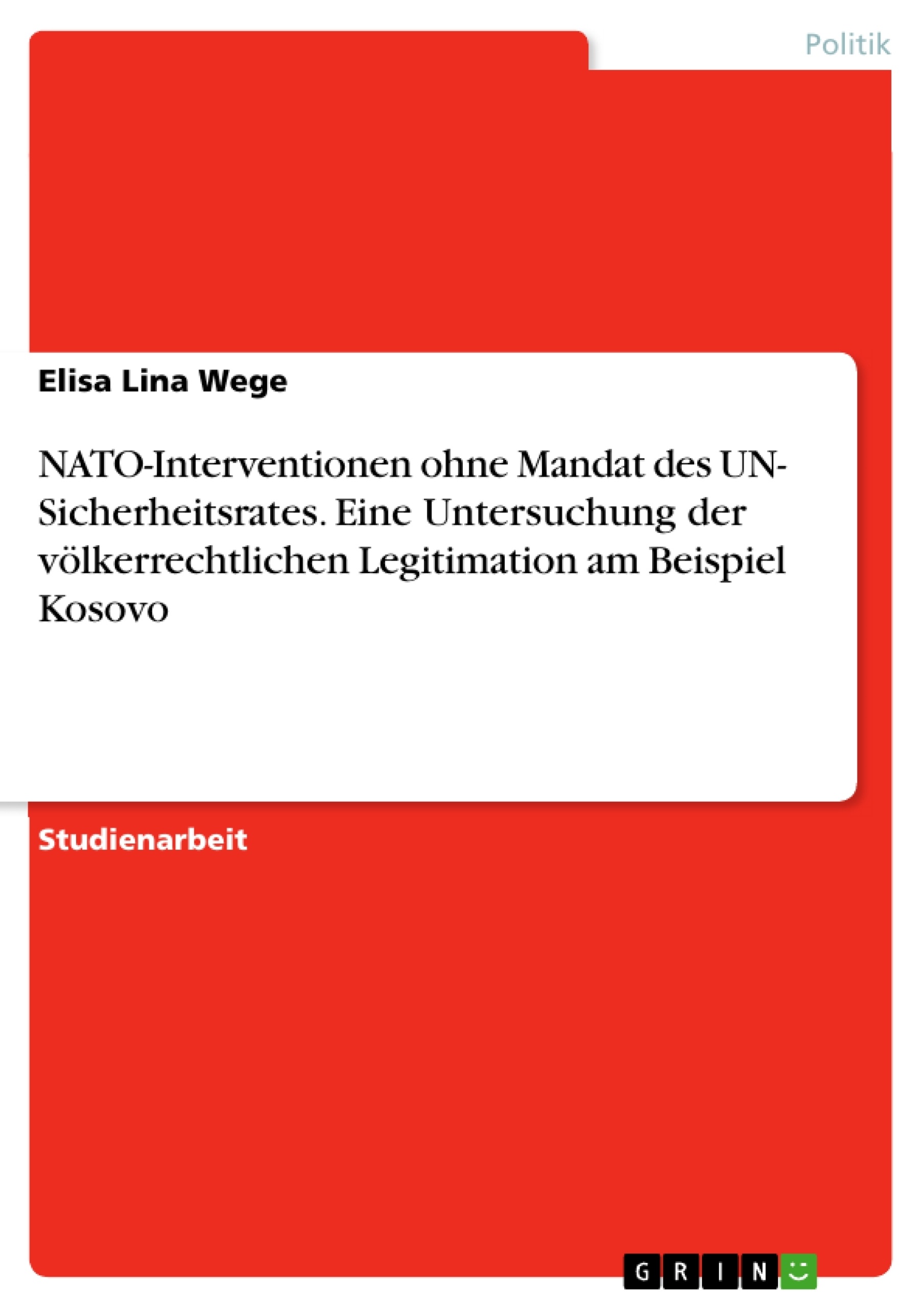Die Wahrung des Weltfriedens gilt als konstitutives Ziel der Vereinten Nationen und soll durch den Verzicht auf die Anwendung von Gewalt in den internationalen Beziehungen und die Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte realisiert werden. Beide Prinzipien sind als grundlegende Rechtsgüter in der Charta der Vereinten Nationen niedergeschrieben und bilden das Fundament des Friedenssicherungssystems der internationalen Staatengemeinschaft. Gewaltverbot und Menschenrechtsschutz können hinsichtlich ihrer Wirkungsentfaltung allerdings auch kollidieren und insofern schwerwiegende völkerrechtliche Kontroversen hervorrufen, wie sich in der Kosovo-Krise offenbarte.
Insofern eskalierte 1998, im Schatten der internationalen Diplomatie, die serbisch- albanische Konfliktspirale im Kosovo und entlud sich in schweren militärischen Auseinandersetzungen und massiven Gewaltexzessen. Besonders die gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Zivilbevölkerung führten dazu, dass sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen dem Konflikt annahm, die Situation als „Friedensbedrohung“ im Sinne von Artikel 39 UNO-Charta qualifizierte und die Konfliktparteien aufforderte eine friedliche Lösung zu finden, um eine drohende humanitäre Katastrophe abzuwenden. Allerdings konnte der Sicherheitsrat keinen Konsens bezüglich militärischer Zwangsmaßnahmen finden, deren Anwendung aufgrund der anhaltenden Verstöße gegen grundlegende Menschenrechte und einer drohenden Flüchtlingskatastrophe notwendig zu werden schien. Daher entschied sich die NATO-Allianz ohne explizites Mandat der Vereinten Nationen und dementsprechend im Konflikt mit dem Gewaltverbot, Luftoperationen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien durchzuführen.
Einsätze, in denen zum Schutz der Menschenrechte militärische Gewalt angewandt wird, werden in der völkerrechtlichen Literatur unter dem Begriff der „humanitären Intervention“ subsumiert. Die humanitäre Intervention ohne explizites Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (einseitige humanitäre Intervention) im Kosovo als zentrale Kontroverse im Kernbereich des Völkerrechts und ihre rechtliche Position im Nexus zwischen Menschenrechtsschutz und universellem Gewaltverbot soll zum Gegenstand dieser Hausarbeit werden.
Dementsprechend soll folgende Fragestellung für die Hausarbeit zielführend sein: Kann die einseitige humanitäre Intervention der NATO-Staaten ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates gerechtfertigt werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsklärung und Darstellung der relevanten Rechtsgrundlage
- Die humanitäre Intervention
- Das universelle Gewaltverbot
- Die Verpflichtung zum Schutz der fundamentalen Menschenrechte
- Der Kosovo Konflikt
- Die völkerrechtliche Bewertung der Rechtsposition der NATO-Staaten
- Nothilfe auf der Grundlage von Art. 51 der UN Charta
- Inzidente Ermächtigung
- Die humanitäre Intervention als völkergewohnheitsrechtliche Ausnahme vom Gewaltverbot
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die völkerrechtliche Legitimation der NATO-Intervention im Kosovo 1999, welche ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates erfolgte. Die zentrale Fragestellung lautet: Kann die einseitige humanitäre Intervention der NATO-Staaten ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates gerechtfertigt werden? Die Arbeit verfolgt einen legalistischen Ansatz, der sich eng an das positive Völkerrecht orientiert.
- Definition und Einordnung des Begriffs „humanitäre Intervention“
- Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Gewaltverbot und Menschenrechtsschutz
- Skizzierung des Kosovo-Konflikts und der damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen
- Bewertung der Rechtsposition der NATO-Staaten im Kontext des Völkerrechts
- Prüfung der Völkerrechtskonformität des NATO-Einsatzes im Kosovo
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der NATO-Intervention im Kosovo ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der völkerrechtlichen Legitimität dieses Einsatzes ohne UN-Mandat. Sie verdeutlicht den Konflikt zwischen dem Gewaltverbot und dem Schutz der Menschenrechte, der sich im Kosovo-Konflikt besonders deutlich zeigte. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz und die Zielsetzung, welche darin besteht, die formale Völkerrechtskonformität des Einsatzes aus legalistischer Perspektive zu untersuchen.
Begriffsklärung und Darstellung der relevanten Rechtsgrundlage: Dieses Kapitel definiert den Begriff der „humanitären Intervention“ und erläutert die relevanten Rechtsgrundlagen. Es beschreibt das universelle Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta und die Verpflichtung zum Schutz der fundamentalen Menschenrechte. Der Fokus liegt auf der Problematik der einseitigen humanitären Intervention, die ohne Mandat des Sicherheitsrates erfolgt und somit im Konflikt mit dem Gewaltverbot steht. Es werden verschiedene Fallgruppen der humanitären Intervention unterschieden, wobei besonders die umstrittene einseitige Intervention im Mittelpunkt steht.
Der Kosovo Konflikt: Dieses Kapitel skizziert den Kosovo-Konflikt und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen, die zur Intervention der NATO führten. Es wird die Eskalation des serbisch-albanischen Konflikts dargestellt, die gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegenüber der Zivilbevölkerung beschrieben und die gescheiterten Bemühungen des UN-Sicherheitsrates, eine friedliche Lösung zu finden, thematisiert. Die Situation wird als "Friedensbedrohung" im Sinne von Artikel 39 der UN-Charta eingeordnet, jedoch konnte kein Konsens bezüglich militärischer Zwangsmaßnahmen gefunden werden.
Die völkerrechtliche Bewertung der Rechtsposition der NATO-Staaten: Dieses Kapitel analysiert die Rechtsposition der NATO-Staaten im Kontext des Völkerrechts. Es prüft die Möglichkeit einer Nothilfe auf Grundlage von Artikel 51 der UN-Charta, die Möglichkeit einer inzidenten Ermächtigung und die humanitäre Intervention als völkergewohnheitsrechtliche Ausnahme vom Gewaltverbot. Die verschiedenen juristischen Argumente, die für und gegen die Legitimität des NATO-Einsatzes sprechen, werden hier im Detail diskutiert.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, Kosovo-Konflikt, Völkerrecht, Gewaltverbot, Menschenrechtsschutz, UN-Sicherheitsrat, NATO, Artikel 51 UN-Charta, einseitige Intervention, Legalismus, Völkergewohnheitsrecht.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Völkerrechtliche Legitimation der NATO-Intervention im Kosovo 1999
Was ist das zentrale Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die völkerrechtliche Legitimation der NATO-Intervention im Kosovo 1999, die ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates erfolgte. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Kann die einseitige humanitäre Intervention der NATO-Staaten ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates gerechtfertigt werden?
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen legalistischen Ansatz und orientiert sich eng am positiven Völkerrecht.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Einordnung des Begriffs „humanitäre Intervention“, analysiert das Spannungsverhältnis zwischen Gewaltverbot und Menschenrechtsschutz, skizziert den Kosovo-Konflikt und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen, bewertet die Rechtsposition der NATO-Staaten im Kontext des Völkerrechts und prüft die Völkerrechtskonformität des NATO-Einsatzes im Kosovo.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel zur Begriffsbestimmung und Darstellung der relevanten Rechtsgrundlagen (inkl. humanitärer Intervention, Gewaltverbot und Menschenrechtsschutz), einem Kapitel zum Kosovo-Konflikt, einem Kapitel zur völkerrechtlichen Bewertung der Rechtsposition der NATO-Staaten (inkl. Nothilfe nach Art. 51 UN-Charta, inzidente Ermächtigung und humanitärer Intervention als völkergewohnheitsrechtliche Ausnahme) und einer Schlussfolgerung.
Welche Rechtsgrundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt das universelle Gewaltverbot nach Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta, die Verpflichtung zum Schutz der fundamentalen Menschenrechte, Artikel 51 der UN-Charta (Nothilfe), die Möglichkeit einer inzidenten Ermächtigung und die humanitäre Intervention als völkergewohnheitsrechtliche Ausnahme vom Gewaltverbot.
Wie wird der Kosovo-Konflikt dargestellt?
Das Kapitel zum Kosovo-Konflikt skizziert die Eskalation des serbisch-albanischen Konflikts, beschreibt die gravierenden Menschenrechtsverletzungen gegen die Zivilbevölkerung und thematisiert die gescheiterten Bemühungen des UN-Sicherheitsrates um eine friedliche Lösung. Die Situation wird als „Friedensbedrohung“ im Sinne von Artikel 39 der UN-Charta eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Humanitäre Intervention, Kosovo-Konflikt, Völkerrecht, Gewaltverbot, Menschenrechtsschutz, UN-Sicherheitsrat, NATO, Artikel 51 UN-Charta, einseitige Intervention, Legalismus, Völkergewohnheitsrecht.
Welche Schlussfolgerung zieht die Hausarbeit?
(Die konkrete Schlussfolgerung ist nicht im bereitgestellten Text enthalten und müsste aus dem vollständigen Dokument entnommen werden.)
- Quote paper
- Master of Arts Elisa Lina Wege (Author), 2012, NATO-Interventionen ohne Mandat des UN- Sicherheitsrates. Eine Untersuchung der völkerrechtlichen Legitimation am Beispiel Kosovo, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/323382