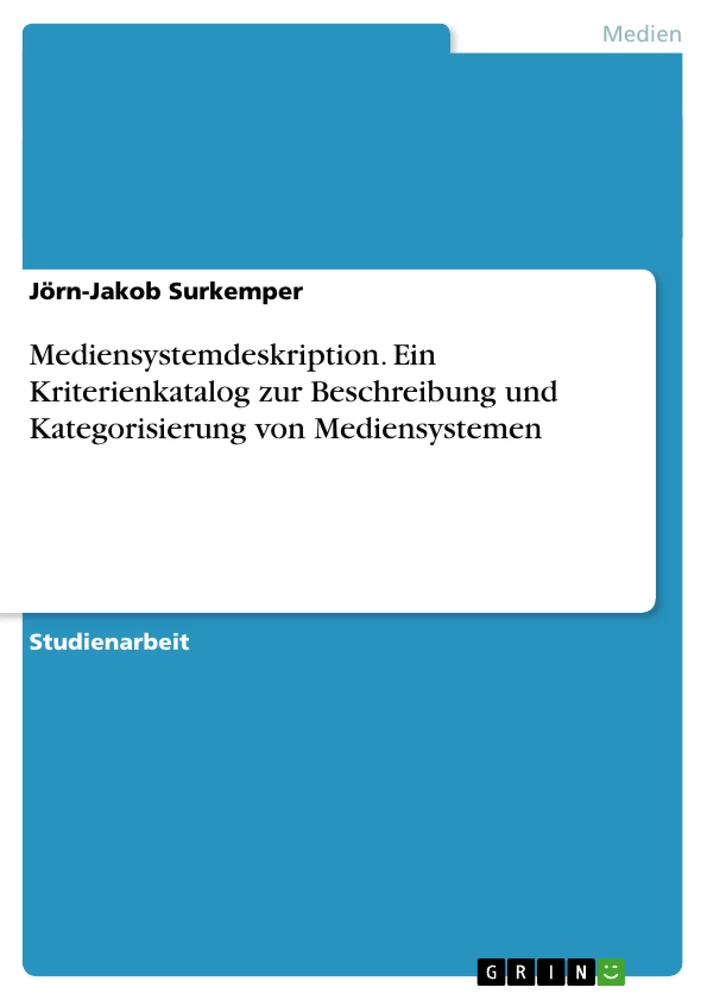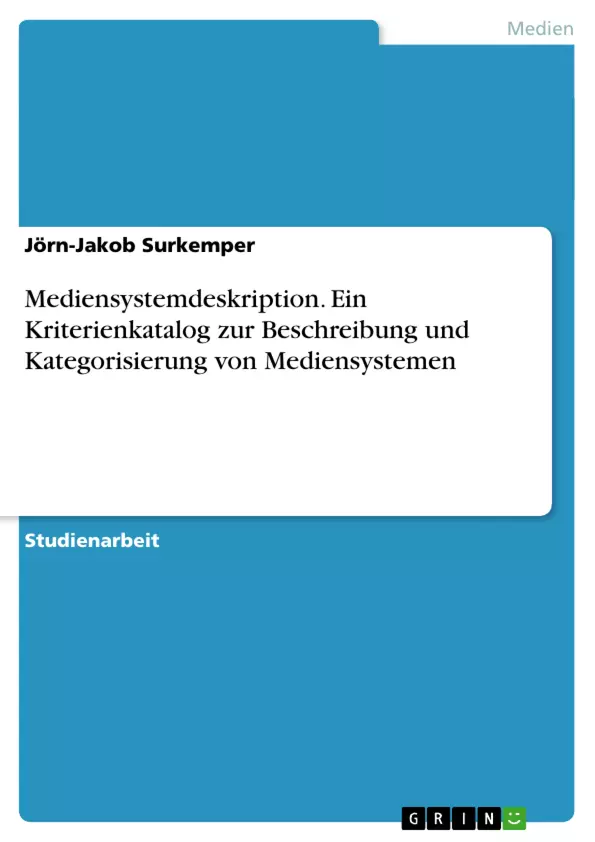„Ein einzelner Fall besagt nichts, es sei denn, in der vergleichenden Zusammenschau mit anderen Fällen. Übertragen auf die vorliegende Thematik heißt das, daß [sic!] sich ein Journalismussystem nur in Unterscheidung von anderen Journalismussystemen beschreiben und bewerten lässt; nur im internationalen Vergleich werden die identitätsstiftenden Einflussfaktoren sichtbar.“ (Esser, 2000, 123) So beschreibt Frank Esser die Relevanz vergleichender Journalismusforschung. Das gleiche gilt natürlich auch für Mediensysteme generell. Doch je weiter man den Blick über die internationale Medienlandschaft schweifen lässt, desto mehr besteht auch die Gefahr, sich in Einzelheiten zu verlieren und eben jene identitätsstiftenden Einflussfaktoren aus den Augen zu verlieren. Beobachtungen müssen daher geordnet und in einen systematischen Zusammenhang gebracht werden. Es bedarf eines abstrakten, konzeptuellen Rahmens Mediensystem, anhand dessen man einzelne konkrete Mediensysteme miteinander vergleichen kann.
Eine der wichtigsten Vorstufen zur systematisch-quantifizierenden Forschung ist nach Esser die Typenbildung1, die verschiedene Untersuchungseinheiten (hier Mediensysteme) anhand der jeweils wesentlichen Kriterien kategorisiert. Sie ermögliche weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Genese von Modellen und schließlich zur Theoriebildung (vgl. Esser, 2000, 136f). Obwohl es bereits verschiedene Ansätze zur Kategorisierung von Mediensystemen gibt, besteht keine Klarheit darüber, welches denn die (wesentlichen) Kriterien sind, die zu eben dieser Kategorisierung führen. Dementsprechend gibt es auch keinen vollständigen und systematisch geordneten Katalog dieser Kriterien (Analysedesign), der einer systematischen und möglichst vollständigen Beschreibung und Kategorisierung von Mediensystemen dienen könnte. Oft sind vorhandene Kategorisierungen normativ gefärbt, und/oder Begrifflichkeiten werden nicht kritisch hinterfragt. Ein weiteres Problem stellt die Operationalisierbarkeit von Kriterien und – als Folgeproblem – die Äquivalenz der gewonnenen Indikatoren dar. Ziel dieser Arbeit ist daher die Erarbeitung eines möglichst universellen und gut operationalisierbaren Analysedesigns, wobei die Kriterien selbst untereinander in einen systematischen Zusammenhang gebracht werden sollen, sodass alle für die Kategorisierung von Mediensystemen relevanten Bereiche abgedeckt werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 WAS IST EIN MEDIENSYSTEM? BEGRIFFSVERWIRRUNGEN- UND KLÄRUNGEN
- 1.1 Der Medienbegriff
- 1.2 Der Systembegriff
- 1.3 Mediensystemkategorisierung
- ANSÄTZE ZUR MEDIENSYSTEMKATEGORISIERUNG
- 2.1 Normative Ansätze
- 2.2 Der Analytische Kontingenz-Ansatz
- 2.3 Der empirische Konvergenz-Ansatz
- 2.4 Konstruktivistische Ansätze
- 3 (KURZ-)VORSTELLUNG EINES ANALYSEDESIGNS ZUR BESCHREIBUNG UND KATEGORISIERUNG VON MEDIENSYSTEMEN
- 3.1 Zugang: Kommunikatorseite
- 3.2 Zugang: Rezipientenseite
- ZUSAMMENFASSUNG UND SCHLUSSBETRACHTUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung eines umfassenden Analysedesigns zur Beschreibung und Kategorisierung von Mediensystemen. Ziel ist es, einen universellen und operationalisierbaren Kriterienkatalog zu erstellen, der es ermöglicht, verschiedene Mediensysteme systematisch zu vergleichen und zu kategorisieren.
- Klärung des Begriffs "Mediensystem"
- Analyse bestehender Ansätze zur Mediensystemkategorisierung
- Entwicklung eines neuen Analysedesigns, das die Defizite bestehender Ansätze behebt
- Etablierung eines Modells der Mediensystemwirklichkeit, das als Grundlage für weitere Forschung dienen kann
- Operationalisierung der Kriterien des Analysedesigns, um eine empirische Anwendung zu ermöglichen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problematik des Begriffs "Mediensystem" und die damit verbundenen Unschärfen. Es werden verschiedene Definitionen des Medienbegriffs und des Systembegriffs vorgestellt, um die Grundlage für eine eindeutige Definition von "Mediensystem" zu schaffen.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Ansätze zur Kategorisierung von Mediensystemen vorgestellt und analysiert. Dazu gehören normative Ansätze, der analytische Kontingenz-Ansatz, der empirische Konvergenz-Ansatz sowie konstruktivistische Ansätze. Die Kritikpunkte und Defizite dieser Ansätze werden herausgearbeitet.
Das dritte Kapitel beinhaltet die Vorstellung des eigenen Analysedesigns, das als Synthese der zuvor analysierten Ansätze entwickelt wurde. Der Fokus liegt dabei auf der Beschreibung und Kategorisierung von Mediensystemen anhand eines systematisch geordneten Katalogs von Kriterien.
Schlüsselwörter
Mediensystem, Mediensystemkategorisierung, Analysedesign, Kriterienkatalog, Kommunikationswissenschaft, Massenkommunikation, Medienbegriff, Systembegriff, Normative Ansätze, Analytischer Kontingenz-Ansatz, Empirischer Konvergenz-Ansatz, Konstruktivistische Ansätze, Kommunikatorseite, Rezipientenseite.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist der Vergleich von Mediensystemen wichtig?
Ein Mediensystem lässt sich nur durch die Unterscheidung von anderen Systemen beschreiben und bewerten. Nur im internationalen Vergleich werden identitätsstiftende Faktoren sichtbar.
Was ist das Ziel des entwickelten Kriterienkatalogs?
Ziel ist die Erarbeitung eines universellen und operationalisierbaren Analysedesigns, um Mediensysteme systematisch beschreiben und kategorisieren zu können.
Welche Ansätze zur Systemkategorisierung gibt es?
Die Arbeit analysiert normative Ansätze, den analytischen Kontingenz-Ansatz, den empirischen Konvergenz-Ansatz und konstruktivistische Ansätze.
Was bedeutet Operationalisierbarkeit in der Medienforschung?
Es geht darum, abstrakte Kriterien (wie Pressefreiheit oder Marktkonzentration) in messbare Indikatoren zu übersetzen, um sie empirisch vergleichbar zu machen.
Welche zwei Seiten werden im Analysedesign unterschieden?
Das Design unterscheidet den Zugang über die Kommunikatorseite (Produzenten/Journalisten) und die Rezipientenseite (Nutzer/Publikum).
- Arbeit zitieren
- Jörn-Jakob Surkemper (Autor:in), 2004, Mediensystemdeskription. Ein Kriterienkatalog zur Beschreibung und Kategorisierung von Mediensystemen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33041