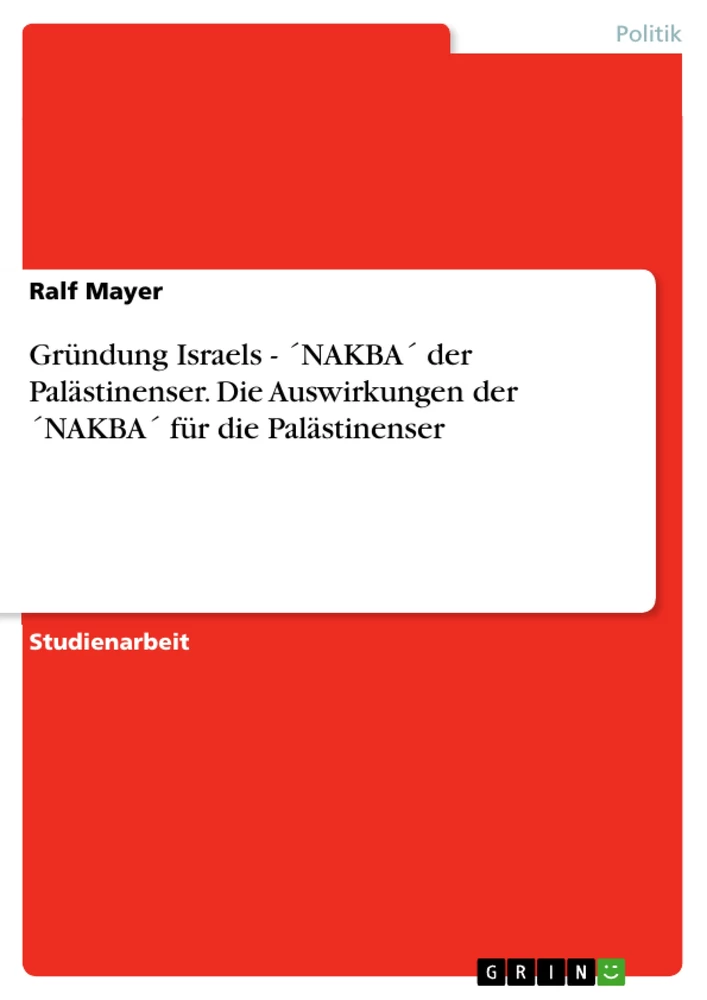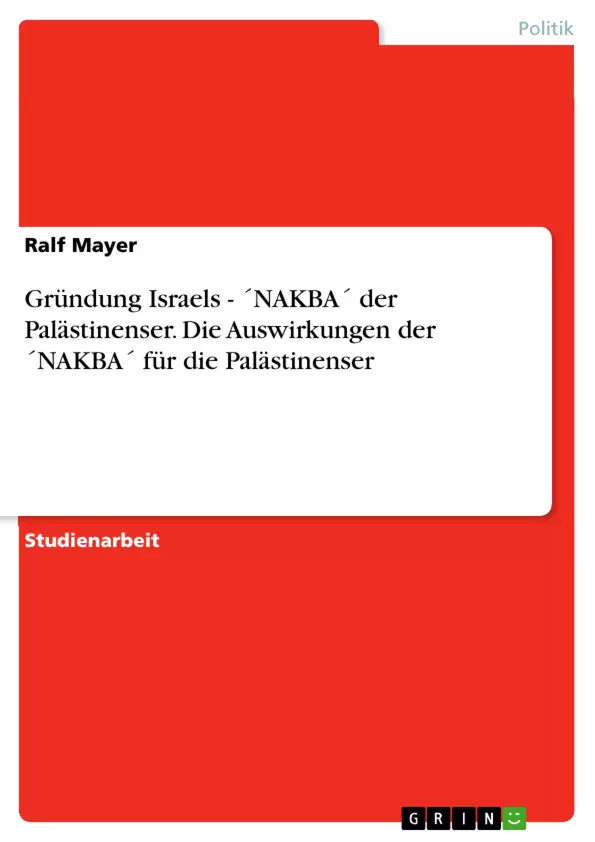Heutzutage gibt es kaum ein historisches Ereignis, welches sich nachhaltiger in einer Region auswirkt und dermaßen kontrovers diskutiert wird. Beide Seiten dieses Ereignisses vertreten glaubhaft und nachvollziehbar ihre Standpunkte, welche gegensätzlicher kaum sein können und bewirken, dass ein unvorstellbarer Krisenherd die gesamte Region Nahost verunsichert.
Dieser Krisenherd ist begründet in mehreren zusammenhängenden Konflikten, in dessen Zentrum der israelisch- palästinensische, sprich jüdisch - arabische Grundkonflikt seht. Dieser Grundkonflikt ist zum einen ein Territorialkonflikt zwischen Israel und den Palästinensern, der sich auch auf die arabischen Nachbar ausweitete. Zum anderen stellt dieser Konflikt einen Interessen- und Wertekonflikt zwischen beiden Völkern dar. Mit der Gründung Israels im Jahre 1948 brach dieser Konflikt offen aus und begründete die "NAKBA" der Palästinenser. Für Israel ist das nächste Jubiläum seiner Gründung wieder ein glücklicher Tag, für die palästinensische Bevölkerung jährt sich dagegen die "NAKBA", die Katastrophe von 1948.
Neben der Konfliktbetrachtung werden Ursachen und deren Auswirkungen dargestellt, welche sich konfliktverschärfend darstellen. Eine Betrachtung der allgemeinen Flüchtlingsproblematik, sowie ausgewählte Punkte zur Situation der Palästinenser im Libanon und in Israel runden neben Ansätzen zur Konfliktentschärfung diese Arbeit ab.
Inhaltsverzeichnis
- „NAKBA“ – das Hauptproblem in Nahost
- Ursachen der „NAKBA“
- Territorialkonflikt Palästina
- Interessen- und Wertekonflikt
- Auswirkungen der „NAKBA“ für die Palästinenser
- Flüchtlingsproblematik
- Palästinenser in Libanon
- Situation auf heutigem palästinensischen Territorium
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die sozialen Auswirkungen der „NAKBA“ (Katastrophe) von 1948 auf die palästinensische Bevölkerung. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse der Ursachen und Folgen dieses Ereignisses, wobei ein Schwerpunkt auf der Flüchtlingsproblematik und der daraus resultierenden Situation der Palästinenser in verschiedenen Regionen liegt.
- Die Ursachen der „NAKBA“, insbesondere der Territorialkonflikt und der Interessenkonflikt zwischen Juden und Arabern.
- Die Flüchtlingsproblematik als zentrale Folge der „NAKBA“.
- Die Situation der Palästinenser in Libanon als Beispiel für die langfristigen Auswirkungen der Vertreibung.
- Die sozioökonomischen Bedingungen der Palästinenser auf dem heutigen palästinensischen Territorium.
- Die Kontroverse um die Interpretation der „NAKBA“ und ihre Bedeutung für den anhaltenden Nahostkonflikt.
Zusammenfassung der Kapitel
„NAKBA“ – das Hauptproblem in Nahost: Dieses Kapitel beschreibt die „NAKBA“ als zentrales Problem im Nahostkonflikt. Es stellt heraus, dass die Gründung Israels im Jahr 1948 für die Palästinenser eine Katastrophe bedeutete, die durch die Vertreibung großer Teile der Bevölkerung gekennzeichnet war. Der Text betont die unterschiedlichen und gegensätzlichen Perspektiven von Israelis und Palästinensern auf dieses Ereignis und verweist auf den komplexen, aus Territorial- und Wertekonflikten bestehenden Grundkonflikt. Die Definition der „NAKBA“ aus palästinensischer Sicht wird präsentiert und im Kontext der unterschiedlichen Ansprüche auf das Land diskutiert, wobei die gemeinsame Herkunft beider Völker als Nachfahren von Eroberern hervorgehoben wird. Die Arbeit konzentriert sich auf die sozialen Auswirkungen der „NAKBA“ auf die palästinensische Bevölkerung, wobei die Daten der Vereinten Nationen als Grundlage dienen.
Ursachen der „NAKBA“: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen der „NAKBA“, indem es den Territorialkonflikt und den Interessen- und Wertekonflikt zwischen arabischen Palästinensern und der zionistischen Bewegung beleuchtet. Der Wunsch nach einem jüdischen Nationalheim und die damit verbundene jüdische Einwanderung nach Palästina stehen im Mittelpunkt der Diskussion. Die Arbeit beschreibt, wie dieses Bestreben auf die realen Gegebenheiten eines dicht besiedelten Landes traf und wie sich die politischen Rahmenbedingungen im Zuge des Ersten Weltkriegs und des britischen Mandats veränderten, was schließlich zur Balfour-Erklärung und zur Gründung Israels führte. Der Einfluss des antisemitischen Klimas in Europa auf die Verwirklichung der zionistischen Ziele wird ebenfalls angesprochen.
Schlüsselwörter
NAKBA, Palästinenser, Israel, Nahostkonflikt, Territorialkonflikt, Flüchtlingsproblematik, Zionismus, Balfour-Erklärung, Vertreibung, soziale Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: „NAKBA“ – das Hauptproblem im Nahostkonflikt
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die sozialen Auswirkungen der „NAKBA“ (Katastrophe) von 1948 auf die palästinensische Bevölkerung. Der Fokus liegt auf den Ursachen und Folgen dieses Ereignisses, insbesondere der Flüchtlingsproblematik und der daraus resultierenden Situation der Palästinenser in verschiedenen Regionen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Ursachen der „NAKBA“ (Territorialkonflikt und Interessenkonflikt), die Flüchtlingsproblematik als zentrale Folge, die Situation der Palästinenser in Libanon, die sozioökonomischen Bedingungen der Palästinenser auf dem heutigen palästinensischen Territorium und die Kontroverse um die Interpretation der „NAKBA“ und ihre Bedeutung für den anhaltenden Nahostkonflikt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zu: „NAKBA“ – das Hauptproblem im Nahostkonflikt (Beschreibung der „NAKBA“ aus palästinensischer Sicht und den unterschiedlichen Perspektiven), Ursachen der „NAKBA“ (Analyse des Territorial- und Interessenkonflikts zwischen Arabern und Zionisten, inklusive des Einflusses des Ersten Weltkriegs, des britischen Mandats und der Balfour-Erklärung), und Auswirkungen der „NAKBA“ für die Palästinenser (mit Fokus auf die Flüchtlingsproblematik, die Situation in Libanon und auf dem heutigen palästinensischen Territorium). Ein abschließendes Kapitel bietet eine Schlussbetrachtung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: NAKBA, Palästinenser, Israel, Nahostkonflikt, Territorialkonflikt, Flüchtlingsproblematik, Zionismus, Balfour-Erklärung, Vertreibung, soziale Auswirkungen.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Daten der Vereinten Nationen und diskutiert unterschiedliche Perspektiven von Israelis und Palästinensern zum Ereignis der „NAKBA“.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit untersucht die sozialen Auswirkungen der „NAKBA“ auf die palästinensische Bevölkerung und analysiert die Ursachen und Folgen dieses Ereignisses, mit einem Schwerpunkt auf der Flüchtlingsproblematik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Ralf Mayer (Author), 2001, Gründung Israels - ´NAKBA´ der Palästinenser. Die Auswirkungen der ´NAKBA´ für die Palästinenser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3333