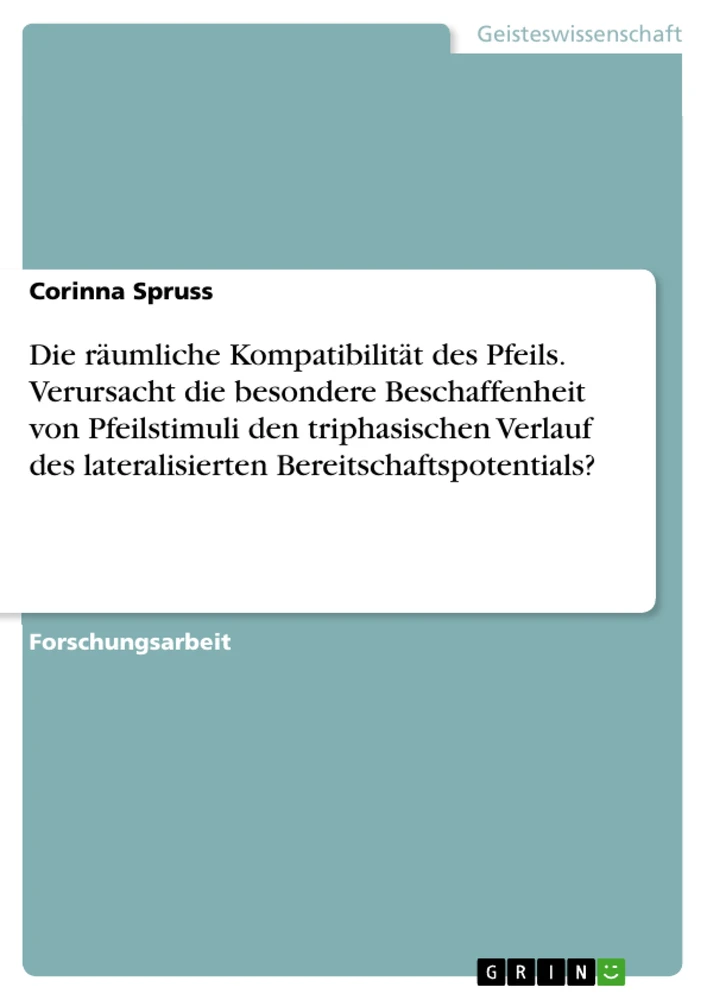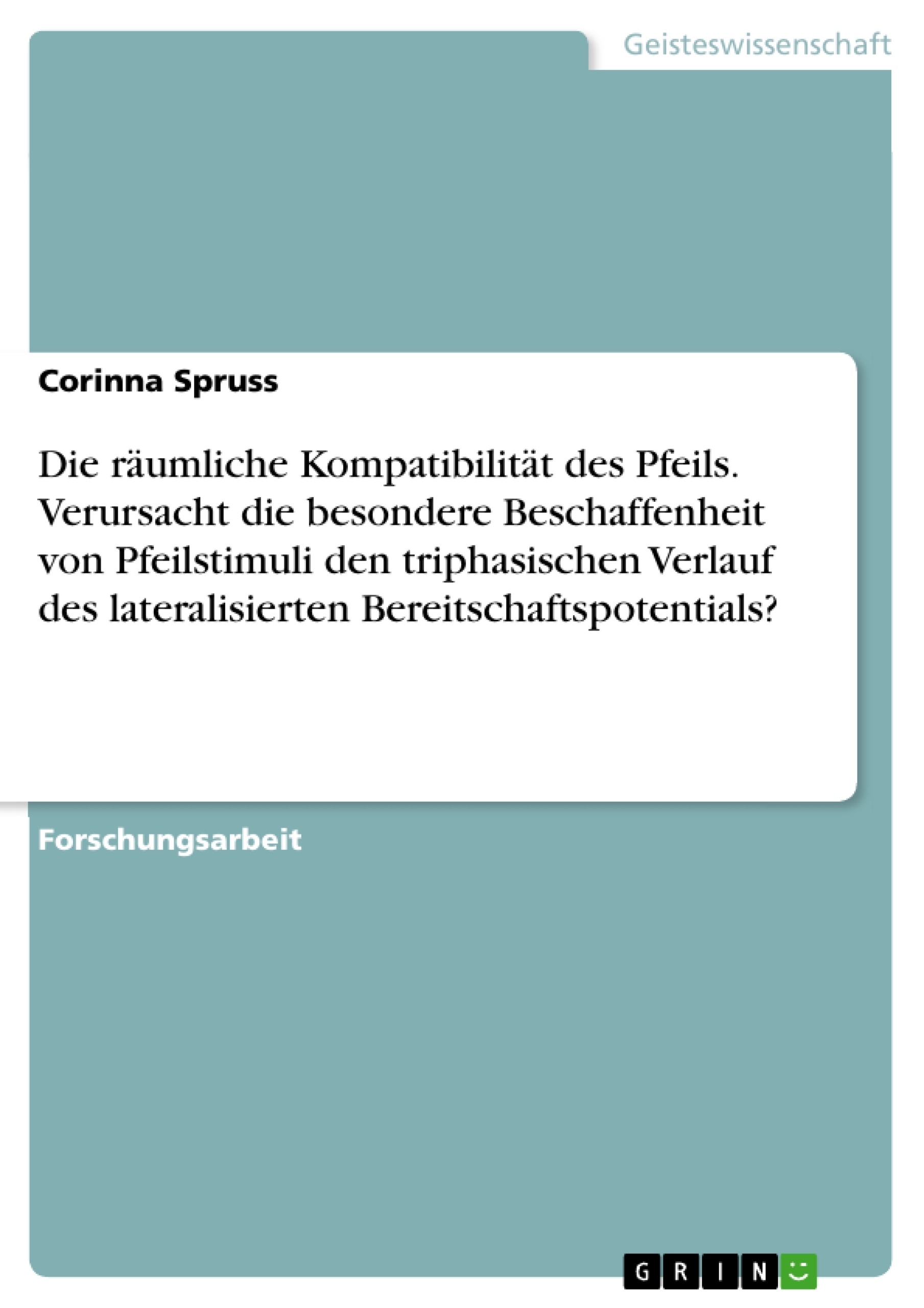In der vorliegenden Arbeit sollte untersucht werden, ob die räumliche Kompatibilität von Pfeilstimuli den triphasischen Verlauf des lateralisierten Bereitschaftspotentials (LRP) verursacht. Die räumliche Kompatibilität entsteht durch eine asymmetrische Stimulation, die durch zwei verschiedene Bedingungen variiert wurde: Geforderte Reaktion auf die Spitze des Pfeils oder seine offene Seite. An der Untersuchung nahmen insgesamt 35 Versuchspersonen beider Geschlechter teil. Von diesen wurden Reaktionszeiten, Fehlerraten sowie EEG-Daten erhoben. Für die beiden Bedingungen wurden unterschiedliche Verläufe des LRPs erwartet. Im Vergleich zu der Bedingung der Pfeilspitze sollten die Ausschläge des LRPs, bei der Reaktion auf die Pfeilöffnung, geringer ausfallen, ausbleiben oder sich umkehren.
Unsere Erwartungen konnten bestätigt werden. Während in der Bedingung, in der auf die Spitze des Pfeils reagiert werden musste, ein triphasischer Verlauf vorlag, war dieser in der Bedingung, in der auf die offene Seite des Pfeils zu reagieren war, lediglich biphasisch. Zusätzlich wurde bei den mittleren Reaktionszeiten und den mittleren Fehlerraten in beiden Kongruenzbedingungen ein vergleichbarer Negativer Kompatibilitätseffekt (NCE) beobachtet.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Fragestellung und Hypothesen
- Methode
- Versuchspersonen
- Stimuli
- Apparatur
- Untersuchungsablauf
- Reaktionszeitmessung
- Elektrophysiologische Messung
- Ergebnisse
- Reaktionszeiten
- Fehlerhäufigkeiten
- EEG-Daten
- Diskussion
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht, ob die räumliche Kompatibilität von Pfeilstimuli den triphasischen Verlauf des lateralisierten Bereitschaftspotentials (LRP) beeinflusst. Dabei werden die Effekte einer asymmetrischen Stimulation auf die Reaktion auf die Pfeilspitze im Vergleich zur Reaktion auf die offene Seite des Pfeils betrachtet.
- Räumliche Kompatibilität und der Einfluss auf das lateralisierte Bereitschaftspotenzial (LRP)
- Untersuchung des triphasischen Verlaufs des LRPs in Abhängigkeit von der Stimuli-Position
- Asymmetrische Stimulation und ihre Auswirkungen auf die Reaktionszeit und Fehlerhäufigkeit
- Elektrophysiologische Messung zur Erfassung des LRPs
- Interpretation der Ergebnisse im Kontext der kognitiven Prozesse der Reaktionssteuerung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der unbewussten Wahrnehmung ein und stellt das Phänomen der selektiven Aufmerksamkeit am Beispiel des Cocktail-Party-Effekts vor. Die Methode des Primings, die im Kontext dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielt, wird erläutert. Die Untersuchung von Stephen Palmer (1975) wird als Beispiel für semantisches Priming vorgestellt. Devine (1989) demonstriert die Aktivierung von Stereotypen durch Priming und deren Einfluss auf die Interpretation von Informationen. Das Konzept des Primings findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der Zielpriming und der Priming von Personenurteilen.
Die Methode des subliminalen Primings wird als Mittel zur empirischen Erfassung der unbewussten Wahrnehmung eingeführt.
Schlüsselwörter
Das zentrale Thema der Arbeit ist die räumliche Kompatibilität von Pfeilstimuli und deren Einfluss auf das lateralisierte Bereitschaftspotenzial (LRP). Weitere Schlüsselwörter sind asymmetrische Stimulation, triphasischer Verlauf, Reaktionszeit, Fehlerhäufigkeit, EEG-Daten, kognitive Prozesse, Reaktionssteuerung, Priming, unbewusste Wahrnehmung und selektive Aufmerksamkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das lateralisierte Bereitschaftspotential (LRP)?
Das LRP ist eine elektrophysiologische Kenngröße der Gehirnaktivität, die die Vorbereitung einer motorischen Reaktion in einer Gehirnhälfte widerspiegelt.
Wie beeinflussen Pfeilstimuli unsere Reaktionszeit?
Pfeile erzeugen eine räumliche Kompatibilität. Reaktionen auf die Pfeilspitze sind oft schneller und zeigen einen charakteristischen triphasischen LRP-Verlauf.
Was ist der 'Negative Kompatibilitätseffekt' (NCE)?
Der NCE beschreibt das Phänomen, dass unter bestimmten Bedingungen Reaktionen auf Reize, die nicht mit dem Zielreiz übereinstimmen, verlangsamt oder fehleranfälliger sind.
Wie wurde die Untersuchung durchgeführt?
Insgesamt 35 Versuchspersonen nahmen an einem Experiment teil, bei dem Reaktionszeiten, Fehlerraten und EEG-Daten während der Präsentation von Pfeilstimuli erhoben wurden.
Was war das Hauptergebnis der Studie?
Die Studie bestätigte, dass die räumliche Beschaffenheit (Spitze vs. offene Seite) den Verlauf des LRP massiv beeinflusst und den triphasischen Verlauf mitverursacht.
- Quote paper
- Corinna Spruss (Author), 2015, Die räumliche Kompatibilität des Pfeils. Verursacht die besondere Beschaffenheit von Pfeilstimuli den triphasischen Verlauf des lateralisierten Bereitschaftspotentials?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/334319