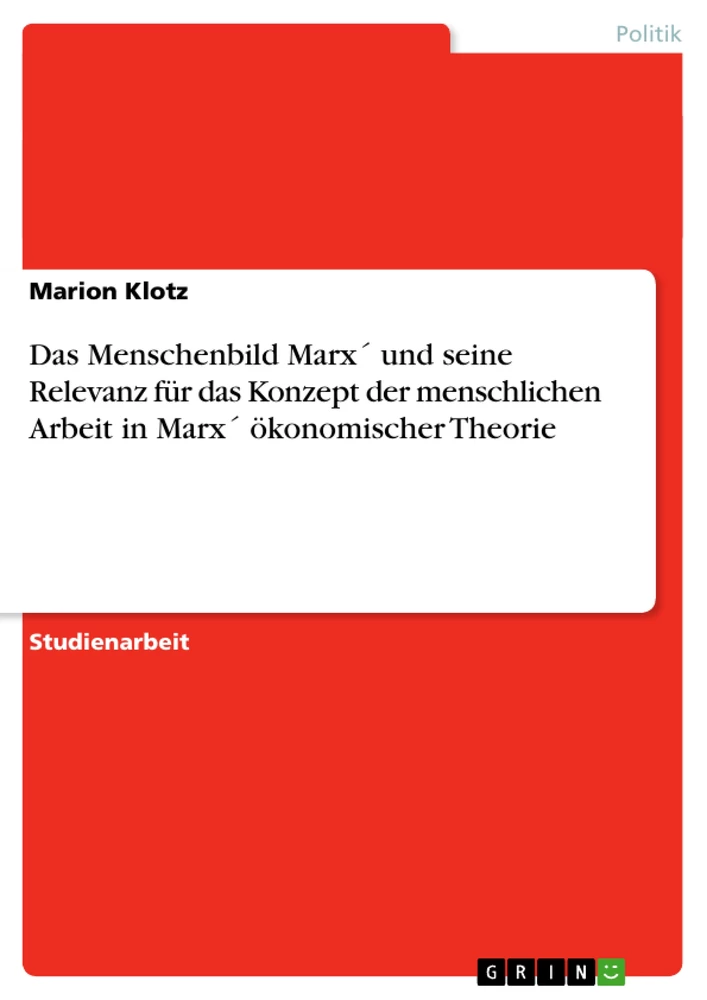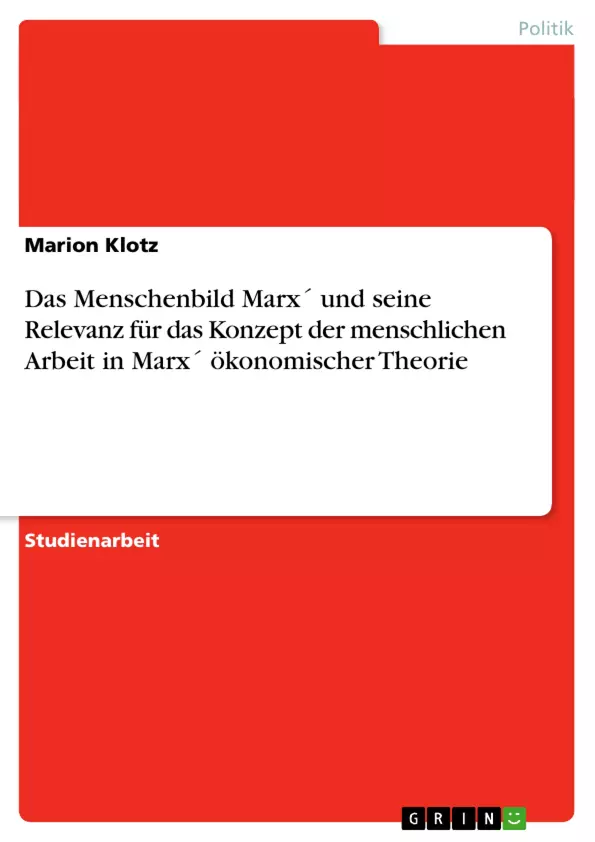Im Mittelpunkt aller Überlegungen und Theorien Marx´ steht sein Verständnis der menschlichen Arbeit und die Bedeutung, die Veränderungen in der Produktionsweise auf den Menschen haben. Diese zentrale Stellung der menschlichen Arbeit lässt sich schwer nachvollziehen, wenn man das Menschenbild Marx nicht kennt, und ein Verständnis ist nahezu unmöglich, wenn man das Menschenbild Marx mit dem der Realkommunisten verwechselt.
In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich also mit der Frage, ob sich anhand des Menschenbildes von Marx erkennen lässt, warum er die menschliche Arbeit als zentrale Kategorie in allen seinen Werken behandelt. Dabei werde ich zuerst das Menschenbild selbst erläutern und dabei speziell auf die konstanten und relativen Triebe des Menschen und die menschlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten eingehen. Danach werde ich mich Marx´ Konzept der Arbeit widmen und hierbei nach einer einführenden Begriffserläuterung das durch die Arbeit bestimmte Verhältnis des Menschen zur Natur und die Arbeit im kapitalistischen System darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Menschenbild Marx'
- Konstante und relative Triebe
- Menschliche Bedürfnisse und Fähigkeiten
- Zusammenfassung
- Das Konzept der menschlichen Arbeit
- Menschliche Produktivität
- Mensch, Natur und Arbeit
- Kapitalismus und Arbeit
- Zusammenfassung
- Literaturangaben
- Eidesstattliche Erklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die zentrale Rolle der menschlichen Arbeit in Marx' ökonomischer Theorie im Kontext seines Menschenbildes. Sie beleuchtet, wie Marx' Verständnis des Menschen seine Konzeption von Arbeit prägt und wie Veränderungen in der Produktionsweise den Menschen beeinflussen. Der Fokus liegt auf der Klärung des Zusammenhangs zwischen Marx' Anthropologie und seiner ökonomischen Theorie, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung der Arbeit.
- Marx' Menschenbild: Unterscheidung zwischen konstanten und relativen Trieben.
- Menschliche Bedürfnisse und Fähigkeiten nach Marx: Natürliche versus gesellschaftlich kreierte Bedürfnisse.
- Das Konzept der menschlichen Arbeit bei Marx: Produktivität, Verhältnis von Mensch und Natur.
- Arbeit im Kapitalismus nach Marx: Künstliche Bedürfnisse und deren Folgen.
- Der Einfluss des gesellschaftlichen Seins auf das menschliche Bewusstsein.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die zentrale Bedeutung des Marx'schen Menschenbildes für das Verständnis seiner ökonomischen Theorie, insbesondere hinsichtlich der menschlichen Arbeit. Sie betont die Notwendigkeit, Marx' Anthropologie von der der Realkommunisten zu unterscheiden, um sein Werk korrekt zu interpretieren. Die Arbeit skizziert den weiteren Aufbau, der sich auf die Erläuterung des Menschenbildes und des Konzepts der Arbeit konzentriert.
Das Menschenbild Marx': Dieses Kapitel analysiert Marx' komplexes Menschenbild, welches weder rein biologisch noch rein sozial deterministisch ist. Es wird die Unterscheidung zwischen konstanten und relativen Trieben erläutert. Konstante Triebe, wie das Bedürfnis nach sozialem Zusammenleben und die Fähigkeit zur Planung und Produktion, sind angeboren und universell. Relative Triebe hingegen sind gesellschaftlich bedingt und historisch veränderlich. Der Einfluss gesellschaftlicher Bedingungen auf die Ausprägung menschlicher Eigenschaften wird diskutiert, wobei Marx' berühmtes Zitat über das gesellschaftliche Sein und Bewusstsein im Mittelpunkt steht. Das Kapitel zeigt auf, wie sich diese beiden Triebarten gegenseitig beeinflussen und die „modifizierte Menschennatur“ formen.
Das Konzept der menschlichen Arbeit: Dieses Kapitel befasst sich mit Marx' Verständnis von Arbeit, beginnend mit einer Begriffsklärung. Es analysiert das durch Arbeit bestimmte Verhältnis zwischen Mensch und Natur und wie dieses Verhältnis im Kapitalismus verändert wird. Die Kapitel unterstreichen die Bedeutung der menschlichen Produktivität und die Rolle der Arbeit im Schaffen künstlicher Bedürfnisse im Kapitalismus. Die Arbeit wird nicht nur als Mittel zum Überleben betrachtet, sondern auch als Ausdruck der menschlichen Kreativität und Gestaltungsfähigkeit. Der Einfluss des Kapitalismus auf die menschliche Arbeit und die Verzerrung der menschlichen Natur werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Marx, Menschenbild, Arbeit, konstante Triebe, relative Triebe, menschliche Bedürfnisse, Produktivität, Kapitalismus, gesellschaftliches Sein, Bewusstsein, sozio-ökonomische Bedingungen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Marx'schen Menschenbildes und seiner ökonomischen Theorie
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die zentrale Rolle der menschlichen Arbeit in Marx' ökonomischer Theorie im Kontext seines Menschenbildes. Sie untersucht, wie Marx' Verständnis des Menschen seine Konzeption von Arbeit prägt und wie Veränderungen in der Produktionsweise den Menschen beeinflussen. Der Fokus liegt auf dem Zusammenhang zwischen Marx' Anthropologie und seiner ökonomischen Theorie.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Marx' Menschenbild mit der Unterscheidung zwischen konstanten und relativen Trieben, menschliche Bedürfnisse und Fähigkeiten (natürliche vs. gesellschaftlich kreierte), das Konzept der menschlichen Arbeit (Produktivität, Verhältnis Mensch-Natur), Arbeit im Kapitalismus (künstliche Bedürfnisse und deren Folgen) und den Einfluss des gesellschaftlichen Seins auf das menschliche Bewusstsein.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Marx'schen Menschenbild, ein Kapitel zum Konzept der menschlichen Arbeit und abschließende Literaturangaben sowie eine eidesstattliche Erklärung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung.
Was sind konstante und relative Triebe nach Marx?
Konstante Triebe sind angeborene und universelle Bedürfnisse wie das nach sozialem Zusammenleben und die Fähigkeit zur Planung und Produktion. Relative Triebe sind gesellschaftlich bedingt und historisch veränderlich.
Welche Rolle spielt die menschliche Arbeit in Marx' Theorie?
Arbeit ist für Marx nicht nur Mittel zum Überleben, sondern Ausdruck menschlicher Kreativität und Gestaltungsfähigkeit. Das Verhältnis von Mensch und Natur durch Arbeit wird analysiert, insbesondere wie dieses im Kapitalismus verändert wird, einschließlich der Schaffung künstlicher Bedürfnisse.
Wie beeinflusst der Kapitalismus die menschliche Arbeit laut Marx?
Marx argumentiert, dass der Kapitalismus die menschliche Arbeit verzerrt und künstliche Bedürfnisse schafft, die die menschliche Natur beeinflussen. Die Arbeit wird entfremdet und dient hauptsächlich der Profitmaximierung.
Wie wird das Verhältnis zwischen gesellschaftlichem Sein und Bewusstsein dargestellt?
Die Arbeit untersucht den Einfluss des gesellschaftlichen Seins auf das menschliche Bewusstsein, basierend auf Marx' bekanntem Zitat. Es wird gezeigt, wie gesellschaftliche Bedingungen die Ausprägung menschlicher Eigenschaften formen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Marx, Menschenbild, Arbeit, konstante Triebe, relative Triebe, menschliche Bedürfnisse, Produktivität, Kapitalismus, gesellschaftliches Sein, Bewusstsein, sozio-ökonomische Bedingungen.
Worum geht es in der Einleitung?
Die Einleitung führt in die Thematik ein und betont die Bedeutung des Marx'schen Menschenbildes für das Verständnis seiner ökonomischen Theorie. Sie hebt die Notwendigkeit hervor, Marx' Anthropologie von der der Realkommunisten zu unterscheiden.
Was ist in den Kapiteln zum Menschenbild und zur Arbeit enthalten?
Das Kapitel zum Menschenbild analysiert Marx' komplexes Menschenbild, die Unterscheidung zwischen konstanten und relativen Trieben und deren gegenseitigen Einfluss. Das Kapitel zur Arbeit befasst sich mit Marx' Verständnis von Arbeit, dem Verhältnis Mensch-Natur und den Veränderungen im Kapitalismus.
- Citar trabajo
- Marion Klotz (Autor), 2004, Das Menschenbild Marx´ und seine Relevanz für das Konzept der menschlichen Arbeit in Marx´ ökonomischer Theorie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33542